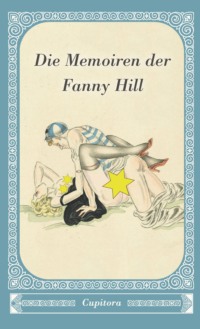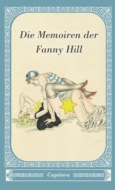Kitabı oku: «Die Memoiren der Fanny Hill»
John Cleland
Die Memoiren der Fanny Hill
ISBN 978-3-95841-777-9
© by Cupitora in der BEBUG mbH, Berlin
Erster Brief
Gnädigste,
ich will mich nun hinsetzen, um Ihnen einen unwiderlegbaren Beweis der Aufmerksamkeit zu liefern, die ich Ihren Wünschen – für mich sind es Befehle – widme. So undankbar die Aufgabe auch sein mag – ich werde doch alle jene skandalumwitterten Stationen meines Lebensweges heraufzubeschwören suchen, die ich schließlich hinter mir ließ, um mich des Segens zu erfreuen, der von der Macht der Liebe, von Gesundheit und Glück verliehen wird. Ich befinde mich ja noch in der Blüte meiner Jugend, und es ist daher nicht zu spät, um die Muße zu genießen, die mir dank Reichtum und glücklicher Umstände gewährt ist. Ich kann meinen Verstand wieder üben, der zweifelsohne nicht vernachlässigt werden darf; er regte mich sogar inmitten des Strudels ausschweifender Vergnügungen, in den ich hineingerissen wurde, zur Beobachtung der Gewohnheiten und Sitten der Welt an – jedenfalls mehr, als es bei meinen unglückseligen Berufsgenossinnen üblich ist. Sie betrachten alle Gedanken oder Überlegungen als ihre eigentlichen Feinde und halten sie daher so fern von sich, wie es ihnen nur möglich ist, falls ihnen nicht gleich deren gnadenlose Unterdrückung gelingt.
Da ich jegliches lange Einleitungsgerede auf den Tod hasse, werde ich Ihnen hiermit Pardon erteilen und keine weiteren Verteidigungsgründe anführen, die Sie auf die ausschweifungsreichen Strecken meines Lebens vorbereiten sollen. Ich werde darüber mit derselben Freiheit schreiben, wie ich es geführt habe.

Wahrheit – volle, nackte Wahrheit: Das ist die Losung! Ich werde mich nicht einmal bemühen, auch nur das Ende eines Tüllschleiers über alles zu breiten, sondern will die Ereignisse so darstellen, wie sie jetzt in aller Natürlichkeit vor mir auftauchen; keinesfalls kann ich mich darum kümmern, ob die Gesetze der Schamhaftigkeit verletzt werden, die sowieso nie für solch rückhaltlose Preisgabe von Intimitäten, wie sie zwischen uns üblich ist, geschaffen wurden. Sie haben ja auch zu viel Gespür und zu viel Kenntnis von den Originalen, um prüde und heuchlerisch die Nase über die Kopien zu rümpfen. Die bedeutendsten Menschen, die den besten und tonangebenden Geschmack haben, schmücken ohne Skrupel ihre Privaträume mit Aktbildern, obwohl sie gemäß den gewöhnlichen Vorurteilen die gleichen Bilder für keine anständige Dekoration von Treppenhäusern und Salons halten.
Das ist also die Voraussetzung und dürfte reichen. Ich beginne nun schnurstracks meine persönliche Geschichte. Mein Mädchenname war Frances Hill. Ich wurde in einem kleinen Dorf in der Nähe von Liverpool in Lancashire geboren. Meine Eltern waren äußerst arm und, wie ich guten Glaubens annehme, äußerst ehrlich.
Mein Vater war durch eine Verstümmelung seiner Glieder untauglich geworden, den beschwerlichen Weg der bäuerlichen Plackerei einzuschlagen; er verdiente sich mit Hilfe der Netzstrickerei seinen mageren Unterhalt. Dieser wurde durch die Arbeit meiner Mutter, die eine Schule für die Mädchen der Nachbarschaft leitete, nicht gerade viel vergrößert. Sie hatten mehrere Kinder gehabt; es blieb jedoch keines am Leben außer mir, die ich von der Natur eine vollkommen gesunde Konstitution mitbekommen hatte.
Bis zum Alter von vierzehn Jahren war meine Erziehung nicht besser als irgendeine andere. Das Lesen oder vielmehr Buchstabieren eines unleserlichen Gekritzels und ein bisschen simple Handarbeit machten das ganze Lehrsystem aus; die ganze Grundlage meiner Tugend war nichts anderes als eine völlige Unwissenheit über das Laster; dazu kam noch die scheue Zurückhaltung, die unser Geschlecht in jenem zarten Lebensalter auszeichnet, da die Dinge mehr durch ihre Neuheit Schrecken auslösen oder uns fortscheuchen als durch irgendetwas sonst. Es ist dies allerdings eine Furcht, die allzu oft auf Kosten der Unschuld überwunden wird, wenn nämlich das junge Fräulein allmählich anfängt, einen Mann nicht länger als ein Raubtier anzusehen, das sie auffressen möchte.
Meine arme Mutter hatte ihre Zeit derart genau eingeteilt zwischen der Beschäftigung mit ihren Schülerinnen und ihren kleinen Sorgen im Haushalt, dass sie nur noch sehr wenig davon für meine Erziehung übrig hatte; sie ließ auch, aus ihrer Unwissenheit über viele Verfehlungen heraus, nie eine entsprechende Anspielung fallen und brachte mir nie einen Gedanken nahe, der mich vor irgendwelchen Gefahren geschützt hätte. Ich war soeben in mein fünfzehntes Lebensjahr eingetreten, als mir das schlimmste Unglück, das es geben kann, zustieß. Ich verlor meine zärtlich geliebten Eltern, die beide, mit ein paar Tagen Abstand, an den Pocken starben. Mein Vater verschied zuerst und beschleunigte dadurch den Tod meiner Mutter. Plötzlich fand ich mich als unglückliches Waisenkind ohne Verwandte; es war nämlich nur Zufall gewesen, dass mein Vater sich dort niedergelassen hatte, da er eigentlich aus Kent stammte. Die grausame Krankheit, die für beide so verhängnisvoll geworden war, hatte auch mich ergriffen, aber die Symptome zeigten sich so mild und günstig, dass ich binnen kurzem außer Gefahr war und, was ich damals noch nicht zu schätzen wusste, auch keinerlei zurückgebliebene Spuren aufwies. Ich übergehe hier das Ausmaß an natürlicher Trauer und das Leid, das ich bei dieser düsteren Angelegenheit empfand. Nach einer kurzen Spanne Zeit zerstreute die Unbesonnenheit jenes Lebensalters nur allzu bald mein Sinnieren über den unersetzlichen Verlust.
Nichts half mir mehr, mich damit abzufinden, als die Pläne, die sofort in meinen Kopf gesetzt wurden – ich sollte nach London gehen und dort einen Dienst suchen. Jede mögliche Hilfe und aller Beistand wurden mir dabei von einer gewissen Esther Davis versprochen, einer jungen Frau, die auf Besuch zu ihren Verwandten gekommen war und nach einem Aufenthalt von ein paar Tagen an ihren Arbeitsplatz zurückreisen wollte. Es gab sowieso im ganzen Dorf niemand mehr, der Interesse daran gehabt hätte, was aus mir wurde, und der Einwände gegen meinen Plan vorbrachte.
Da selbst die Frau, die nach dem Tod meiner Eltern für mich sorgte, mich dazu ermutigte, fasste ich also kurzerhand den Entschluss, den Schritt in die weite Welt zu wagen. Ich wollte nach London gehen, um »mein Glück zu suchen« – eine Redensart, die, nebenbei gesagt, mehr Abenteurer beiderlei Geschlechts, die vom Land kommen, in den Abgrund führt, als sie ans Ziel bringt.
Auch Esther Davis sprach mir Trost zu und spornte mich an, mich zusammen mit ihr hinzuwagen; sie regte meine kindliche Neugier mit all den schönen Sachen an, die in London zu sehen waren: die Grabmäler, die Löwen, der König, die königliche Familie, die prächtigen Komödien und Opern sowie, kurz gesagt, die ganzen Vergnügungen, die künftig zu meinem Lebenskreis gehören sollten. Die vielen Einzelheiten ließen meinen kleinen Kopf schwindeln.
Ich kann mich nicht ohne Heiterkeit an die naive Bewunderung, vermischt mit etwas Neid, erinnern, mit der wir armen Mädchen, deren Sonntagskleidung nicht über Hemden aus Sackleinen und Fähnchen aus billigem Zeug hinausging, das Gewand Esthers betrachteten. Es war von Satinstreifen durchzogen; ihr Häubchen war mit Spitzen eingefasst; farbenprächtige Bänder hingen an ihr herum, und ihre Schuhe besaßen Schnüre aus Silber. All diese Schätze, schlossen wir, gab es also in London; ein Hauptpunkt meines Planes war es nun, mir meinen Anteil an ihnen zu sichern.
Der Gedanke, sich der Gesellschaft einer Städterin zu vergewissern, lag demnach nahe; ebenso verhielt es sich mit den Gründen, die Esther veranlassten, sich während der Reise zur Stadt um mich zu kümmern. Sie erzählte mir, wie es ihrer Art entsprach, dass verschiedene Mädchen vom Lande sich samt ihrem ganzen Anhang herausgemacht hätten, weil sie stets ihre Tugend bewahrten; so konnten sie ihre Herren dazu bringen, dass sie von ihnen geheiratet wurden und ihre Kutschen bekamen und ungeheuer großartig und glücklich lebten; manche, wie es gerade ging, wurden sogar Herzoginnen! Alles schien eitel Glück und Sonnenschein zu sein, und warum sollte ich nicht Anteil daran haben, genauso wie eine andere?
Solche Aussichten reizten mich, die viel versprechende Reise anzutreten und einen Ort zu verlassen, wo ich zwar geboren war, wo jedoch keine Angehörigen lebten, denen ich nachtrauern musste; das heimatliche Dorf war für mich überhaupt unerträglich geworden wegen des Wechsels von einem Klima der Zärtlichkeit zu dem kalten Lufthauch der Wohltätigkeit, der mich selbst noch bei der einzigen Freundin berührte, in die ich meine letzte Hoffnung auf fürsorglichen Schutz gesetzt hatte. Allerdings benahm sie sich insofern anständig mir gegenüber, als sie sich darum bemühte, die mir gebliebenen Habseligkeiten in Bargeld zu verwandeln.
Was davon nach der Bezahlung von Schulden und Begräbnisgebühren noch vorhanden war, übergab sie bei meiner Abreise meiner Verfügungsgewalt. Mein gesamtes Vermögen bestand aus einer höchst dürftigen Garderobe, die in einem recht handlichen Koffer verpackt war, sowie acht Guineen und siebzehn Silberschillingen. Dies bedeutete für mich einen größeren Schatz, als ich ihn bis dahin jemals auf einem Haufen zusammen gesehen hatte. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass es möglich war, ihn restlos auszugeben; mich als Herrin einer derart riesigen Summe zu sehen, erfüllte mich mit solcher Freude, dass ich dem Pack guter Ratschläge, der mir als Draufgabe angeboten wurde, nur sehr wenig Aufmerksamkeit schenkte.
Alsbald wurden für Esther und für mich Plätze in der Postkutsche nach London bestellt. Die völlig unwesentliche Szene des Abschieds, bei der ich einige Tränen, halb aus Wehmut, halb aus Freude, vergoss, lasse ich beiseite; aus denselben Gründen überspringe ich auch alles, was ich unterwegs erlebte, zum Beispiel den Kutscher, der mich wie berauscht anglotzte, oder die Pläne, die mir manche Mitreisenden unterbreiteten und die durch die Wachsamkeit meiner Anstandsdame Esther im Keim erstickt wurden. Um ihr Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, muss ich sagen, dass sie mich mütterlich umhegte, wenn sie auch gleichzeitig verlangte, dass ich als Dank für ihre Obhut alle ihre Gepäckstücke schleppte. Ich erledigte das mit der größten Begeisterung, da ich mich in allem, was ich tat, ihr gegenüber zutiefst verpflichtet fühlte.
Sie passte tatsächlich scharf darauf auf, dass wir bei keiner Rechnung zu hoch veranschlagt wurden. Ebenso war sie dahinter her, mit so wenig Geld wie nur möglich auszukommen; Verschwendungssucht war ihr Laster wahrlich nicht.
Es war schon ziemlich spät an einem Sommerabend, als wir die Stadt London erreichten, denn unser Vehikel war sehr langsam, obwohl es zuletzt von einem Sechsergespann gezogen wurde.
Wir fuhren durch die belebtesten Straßen zu unserem Gasthof; der Lärm der Kutschen, der ungewohnte Anblick der Läden und Häuser gefiel mir und erschreckte mich zugleich.
Versuchen Sie sich jedoch nun meine Enttäuschung und Überraschung vorzustellen: Als wir bei unserem Gasthof angelangt waren und unsere Siebensachen entladen und uns ausgehändigt wurden, benahm sich meine Reisebegleiterin und Gönnerin plötzlich sehr befremdlich und zeigte mir die kalte Schulter. Sie hatte mich während der Reise mit der größten Zärtlichkeit behandelt und mich nicht durch das geringste Anzeichen auf den gewaltigen Schlag vorbereitet, den ich von meiner einzigen Vertrauten und Freundin an dem für mich unbekannten Ort empfangen sollte. Wahrscheinlich fürchtete sie, dass ich ihr nun zur Last fiele.
Anstatt mir ihre Hilfe und ihre guten Dienste weiterhin zu versprechen, worauf ich mich verlassen hatte – mehr wünschte ich gar nicht –, meinte sie selbst allem Anschein nach, dass sie ihre Pflicht mir gegenüber genügend erfüllt habe, indem sie mich gesund ans Ziel meiner Reise gebracht hatte. Da sie offenbar in ihrem Benehmen nichts sah, was nicht natürlich und ganz in Ordnung war, umarmte sie mich, um von mir Abschied zu nehmen. Ich war so bestürzt und derart betroffen, dass ich keinesfalls die Geistesgegenwart beweisen konnte, von meinen Hoffnungen und Erwartungen zu sprechen, die ich mit ihrer Erfahrung und Ortskenntnis verknüpft hatte.
Während ich nun dastand, stumm und wie vor den Kopf geschlagen – was sie zweifellos nur als Abschiedsschmerz ansah –, suchte sie mir durch das folgende Geschwätz eine kleine Aufmunterung zu geben: Jetzt wären wir also gesund in London angekommen, und sie müsste zu ihrem Arbeitsplatz gehen; sie könne mir nur raten, auch so bald als möglich einen solchen zu finden; ich brauche keine Sorge deswegen zu haben, denn es gebe mehr Stellen als Pfarrkirchen; sie empfehle mir, mich zu einer Stellenvermittlung zu begeben; wenn sie von einer Gelegenheit hören würde, könne sie mich ja aufsuchen und es mich wissen lassen; in der Zwischenzeit solle ich eine Privatunterkunft suchen und sie benachrichtigen, wo man mich erreichen könne; im übrigen wünsche sie mir viel Glück und hoffe, ich würde ehrbar bleiben und meinem Namen keine Schande machen. Damit nahm sie Abschied von mir und ließ mich stehen, als ob es mir sehr leicht fiele, mir selbst überlassen zu sein.
Als ich auf diese Weise allein zurückblieb, völlig verloren und ohne Freunde, begann ich die Härte der Trennung in ihrer ganzen Bitterkeit zu spüren. Die Abschiedsszene hatte in einem kleinen Zimmer im Gasthof stattgefunden. Kaum hatte mir Esther den Rücken gewandt, als der Schmerz über meine hilflose Lage sich in einem Strom von Tränen Bahn brach; das erleichterte den Druck, der auf meinem Herzen lastete, unendlich. Natürlich fühlte ich mich trotzdem äußerst verwirrt und einsam, da ich nicht wusste, was ich mit mir anfangen sollte.
Einer der Kellner trat zu mir heran und stürzte mich in noch größere Unsicherheit, indem er mich kurz angebunden fragte, ob ich etwas wünsche, worauf ich in aller Unschuld antwortete: »Nein.« Ich bat ihn jedoch, mir zu sagen, wo ich eine Unterkunft für die Nacht finden könne. Er erwiderte, er wolle mit der Wirtin sprechen; sie kam sofort und teilte mir trocken – und ohne im geringsten an der Not, die mir ja anzusehen war, teilzunehmen – mit, dass ich ein Bett für einen Schilling haben könne; sie nehme an, ich hätte Bekannte in der Stadt – hierbei seufzte ich tief und vergeblich – und würde am nächsten Tag für mich selbst sorgen.
Es ist unglaublich, was für unbedeutende Tröstungen sich das menschliche Herz in seiner ärgsten Drangsal sucht. Die simple Gewissheit, für diese Nacht ein Bett zum Schlafen zu haben, dämpfte meine Sorgen. Da ich mich auch schämte, der Besitzerin des Gasthofs zu erzählen, dass ich gar keine Freunde in der Stadt besäße, an die ich mich wenden könne, fasste ich den Entschluss, am nächsten Tag sofort zu einer Stellenvermittlung zu gehen; ich war für dieses Vorhaben mit einigen Adressen ausgerüstet, die Esther auf die Rückseite der Abschrift einer Ballade geschrieben hatte. Dort wollte ich mich nach einer Stelle erkundigen, die für mich als Mädchen vom Lande in Frage kam und wo ich ein Auskommen finden könnte, ehe meine kleine Geldreserve zu Ende war. Esther hatte mir oft wiederholt, dass mein Erfolg davon abhinge, wie ich mich zurechtmachen würde. Wenn ich auch über ihre Art, mich im Stich zu lassen, sehr erschüttert war, so hörte ich deswegen doch nicht völlig auf, mich auf ihren Rat zu stützen; gutmütigerweise fing ich sogar an, ihr Benehmen durchaus vertretbar zu finden und auf meine Unwissenheit vom Leben die Schuld zu schieben, dass ich es in jenem Licht betrachtet hatte, wie ich es zunächst tat.
Dementsprechend zog ich mich also am nächsten Tag so sauber und gefällig an, wie es meine ländliche Garderobe nur erlaubte. Ich ließ mein Gepäck mit der ausdrücklichen Bitte, darauf zu achten, bei der Wirtin und wagte mich auf die Straße. Irgendwelche Schwierigkeiten außer jenen, die bei einem jungen Mädchen vom Land, das kaum fünfzehn Jahre zählt, zu erwarten sind – für das jedes Schild oder Geschäft bereits eine aufregende Falle darstellt –, gab es für mich nicht. Somit ging ich zu der ersehnten Stellenvermittlung.
Sie wurde von einer älteren Dame betrieben, die beim Eingang saß, um die Kundschaft zu empfangen. Ein Buch lag vor ihr, riesig in Format und Stärke, sowie mehrere Listen, völlig bedeckt mit den Adressen von Stellen.
Ich trat zu dieser wichtigen Persönlichkeit, ohne meine Augen zu erheben oder die Leute um mich herum anzuschauen, die dort mit derselben Absicht warteten wie ich selbst. Nach einem ungeheuer tiefen Knicks vor ihr suchte ich in kläglich stotternden Worten mein Anliegen vorzubringen.
Nachdem Madame mich zu Ende angehört hatte, wobei sie den ernsthaften Ausdruck eines kleinen Staatsministers zur Schau trug und mit einem einzigen Blick auf mich erkannte, wer ich war, gab sie mir nicht etwa gleich eine Antwort, sondern ersuchte mich vorerst um den ersten Schilling. Nach dessen Entgegennahme erzählte sie mir, dass Stellen für Frauen äußerst selten seien, besonders wenn eine wie ich zu zart gebaut aussähe für eine harte Arbeit; sie würde aber in ihrem Buch suchen und sich darum kümmern, was für mich zu machen sei. Ich solle doch ein bisschen warten, bis sie ein paar andere Kunden abgefertigt habe.
Daraufhin zog ich mich zurück, ziemlich tief betroffen von der Erklärung, die Ausblick auf eine sehr unsichere Lage eröffnete.
Bald fasste ich wieder etwas mehr Mut und suchte nach Zerstreuung für meine trübseligen Gedanken. Ich wagte meinen Kopf ein wenig zu erheben und blickte im Zimmer umher, wobei meine Augen direkt die Augen einer Dame trafen – denn in meiner äußersten Naivität hielt ich sie für eine solche –, die in einer Ecke des Zimmers saß, angetan mit einem Samtmantel (nicht zu vergessen: mitten im Sommer!). Sie hatte ihren Kapotthut abgenommen, war dick wie ein Polster, rotgesichtig und mindestens fünfzig Jahre alt.
Sie schaute mich an, als ob sie mich mit den Augen fressen wollte, und begutachtete mich vom Kopf bis zu den Füßen, ohne die geringste Rücksicht auf die Verlegenheit und das Erröten zu nehmen, das ihre starren Blicke bei mir verursachten; zweifellos bedeutete das für sie die stärkste Empfehlung und das beste Zeichen, dass ich für ihre Absichten wie geschaffen war. Nach kurzer Zeit, während der mein Aussehen, meine Person, meine ganze Gestalt einer strengen Prüfung unterzogen worden waren – die ich, was mich betrifft, günstig zu beeinflussen suchte, indem ich mich steif machte, meinen Kopf gerade setzte und mein bestmögliches Aussehen unterstrich –, trat sie auf mich zu und sagte zu mir mit denkbar größter Gesetztheit:
»Herzchen, suchen Sie eine Stelle?«
»Ja, wenn es geruht« – mit einem Knicks bis zum Boden.
Auf das hin teilte sie mir mit, dass sie tatsächlich in diese Vermittlung gekommen sei, weil sie selbst ein Dienstmädchen suche; sie glaube, ich sei dafür geeignet mit Hilfe von ein paar guten Ratschlägen; sie halte mein aufrichtiges Aussehen für ein ausreichendes Zeugnis; London sei sonst ein sehr schlimmer und verderbter Ort; sie hoffe, ich würde brav sein und mich fern von böser Gesellschaft halten. Kurzum, sie sagte mir alles, was von einem Menschen, der lange in der Stadt gelebt hat, erwartet werden konnte, und ging dabei weit über das notwendige Maß hinaus, um eine schlichte, unerfahrene Landpomeranze einzuwickeln, die von der Furcht beseelt war, auf der Straße herumlungern zu müssen.
Ich stürzte mich natürlich freudig auf das erstbeste Angebot, das Schutz verhieß, besonders da es vonseiten einer Dame kam, die ernsthaft schien und einer Matrone ähnlich sah; meine schmeichlerische Phantasie versicherte mir nämlich, dass meine neue Herrin etwas Ähnliches sei. Ich wurde somit unter der Nase der guten Frau, die das Vermittlungsbüro führte, angestellt; ich konnte nicht anders als ihr schlaues Lächeln und ihr Achselzucken zu beobachten und deutete das naiverweise als ein Zeichen ihrer Freude, dass ich so schnell eine Stelle gefunden hatte. Wie ich später jedoch erfuhr, verstanden diese beiden alten Hexen einander sehr gut, denn dort war ein Markt, auf dem Mrs. Brown, meine Herrin, oft anwesend war, um sich irgendwelche frischen Waren, die angeboten wurden, für den Gebrauch ihrer Kunden und ihren eigenen Gewinn herauszusuchen.
Madame war so froh über ihren Handel, dass sie – wie ich annehme aus Besorgnis, eine gut gemeinte Warnung oder irgendein Zufall könnte mich noch aus ihren Fingern entschlüpfen lassen – sich eiligst entschloss, mich mit einer Kutsche zu meinem Gasthof zu bringen; dort bemühte sie sich selbst um meine Koffer. So war ich trotz meiner Anwesenheit davon befreit, die geringsten Skrupel wegen einer Erklärung, wohin ich gehen wollte, zu hegen.
Nachdem das erledigt worden war, befahl sie dem Kutscher, zu einem Geschäft in St. Paul’s Churchyard zu fahren, wo sie ein Paar Handschuhe kaufte, die sie mir schenkte. Dann forderte sie den Kutscher auf, zu ihrem Haus zu fahren; dort wurden wir wunschgemäß vor der Tür abgesetzt. Unterwegs war ich von ihr weiterhin aufgemuntert worden, indem sie mich mit den gängigsten Schwindeleien in Atem hielt. Aus keiner Silbe ihrer Reden konnte ich etwas anderes entnehmen, als dass ich durch ein wahres Riesenglück in der Obhut der liebenswürdigsten Herrin gelandet war – um nicht gleich Freundin zu sagen, was gewiss in dieser gebildeten Welt nahe liegend gewesen wäre. Also betrat ich ihr Haus mit dem größten Vertrauen und der ungestörtesten Freude, wobei ich mir selbst versprach, Esther Davis von meinem einmaligen Glück Bescheid zu geben, sobald ich mich etwas zurechtgefunden hatte.
Ich kann Ihnen versichern, dass meine gute Meinung von meiner Stelle nicht gemindert wurde durch den Anblick des sehr schönen rückwärtigen Wohnzimmers, in das ich geführt wurde; es schien mir großartig möbliert zu sein, da ich noch nie schönere Zimmer gesehen hatte als die üblichen in den Gasthöfen an der Landstraße.
Es gab da zum Beispiel zwei vergoldete Pfeilerspiegel und einen Geschirrschrank, auf dem einige Teller, die als Zierrat aufgestellt waren, ins Auge stachen. Alles zusammen bestärkte meine Überzeugung, dass ich in eine Familie von größtem Ansehen eingetreten war.
Nun fing meine Herrin eine lange Rede an. Sie sagte mir, ich solle gut aufgelegt sein und mich daran gewöhnen, mich ihr gegenüber frei zu benehmen. Sie habe mich nicht engagiert, um ein gewöhnliches Dienstmädchen zu bekommen, das die Hausarbeit verrichten müsse, sondern damit ich eine Art von Gesellschafterin für sie sei. Falls ich ein gutes Mädchen wäre, würde sie mehr als zwanzig Mütter ersetzen. Alldem antwortete ich mit den tiefsten und unbeholfensten Knicksen und gewissen einsilbigen Brocken, wie etwa: »Ja! Nein! Gewiss!«
Danach ergriff meine Herrin die Glocke. Das stämmige Dienstmädchen kam herein, das uns auch eingelassen hatte.
»Hier, Martha«, sagte Mrs. Brown, »ich habe soeben diese junge Dame angestellt, um jemanden für meine Wäsche zu haben. Geh hinauf und zeig ihr das Zimmer; ich empfehle dir, sie mit der gleichen großen Achtung zu behandeln wie mich selbst, denn sie gefällt mir derart ausgezeichnet, dass ich gar nicht weiß, was ich alles für sie tun soll.«
Martha war ein schalkhaftes Frauenzimmer und an diese Kunst des Köderns gewöhnt; sie reagierte prompt, machte einen halben Knicks vor mir und bat mich, ihr zu folgen. Auf dieselbe Tour zeigte sie mir ein hübsches Zimmer, zwei Treppen hoch und nach hinten gelegen, wo es ein bequemes Bett gab, in dem ich, wie Martha mir erzählte, zusammen mit einer feinen jungen Dame, einer Cousine meiner Herrin, schlafen sollte, die bestimmt sehr lieb zu mir sein würde. Dann stürzte sie sich in begeisterte Lobeshymnen auf ihre gute Herrin, ihre süße Herrin, und wie furchtbar glücklich ich doch sei, ihren Gefallen zu finden; ich hätte mir nichts Besseres aussuchen können. Auf ähnliche Weise fuhr sie mit ihrem dummdreisten Geschwafel ein Weilchen fort, das dermaßen dick aufgetragen war, dass es bei jedem Verdacht erweckt hätte, der nicht ein derart naives Ding wie ich war, das überhaupt nichts vom Leben ahnte und jedes Wort, das es hörte, für bare Münze nahm. So konnte Martha natürlich leicht merken, was für eine Methode sie bei mir zu gebrauchen hatte; sie wusste mich durchaus richtig einzuschätzen, um mir das Passende vorzusäuseln, das mich mit meinem Käfig versöhnte und blind für die Gitterstäbe machte.
Während dieser heuchlerischen Rede über die Art meiner künftigen Dienste ertönte wieder die Glocke. Wir gingen hinunter, und ich wurde in das gleiche Wohnzimmer geführt, wo ein Tisch mit drei Gedecken vorbereitet war. Meine Herrin hatte jetzt eines ihrer Lieblingsmädchen bei sich, eine beachtliche Stütze ihres Hauses, deren Aufgabe darin bestand, solche jungen Fohlen, wie ich selbst eines war, vorzubereiten und zurechtzutrimmen für den Rennstall. Zu diesem Zweck war sie als Bettgenossin für mich ausgesucht worden; um ihr mehr Einfluss zu verleihen, hatte sie den Titel einer Cousine der ehrwürdigen Präsidentin dieses Klubs zugewiesen erhalten.
Hier wurde ich einer neuen Begutachtung unterzogen, die mit dem völligen Einverständnis von Miss Phoebe Ayres endete; so lautete der Name meiner erwählten Lehrerin, deren Fürsorge und Unterricht ich liebevoll anempfohlen wurde.
Das Abendessen wurde bald auf den Tisch gebracht. Treu ihrer Absicht, mich weiterhin als Gesellschafterin zu behandeln, überging Mrs. Brown in einem Ton, der jeden Einwand hinwegfegte, sogleich meine bescheidenen und verlegenen Beteuerungen, dass ich doch nicht zusammen mit der gnädigen Frau essen könne; das hatte mir meine höchst dürftige Erziehung doch eingeflüstert, dass derartiges sich niemals gehöre oder in Ordnung sein könne.
Bei Tisch wurde das Gespräch hauptsächlich von den beiden Damen geführt; ihre doppelsinnigen Reden wurden dann und wann unterbrochen durch die liebevolle Fürsorge für mich – alles zu dem einzigen Zweck, meine Begeisterung über meine jetzige Lage zu nähren und festwurzeln zu lassen. Vergrößern konnten sie meine Freude nicht mehr – bei einem solchen Neuling, wie ich es war!
Es wurde auch beschlossen, dass ich mich ein paar Tage abseits halten sollte, um nicht gesehen zu werden, bis man Kleider für mich gefunden hatte, die zu meiner künftigen Rolle passen würden, nämlich die der Gesellschafterin meiner Herrin. Von der Beachtung dieses Punktes würde es weitgehend abhängen, was für einen Eindruck meine Erscheinung machte. Wie sie nur zu gut wussten, ließ mich die Aussicht auf den Umtausch meiner bäuerlichen Kleidung gegen die Londoner Raffinessen die Bedingung des Hausarrests willig annehmen. In Wahrheit verhielt es sich so, dass Mrs. Brown verhindern wollte, dass ich von irgendeinem ihrer Kunden gesehen oder angesprochen wurde oder von ihren Schäfchen – so wurden die Mädchen genannt, die für die Kunden ausgewählt worden waren –, bis für meine Jungfernschaft, die ich allem Anschein nach zum Dienst bei der gnädigen Frau mitgebracht hatte, ein guter Absatz gesichert worden war.
Um über einige unwichtige Minuten vor dem Wichtigsten an meiner Geschichte hinwegzueilen, überschlage ich die Zeit bis zum Schlafengehen, während der ich immer glücklicher wurde bei Betrachtung all der Aussichten, die sich mir eröffneten, nämlich einer kinderleichten Arbeit unter so gütigen Menschen.
Nach dem Abendessen wurde ich zu Bett geschickt. Miss Phoebe, die einen gewissen Widerstand bei mir bemerkte, mich vor ihr zu entkleiden und in meinem Hemd hinzulegen, kam, sobald die Hausmagd hinausgegangen war, zu mir her und fing an, mein Brusttüchlein und mein Kleid zu lösen. Sie forderte mich auf, mich ruhig selbst auszuziehen. Ich errötete, als ich mich nackt bis aufs Hemd sah, und beeilte mich, unter die Bettdecke zu verschwinden. Phoebe lachte, und es dauerte nicht lange, bis sie sich neben mich legte. Sie mochte ungefähr fünfundzwanzig Jahre alt sein, wenigstens nach ihrer verdächtigen Rechnung, wobei allem Anschein nach so an die zehn Jährlein abgezogen worden waren. Ein Zugeständnis musste überdies der Verwüstung gemacht werden, die eine lange Abnützung und ungezählte Schändungen ihrem Aussehen zugefügt hatten. Sie befand sich bereits in jenem abgetakelten Zustand, der viele ihrer Berufsgenossinnen zwingt, zu guter Letzt nur noch Theater zu spielen anstatt es zu genießen.
Kaum hatte sich nun diese wertvolle Stütze meiner Herrin niedergelegt, als sie mich – denn nie irrte sie vom Weg ab, wenn er eine Gelegenheit zum Verlustieren bot – auch schon mit größtem Eifer umarmte und küsste. Das war mir neu und kam mir seltsam vor. Da ich jedoch nichts anderes darin sah als pure Freundschaftlichkeit, die sich meiner Meinung nach vielleicht in London auf solche Weise ausdrückte, beschloss ich, ihr in nichts nachzustehen, und erwiderte daher ihre Küsse und Umarmungen mit der ganzen Ungezwungenheit, wie sie für die vollkommene Naivität typisch ist.
Durch mein Verhalten ermutigt, befleißigten sich ihre Hände sogleich eines ungenierten Vorgehens; sie wanderten über meinen ganzen Körper, betasteten, streichelten, kosten ihn – ein Geschehen, das mich durch seine Neuartigkeit eher erwärmte und überraschte, als dass es mich betroffen gemacht oder erschreckt hätte.
Die schmeichlerischen Reden, mit denen sie solche Vorstöße begleitete, trugen auch nicht wenig dazu bei, mein Gewissen zu beruhigen; weil mir nichts Übles bekannt war, fürchtete ich auch nichts, besonders nicht von einer Seite, die mir über jeden Zweifel an ihrer Weiblichkeit erhaben schien dank eines Paars sehr gewichtiger Brüste; sie besaßen eine solche Größe und Fülle, dass sie mehr als genug ihre Geschlechtszugehörigkeit kennzeichneten, wenigstens für mich, da ich niemals einen anderweitigen Vergleich hatte ziehen können.
Ich lag also so zahm und geduldig da, wie sie es sich nur wünschen konnte, während ihre Berührungen keine anderen Gefühle in mir hervorriefen als die eines sonderbaren und noch nie erlebten Vergnügens. Mein ganzer Körper war dem zügellosen Treiben ihrer Hände ausgeliefert. Sie ließ sie wie ein züngelndes Feuer über ihn hingleiten, und unter ihrer Berührung schwand meine Zurückhaltung.