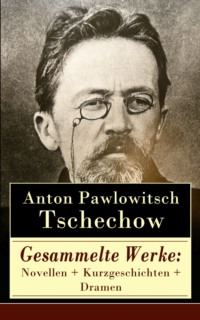Kitabı oku: «Gesammelte Werke: Novellen + Kurzgeschichten + Dramen», sayfa 3
V
Rettich war unpraktisch und verstand nicht zu rechnen; nahm viel mehr Arbeit, als er bewältigen konnte, bei der Abrechnung verlor er stets die Fassung und hatte daher fast immer Schaden. Er malte, setzte Scheiben ein, tapezierte und übernahm sogar Dachdeckerarbeiten, und ich kann mich noch erinnern, wie er manchmal wegen irgendeines ganz unbedeutenden Auftrages drei Tage lang auf der Suche nach Dachdeckern herumlief. Er war ein vorzüglicher Meister, verdiente zuweilen zehn Rubel am Tage, und wenn er nicht den Ehrgeiz hätte, unbedingt als Erster zu gelten und »Unternehmer« zu sein, so hätte er wahrscheinlich Geld gespart.
Er selbst arbeitete in Akkord und zahlte davon mir und den anderen Arbeitern siebzig Kopeken bis einen Rubel täglich. Solange es heiß und trocken war, machten wir allerlei Außenarbeiten und strichen hauptsächlich die Dächer. Ich war diese Arbeit nicht gewohnt, und meine Füße glühten, als ob ich auf einer heißen Herdplatte ginge; zog ich aber Filzstiefel an, so war es meinen Füßen wieder zu schwül. Das war aber nur in der ersten Zeit so; als ich mich gewöhnte, ging es wie geschmiert. Ich lebte jetzt unter Menschen, für die die Arbeit obligatorisch und unvermeidlich war und die wie die Lastpferde arbeiteten, oft ohne die sittliche Bedeutung der Arbeit einzusehen und selbst ohne das Wort »Arbeit« in ihren Gesprächen zu gebrauchen; in ihrer Nähe fühlte ich mich gleichfalls als ein Lastpferd, überzeugte mich immer mehr von der Notwendigkeit und Unvermeidlichkeit dessen, was ich tat, und das erleichterte mir das Leben und befreite mich von allen Zweifeln.
In der ersten Zeit interessierte mich alles, alles war mir neu, und ich fühlte mich wie neugeboren. Ich konnte auf der Erde schlafen, konnte barfuß gehen, was übrigens sehr angenehm ist; konnte, ohne jemand zu belästigen, in einem Haufen gemeinen Volkes stehen, und wenn auf der Straße ein Droschkenpferd fiel, kam ich gelaufen und half es aufheben, ohne Angst, meine Kleider zu beschmutzen. Vor allen Dingen lebte ich aber auf eigene Kosten und fiel niemand zur Last!
Das Anstreichen der Dächer, insbesondere wenn wir auch Firnis und Farbe beistellten, war ein recht einträgliches Geschäft, und selbst so gute Meister wie Rettich verachteten diese grobe und langweilige Arbeit nicht. In kurzer Hose, mit lila Beinen stolzierte er wie ein Storch auf dem Dache herum, und oft hörte ich ihn bei der Arbeit schwer seufzen und sagen:
»Wehe, wehe uns Sündern!«
Auf dem Dache spazierte er ebenso frei herum wie auf dem Fußboden. Obwohl er kränklich und blaß wie eine Leiche war, zeichnete er sich durch ungewöhnlicht Gewandtheit aus; wie die jüngsten Arbeiter malte er die Kirchenkuppeln ohne jedes Gerüst, nur mit Hilfe einer Leiter und eines Strickes, und es war ein wenig unheimlich, wenn er, in der Höhe über der Erde stehend, sich in seiner ganzen Länge ausstreckte und, man wußte nicht, zu wem, sagte:
»Die Läuse fressen das Gras, der Rost – das Eisen, und die Lüge – die Seele!«
Oder wenn er laut auf seine eigenen Gedanken antwortete:
»Alles ist möglich! Alles ist möglich!«
Wenn ich von der Arbeit heimging, riefen mir alle die Ladengehilfen, Lehrjungen und ihre Herren, die vor den Türen saßen, allerlei spöttische und boshafte Bemerkungen nach; in der ersten Zeit regte mich das auf und erschien mir ungeheuerlich.
»Kleiner Nutzen!« klang es von allen Seiten. »Pinsel! Ocker!«
Niemand behandelte mich aber so grausam wie gerade diejenigen, die erst vor kurzem einfache Arbeiter gewesen waren und sich ihr Brot durch schwere Arbeit verdient hatten. Als ich einmal auf dem Markte an einer Eisenhandlung vorbeiging, schüttete man auf mich wie zufällig einen Kübel Wasser aus; ein anderes Mal warf man nach mir mit einem Stock. Und einmal versperrte mir ein alter Fischhändler den Weg und sagte mit böser Stimme:
»Nicht du tust mir leid, Dummkopf: dein Vater tut mir leid!«
Meine Bekannten konnten aber bei der Begegnung mit mir ihre Verlegenheit kaum bemeistern. Die einen sahen mich als einen Sonderling und Hanswurst an, die anderen bemitleideten mich, die dritten aber wußten nicht, wie sie sich zu mir stellen sollten, und ich konnte sie nicht recht verstehen. Eines Tages begegnete ich in einer der Quergassen, in der Nähe unserer Großen Adelsstraße, Anjuta Blagowo. Ich ging zur Arbeit und trug zwei lange Pinsel und einen Eimer mit Farbe. Als Anjuta mich erkannte, bekam sie einen roten Kopf.
»Ich bitte Sie, mich auf der Straße nicht zu grüßen …« sagte sie nervös, unfreundlich, mit bebender Stimme, ohne mir die Hand zu reichen, und in ihren Augen blinkten plötzlich Tränen. »Wenn Sie das alles für notwendig halten, so bleiben Sie meinetwegen dabei … aber ich bitte Sie, begegnen Sie mir nicht!«
Ich wohnte nicht mehr in der Großen Adelsstraße, sondern in der Vorstadt Makaricha, bei meiner ehemaligen Kinderfrau Karpowna, einer gutmütigen, doch melancholischen Alten, die überall Unheil witterte, alle Träume fürchtete und selbst in den Bienen und Wespen, die manchmal in ihr Zimmer hineinflogen, üble Vorbedeutungen sah. Auch das, daß ich Arbeiter geworden war, verhieß ihrer Ansicht nach nichts Gutes.
»Verloren ist dein Kopf!« pflegte sie mit traurigem Kopfschütteln zu sagen: »Verloren ist er!«
Bei ihr wohnte ihr Pflegesohn, der Fleischer Prokofij, ein riesengroßer, plumper, rothaariger Geselle mit struppigem Schnurrbart. Wenn er mir im Hausflur begegnete, machte er mir stumm und ehrerbietig Platz; wenn er aber betrunken war, so salutierte er mir mit allen fünf Fingern. Wenn er beim Abendbrot saß, hörte ich durch den Bretterverschlag, wie er nach jedem Glase Schnaps seufzte und sich räusperte.
»Mama!« rief er mit dumpfer Stimme.
»Was ist denn?« antwortete Karpowna, die in ihren Pflegesohn verliebt war. »Was ist denn, Söhnchen?«
»Ich will Ihnen eine Gefälligkeit erweisen, Mama. In diesem irdischen Jammertal werde ich Sie bis ins hohe Alter ernähren, und wenn Sie sterben, werde ich Sie auf meine Kosten beerdigen«. Was ich versprochen habe, das halte ich auch.«
Ich stand jeden Morgen vor Sonnenaufgang auf und ging immer früh zu Bett. Wir Maler aßen sehr viel, schliefen gut, hatten aber nachts immer Herzklopfen. Mit meinen Kollegen zankte ich mich niemals. Flüche und Verwünschungen wie z. B. »Die Augen sollen dir zerspringen!« oder: »Daß dich die Cholera!« verstummten zwar für keinen Augenblick, aber wir lebten doch in gutem Einvernehmen. Die anderen Gesellen hielten mich für einen Sektierer und machten ihre gutmütigen Witze darüber; sie sagten, daß selbst mein leiblicher Vater sich von mir losgesagt hätte, gestanden aber gleich darauf, daß sie selbst fast niemals in die Kirche gingen und daß viele von ihnen seit zehn Jahren nicht mehr in der Beichte gewesen waren; dieses Verhalten rechtfertigten sie damit, daß der Maler unter den Menschen dasselbe sei, was eine Dohle unter den Vögeln.
Die Gesellen achteten mich und behandelten mich mit Ehrfurcht; anscheinend gefiel es ihnen, daß ich weder trank noch rauchte und ein stilles, ordentliches Leben führte. Es berührte sie nur unangenehm, daß ich mich nicht am Stehlen von Firnis beteiligte und auch nicht am Trinkgelderpressen von den Kunden. Das Stehlen von Firnis und Farbe war bei den Malern ein alter Brauch, und selbst ein so anständiger Mensch wie Rettich brachte von der Arbeit immer etwas Firnis und Bleiweiß mit. Um Trinkgeld bettelten aber sogar ehrwürdige alte Männer, die in der Vorstadt Makaricha eigene Häuser besaßen. Es war beschämend zu sehen, wie die Arbeiter irgendeiner Null zum Beginn oder zum Abschluß der Arbeit gratulierten und wie devot sie sich für ein Trinkgeld von zehn Kopeken bedankten.
Den Kunden gegenüber benahmen sie sich wie listige Höflinge, und ich mußte jeden Tag an den Shakespeareschen Polonius denken.
»Es wird wohl regnen,« sagte der Kunde, auf den Himmel blickend.
»Es wird ganz gewiß regnen!« bestätigten die Maler.
»Es sind übrigens keine Regenwolken. Vielleicht wird es auch nicht regnen.«
»Es wird nicht regnen, Euer Wohlgeboren. Ganz gewiß nicht.«
Hinter dem Rücken behandelten sie die Kunden im allgemeinen ironisch, und wenn sie z. B. einen Herrn mit einer Zeitung auf dem Balkon sitzen sahen, spotteten sie:
»Eine Zeitung liest er, aber zu fressen hat er nichts!«
Zu den Meinen ging ich nicht. Wenn ich von der Arbeit heimkam, fand ich bei mir oft kurze, besorgte Zettel von meiner Schwester vor, in denen sie mir vom Vater berichtete: daß er beim Mittagessen auffallend nachdenklich gewesen sei und nichts gegessen habe, oder daß er im Gehen eigentümlich gestolpert wäre, oder daß er sich für lange Zeit in seinem Zimmer eingeschlossen hätte. Solche Berichte regten mich auf und raubten mir den Schlaf; manchmal ging ich sogar nachts in die Große Adelsstraße vor unser Haus, starrte in die dunklen Fenster und suchte zu erraten, wie es im Hause wohl stehen möge. Meine Schwester besuchte mich heimlich jeden Sonntag, tat aber so, als käme sie nicht zu mir, sondern zu der Kinderfrau. Wenn sie zu mir ins Zimmer trat, war sie sehr blaß, hatte rote Augen und fing gleich zu weinen an:
»Unser Vater wird es nicht überleben!« sagte sie immer: »Wenn ihm, Gott behüte, etwas zustößt, so wird dich dein Leben lang dein Gewissen quälen. Es ist entsetzlich, Missail! Im Namen unserer Mutter flehe ich dich an: bessere dich!«
»Teure Schwester,« erwiderte ich, »wie soll ich mich bessern, wenn ich überzeugt bin, daß ich nach meinem Gewissen handle? Begreife es doch!«
»Ich weiß, daß du nach deinem Gewissen handelst, vielleicht ginge es aber doch irgendwie anders, so daß du niemand Kummer machst.«
»Lieber Gott!« stöhnte die Alte hinter der Tür: »Verloren ist dein Kopf! Schlecht wird es enden!«
VI
An einem Sonntag kam zu mir ganz unerwartet Doktor Blagowo. Er trug unter seiner Sommerlitewka ein blauseidenes Hemd und hatte Lackstiefel an.
»Ich komme zu Ihnen!« begann er, und drückte mir kräftig die Hand. »Jeden Tag höre ich von Ihnen und habe immer die Absicht, mich mit Ihnen auszusprechen. In der Stadt herrscht furchtbare Langweile, es ist keine lebendige Seele da, mit der man ein Wort reden könnte. Heiß ist es, heilige Mutter Gottes!« fuhr er fort, die Litewka ausziehend. »Liebster, lassen Sie mich mit Ihnen sprechen!«
Ich langweilte mich auch selbst und sehnte mich schon längst nach der Gesellschaft von Nichtmalern. Ich freute mich aufrichtig über seinen Besuch.
»Zuallererst will ich Ihnen sagen,« fing er an, sich auf mein Bett setzend, »daß ich mit ganzer Seele mit Ihnen fühle und Ihre ganze Lebensweise achte. Hier in der Stadt versteht man Sie nicht, es ist auch niemand da, der Sie verstehen könnte; Sie wissen wohl selbst, daß es hier mit wenigen Ausnahmen nur Gogolsche Schweineschnauzen gibt. Aber ich habe Sie schon damals beim Picknick gleich durchschaut. Sie sind eine edle Seele, ein ehrlicher Idealist. Ich achte Sie und halte es für eine große Ehre, Ihre Hand drücken zu können!« fuhr er begeistert fort. »Um das Leben so radikal zu verändern, wie Sie es getan, haben Sie einen komplizierten seelischen Prozeß durchmachen müssen, und um dieses Leben fortzuführen und immer auf der Höhe Ihrer Ueberzeugungen zu bleiben, arbeiten Sie wohl tagaus, tagein angestrengt mit Kopf und Herz. Sagen Sie mir nun gleich zu Beginn unserer Unterredung: finden Sie nicht, daß, wenn Sie diese ganze Willenskraft, diese ganze Anspannung und Potenz auf irgend etwas anderes verwendet hätten, z. B. um mit der Zeit ein großer Gelehrter oder Künstler zu werden, Ihr Leben auch viel tiefer und in allen Beziehungen produktiver geworden wäre?«
So begann unser Gespräch, und als die Rede auf die körperliche Arbeit kam, äußerte ich folgenden Gedanken: es sei in erster Linie notwendig, daß die Starken die Schwachen nicht knechten, daß die Minderheit für die Mehrheit nicht zu einem Parasiten werde, oder zu einer Pumpe, die aus ihr chronisch die besten Säfte aussauge; mit anderen Worten, es sei notwendig, daß alle ohne Ausnahme, die Starken wie die Schwachen, die Reichen wie die Armen gleichmäßig, ein jeder für sich, am Kampfe ums Dasein teilnehmen; in dieser Beziehung gäbe es kein besseres nivellierendes Mittel als die zu einer allgemeinen, für alle obligatorischen Pflicht erhobene körperliche Arbeit.
»Nach Ihrer Ansicht müssen sich also alle mit körperlicher Arbeit befassen?« fragte der Doktor.
»Ja.«
»Glauben Sie denn nicht, daß, wenn sich alle, auch die hervorragendsten Menschen, die größten Denker und Gelehrten, am Kampfe ums Dasein beteiligen und ihre Zeit zum Steineklopfen oder Dächeranstreichen verwenden, dem Fortschritte eine große Gefahr entstehen würde?«
»Worin soll denn diese Gefahr liegen?« fragte ich. »Der Fortschritt besteht ja in den Taten der Liebe, in der Erfüllung der sittlichen Pflicht. Wenn Sie niemand unterdrücken, wenn Sie niemand zur Last fallen, so ist das doch wahrlich ein großer Fortschritt!«
»Aber erlauben Sie einmal!« fuhr Blagowo plötzlich auf: »Erlauben Sie! Wenn die Schnecke sich in ihrem Schneckenhaus mit persönlicher Selbstvervollkommnung befaßt und im sittlichen Gesetz herumstochert, so nennen Sie das Fortschritt?«
»Warum sagen Sie herumstochert?« entgegnete ich beleidigt. »Wenn Sie Ihren Nächsten nicht zwingen, Sie zu ernähren, zu bekleiden, zu fahren, vor Ihren Feinden zu beschützen, so bedeutet denn das im Leben, das ganz auf Knechtschaft aufgebaut ist, keinen Fortschritt? Meines Erachtens ist das der echteste und wohl der für den Menschen einzig mögliche und notwendige Fortschritt.«
»Die Grenzen des allmenschlichen, weltumfassenden Fortschritts liegen in der Unendlichkeit, und von einem ›möglichen‹ von unseren Nöten und zeitlichen Anschauungen beschränkten Fortschritt zu sprechen, finde ich, entschuldigen Sie mich, sonderbar.«
»Wenn die Grenzen des Fortschritts, wie Sie sagen, in der Unendlichkeit liegen, so sind seine Ziele unbestimmt,« entgegnete ich ihm. »Wie kann man leben, ohne zu wissen, wozu man lebt!«
»Gut! Aber dieses Nichtwissen ist weniger langweilig als Ihr Wissen. Ich steige eine Leiter hinauf, die man Fortschritt, Zivilisation, Kultur nennt, ich steige immer höher, ich weiß zwar nicht bestimmt, wohin sie mich führt, aber diese herrliche Leiter macht mir schon allem das Leben lebenswert; Sie aber wissen, wozu Sie leben: damit die einen die anderen nicht unterdrücken, damit der Künstler und derjenige, der ihm die Farben reibt, das gleiche Mittagbrot essen. Das ist aber die spießbürgerliche, prosaische, graue Seite des Lebens, und für sie zu leben, ist einfach ekelhaft. Wenn die einen Insekten die anderen unterjochen, so hol sie der Teufel! Sollen sie einander fressen! Nicht an diese Geschöpfe müssen wir denken – sie werden ja sowieso, und wenn Sie sie auch von der Sklaverei retten, sterben und verfaulen; sondern, an das große X, das die Menschheit in der Zukunft erwartet.«
Blagowo widersprach mir mit großem Eifer, ich konnte ihm aber anseben, daß ihn irgendein ganz anderer Gedanke beschäftigte.
»Ihre Schwester wird wohl nicht kommen,« sagte er nach einem Blick auf die Uhr. »Gestern war sie bei uns und sagte, daß sie heute zu Ihnen kommt. Sie sprechen immer von Sklaverei …« fuhr er fort. »Das ist aber nur eine Teilfrage, und alle solche Fragen werden von der Menschheit allmählich, ganz von selbst gelöst.«
Nun kamen wir auf die allmähliche Entwicklung zu sprechen. Ich sagte, daß die Frage, ob gut oder böse zu handeln sei, jeder Mensch für sich lösen müsse, ohne erst abzuwarten, daß die Menschheit zur Lösung dieser Frage auf dem Wege der allgemeinen Entwicklung gelange. Außerdem sei diese allmähliche Entwicklung ein zweischneidiges Schwert. Neben dem Prozesse der Entwicklung der humanen Ideen könne man auch die allmähliche Entwicklung von Ideen ganz anderer Art beobachten. Die Leibeigenschaft sei abgeschafft, dafür aber wachse der Kapitalismus immer an. Und selbst in der Zeit, wo die freiheitlichen Ideen in höchster Blüte stehen, müsse die Mehrheit ebenso wie in den Tagen des Tatarenjochs die Minderheit ernähren, kleiden und verteidigen und bleibe dabei selbst hungrig, nackt und schutzlos. Eine solche Ordnung könne sich mit beliebigen ideellen Strömungen sehr gut vertragen, denn auch die Kunst der Knechtung werde allmählich kultivierter. Wir züchtigen nicht mehr unsere Lakaien mit Ruten, aber wir verleihen der Sklaverei raffinierte Formen; jedenfalls verstehen wir es, sie in jedem Einzelfalle zu rechtfertigen. Wir halten alle die Ideen in großen Ehren, aber wenn wir jetzt im Ausgange des neunzehnten Iahrhunderts die Möglichkeit hätten, auf die Arbeiter auch unsere unangenehmsten physiologischen Verrichtungen abzuwälzen, so täten wir es und sagten dann zu unserer Rechtfertigung, daß, wenn die besten Menschen, die größten Denker und Gelehrten ihre goldene Zeit auf diese Verrichtungen verlieren würden, dem Fortschritte eine große Gefahr drohte.
Da kam aber schon meine Schwester. Als sie bei mir den Doktor erblickte, wurde sie gleich sehr unruhig und erklärte, sie müsse heim zum Vater.
»Kleopatra Alexejewna,« sagte ihr Blagowo sehr eindringlich, beide Hände ans Herz drückend: »was kann Ihrem Herrn Vater passieren, wenn Sie mit Ihrem Bruder und mir eine halbe Stunde verbringen?«
Er gab sich recht natürlich und verstand seine Lebhaftigkeit auch den andern mitzuteilen. Meine Schwester dachte eine Weile nach, wurde dann auf einmal wie damals beim Picknick lustig und fing zu lachen an. Wir gingen ins Freie, legten uns ins Gras, setzten unser Gespräch fort und blickten auf die Stadt, wo alle nach dem Westen gerichteten Fenster, in denen sich die untergehende Sonne spiegelte, wie golden aussahen.
So oft von nun an meine Schwester mich besuchte, kam sofort auch Doktor Blagowo, und sie stellten sich bei der Begrüßung so, als sei ihre Begegnung bei mir eine ganz zufällige. Meine Schwester hörte unseren Debatten mit einem andächtigen, entzückten und forschenden Gesichtsausdruck zu, und mir schien es, als ginge ihr allmählich eine ganz neue Welt auf, die sie bisher nicht mal im Traume gesehen hatte und die sie jetzt zu ergründen suchte. Kam der Doktor einmal nicht, so war sie still und traurig, und wenn es vorkam, daß sie, auf meinem Bette sitzend, weinte, so weinte sie aus persönlichen Gründen, von denen sie mir nichts erzählte.
Im August sagte uns Rettich, wir sollten uns auf die »Strancke« begeben. Zwei Tage, bevor wir aufbrachen, kam plötzlich mein Vater zu mir. Er setzte sich ohne Eile, wischte sich, ohne mich anzusehen, sein rotes Gesicht ab, holte dann aus der Tasche unseren »Stadtboten« und las mir langsam, jedes Wort betonend, die Nachricht vor, daß mein Altersgenosse, der Sohn des Reichsbankdirektors zum Abteilungschef am Rentamte ernannt worden sei.
»Und nun sieh dich an,« sagte er, die Zeitung wieder zusammenlegend: »du bist ein Bettler, ein Lump und ein Taugenichts! Selbst Leute aus dem Bauern- und Kleinbürgerstande streben nach Bildung, um irgend etwas zu werden, aber du, ein Polosnjew, du strebst nach dem Schmutz! Ich bin aber nicht hergekommen, um mich mit dir zu unterhalten. Dich habe ich schon aufgegeben,« fuhr er mit erstickter Stimme fort und stand auf. »Ich bin gekommen, um dich zu fragen, wo deine Schwester ist, du Taugenichts! Sie ist gleich nach dem Mittagessen vom Hause weggegangen, und nun ist es bald acht, und sie ist noch immer nicht da. Sie geht jetzt oft aus dem Hause, ohne mir davon auch nur ein Wort zu sagen, und ist viel weniger ehrerbietig als früher. Ich sehe darin deinen schlechten, gemeinen Einfluß. Wo ist sie?«
Er hielt den mir wohlbekannten Regenschirm in der Hand, und ich stand schon stramm wie ein Schuljunge, in der Erwartung, daß er mich wieder schlagen würde. Er bemerkte aber meinen Blick auf den Regenschirm, und das hielt ihn wahrscheinlich ab.
»Lebe wie du willst!« sagte er. »Ich nehme meinen Segen von dir.«
»Gott im Himmel!« murmelte die Kinderfrau hinter der Tür: »Dein armer, unglücklicher Kopf! Mein Herz ahnt Unheil!«
Ich arbeitete auf der Strecke. Den ganzen August regnete es und war es kalt und feucht. Das Getreide blieb auf den Feldern liegen, und auf den großen Gütern, wo man mit Maschinen mähte, lag der Weizen nicht in Schobern, sondern in Haufen, und ich erinnere mich noch, wie diese traurigen Haufen von Tag zu Tag dunkler wurden und der Weizen verdarb. Das Arbeiten fiel uns sehr schwer, weil die Regengüsse alles verdarben, was wir fertig machten. In den Stationsgebäuden zu wohnen und zu schlafen war uns verboten, und wir hausten in den schmutzigen, feuchten Erdhütten, in denen im Sommer die bewußten »Eisenbahner« gewohnt hatten. Nachts konnte ich vor Kälte nicht schlafen, und auch weil mir über Gesicht und Hände die Asseln liefen. Wenn wir aber an den Brücken arbeiteten, kamen die »Eisenbahner« Abend für Abend in ganzen Scharen, um die Maler zu verhauen: das war für sie eine Art Sport. Sie schlugen uns, stahlen uns die Pinsel und verdarben, um uns zum Streite zu provozieren, unsere Arbeit, indem sie z. B. die Wärterhäuschen mit grüner Farbe anstrichen. Um den Kelch unserer Leiden voll zu machen, fing Rettich an, uns sehr unpünktlich zu entlohnen. Alle Malerarbeiten in diesem Revier waren an einen Unternehmer vergeben worden; dieser hatte sie von sich aus einem andern übergeben, und dieser andere gab sie Rettich, wobei er sich zwanzig Prozent ausbedang. Die Arbeit war schon an sich wenig lohnend, und da kamen auch noch die Regengüsse hinzu; die Zeit verging unnütz, wir taten nichts, Rettich war aber verpflichtet, seine Arbeiter für den Tag zu bezahlen. Die hungrigen Maler drohten ihn zu verprügeln, nannten ihn einen Gauner, einen Blutsauger, einen Judas, er aber seufzte nur, hob die Hände verzweifelt zum Himmel und ging alle paar Tage zur Frau Tscheprakowa, um sich Geld zu leihen.