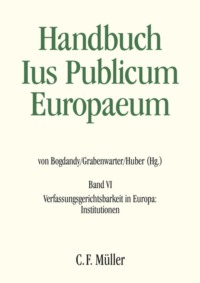Kitabı oku: «Ius Publicum Europaeum», sayfa 29
91
Aber trotz der Anstrengungen der Verfassungslehre, die Rationalität der gerichtlichen Entscheidungsfindung zu erhöhen, gibt es überzeugende Gründe zu glauben, dass die Rechtsprechung ein hartnäckiges Element des Dezisionismus enthält. In einem gefestigten demokratischen Rechtsstaat jedoch wird dieses Element durch einen fortwährenden rechtlichen und öffentlichen Diskurs abgemildert, der die Verfassungsrechtsprechung umgibt und in dem die Gründe der Einzelentscheidungen bewertet werden.
92
Während der Lochner-Ära in den Vereinigten Staaten griffen Kritiker – viele von ihnen Rechtsrealisten oder deren Vorläufer – die verdeckte policy-Gestaltung der Gerichte unter dem Gesichtspunkt konzeptioneller und deduktivistischer Verschleierung an. Nach dem Zweiten Weltkrieg, mit der Verlagerung des Schwerpunkts der Verfassungsrechtsprechung von Wirtschaftsrechten zu Bürgerrechten, veränderte sich auch der Fokus der Kritik. In seiner Beweisführung gegen die gerichtliche Kontrolle neigt Waldron zu legislativen Kontroversen, die eine klare ethische oder moralische Natur besitzen, wie denjenigen bezüglich der Abtreibung, und in welcher der policy-Aspekt, d.h. die instrumentalistische Dimension der praktischen Vernunft, eine untergeordnete Rolle spielt; auf dem Spiel steht das, was man als eine auf Rechte fokussierte Gesetzgebung bezeichnen mag. Wenn ein Gericht ein solches Gesetz für unwirksam erklärt, macht es nicht die policy-Entscheidungen des Gesetzgebers unwirksam, sondern eher seine ethischen und moralischen Standpunkte. Falls der Gesetzgebungsprozess bereits ethische und moralische, auf Rechte bezogene Überlegungen enthielt und falls die Legislative ihre Entscheidung auf solche Erwägungen ausdrücklich stützt, rechtfertigt das Argument der Verfassungskontrolle als ultima ratio ein Eingreifen des Gerichts demnach nicht.
93
Abtreibungsfälle mögen die am heißesten diskutierten Fälle der Verfassungskontrolle sein, aber sie als paradigmatische Beispiele heranzuziehen, könnte unklug sein. Die meisten gesetzgeberischen Projekte sind auf policy-Zwecke ausgerichtet und verfolgen wirtschaftliche oder soziale Programme, Sicherheitsziele und so weiter. In Standardfällen ist das gesetzgeberische Motiv hauptsächlich pragmatischer Natur, bei dem auf Rechte bezogene moralische und ethische Überlegungen, wenn überhaupt, nur als Nebenbedingungen eine Rolle spielen; die Beziehung von pragmatischen zu ethischen und moralischen Aspekten ist genau entgegengesetzt zu deren jeweiliger Bedeutsamkeit im Abtreibungsgesetz. Und auf solche Standardfälle zielt das Argument der ultima ratio: Die Grundrechtsfrage könnte während der Gesetzgebungsphase unbeachtet geblieben sein und erst in der Phase der Anwendung entdeckt werden. In Finnland war dies ein zentrales Argument für die Einführung gerichtlicher ex post-Kontrolle und für die Ermächtigung der Gerichte, Bestimmungen in einem Gesetz auszusetzen, das eine ex ante-Kontrolle durch den Grundgesetzausschuss schon durchlaufen hat. In den travaux préparatoires für die Verfassung des Jahres 2000 wurde der Punkt wie folgt formuliert: „Im (Grundgesetz-) ausschuss wird die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen auf einem allgemeinen Niveau, in abstracto, untersucht, während ein Gericht die Angelegenheit im Zusammenhang eines konkreten Falles bewertet. Daher ist es möglich, dass ein Gericht einen Widerspruch entdeckt, den der Ausschuss überhaupt nicht angesprochen hat. In einer solchen Lage kann das Erfordernis eines offensichtlichen Konflikts ausnahmsweise vorliegen, obwohl das Gesetz die Kontrolle des Grundgesetzausschusses durchlaufen hat.“[61]
Die Bedenken hinsichtlich der Politisierung der Rechtsprechung sind berechtigt; sie warnen die Verfassungskontrolle davor, ihre legitimen Grenzen zu überschreiten und die ausdrücklichen Politikentscheidungen oder Wertentscheidungen des Gesetzgebers nicht umzukehren. Sie führen allerdings keinen tödlichen Streich gegen die rechtfertigbare gerichtliche Kontrolle, sondern dienen lediglich als Erinnerung an deren Grenzen. Ebenso relevant ist die Gefahr einer Vergerichtlichung der Politik, welche aus einer übermäßig „dichten“ Interpretation der Verfassung entstehen kann. Versuche, die verschiedenen policy- oder Wertentscheidungen in der Verfassungsauslegung zu verankern, neigen dazu, die Freiheit der demokratischen politischen Erwägung und Entscheidungsfindung zu beschränken. Man sollte sich auch der Gefahren einer verknöcherten Verfassungslehre gegenwärtig sein. Trotzdem sollte die Kritik der Rechtsrealisten oder das Vergerichtlichungsargument von Waldron nicht die positive Rolle verschleiern dürfen, die die Verfassungslehre bei der Sicherstellung der Konsistenz und Kontrollierbarkeit der Verfassungsrechtsprechung spielt. Im Verfassungsrecht bedarf es, genauso wie in anderen Rechtsgebieten, allgemeiner Lehren; diese sollten aber nicht zu ideologischen Konstrukten versteinern dürfen, die die Wahrnehmung relevanter Angelegenheiten eher behindern denn erleichtern.
94
Alles in allem bin ich, selbst auf einer allgemeinen Diskussionsebene, nicht von Waldrons Argumenten gegen die gerichtliche Kontrolle der Gesetzgebung überzeugt. Er deutet auf Überlegungen hin, die in der Untersuchung alternativer Modelle der Verfassungskontrolle wichtig sind, aber er greift nicht wirklich ihre grundlegende Rechtfertigung als ultima ratio-Hüter der Gesetzesgrenzen an. Ein solcher Hüter ist selbst in einer Gesellschaft notwendig, die Waldrons vier Annahmen entspricht und die ungefähr dem gleichkommt, was man als etablierte Demokratie bezeichnen kann. Die Nichtbeachtung von Grundrechtsfragen während der Gesetzgebungsphase ist selbst in etablierten Demokratien, zu denen ich auch Finnland zählen würde, möglich. Und falls die Annahmen überhaupt nicht zutreffen, was immer noch großenteils etwa in den neuen Demokratien Zentral- und Osteuropas der Fall zu sein scheint, sind solche Misserfolge noch wahrscheinlicher.[62]
95
Oft genug verlässt sich die auf einer allgemeinen Ebene geführte Diskussion über die Verfassungskontrolle auf die Dichotomie von gerichtlichem und gesetzgeberischem Vorrang, wobei ersterer eine starke Verfassungskontrolle impliziert, die von einer gerichtlichen Institution durchgeführt wird. Das gilt auch für Waldrons Hauptargument. Seine Argumente sind durchaus von Bedeutung, jedoch ist deren Gültigkeit abhängig von der institutionellen Ausgestaltung des untersuchten Systems und der Ausgestaltung seiner dogmatischen Lehren. Dies ist ein zusätzlicher Grund, um die Überzeugungskraft von Waldrons Position zu hinterfragen: Selbst aus institutioneller Sicht und aus der Sicht der dogmatischen Lehren ruht sein angeblich allgemeines Argumentationsgerüst gegen die Verfassungskontrolle auf Annahmen, die keine allgemeine Gültigkeit besitzen. In institutioneller Hinsicht besteht ein allgemeines Merkmal in hybriden Modellen der Verfassungskontrolle, wie etwa dem New Commonwealth Model oder dem finnischen Modell, daraus, ein parlamentarisches Element einzuführen und so zu versuchen, die Spannung zwischen gerichtlicher Kontrolle und Demokratie zu regeln und der Tendenz der Vergerichtlichung entgegen zu wirken. Aus Sicht der dogmatischen Lehre können Doktrinen Gerichte zu richterlicher Selbstbeschränkung veranlassen und zu einem Verständnis der gerichtlichen Kontrolle als ultima ratio beitragen. In Finnland spielt das Erfordernis eines offensichtlichen Konflikts, das in Art. 106 der Verfassung niedergelegt ist, sowohl in institutioneller Hinsicht als auch in den dogmatischen Lehren eine entscheidende Rolle.
96
In institutioneller Hinsicht unterwirft das Kriterium des offensichtlichen Konflikts die gerichtliche ex post-Überwachung der Gesetzgebung der parlamentarischen ex ante-Kontrolle. Falls die Verfassungsfrage während der Gesetzgebungsphase ausdrücklich angesprochen wurde und der Grundgesetzausschuss einen expliziten Standpunkt dazu eingenommen hat, hält das Kriterium des offensichtlichen Konflikts in der Regel ein Gericht davon ab, die Entscheidung des Ausschusses umzukehren. Dies ist nicht nur eine Interpretation von vielen bezüglich des Art. 106, sondern eine anerkannte Voraussetzung, die von den Gerichten ebenfalls akzeptiert wird. Im Grundsatz kann die gerichtliche Kontrolle nur dann eintreten, wenn die Verfassungsfrage aus dem einen oder anderen Grund in der Gesetzgebungsphase übersehen wurde. Außerdem birgt das Erfordernis des offensichtlichen Konflikts – in Übereinstimmung mit der epistemologischen oder der quantitativen Auslegung – eine allgemeine Mahnung zu richterlicher Zurückhaltung. Es errichtet auch Hindernisse für eine extensive Anwendung bestimmter Doktrinen, die aus Deutschland importiert wurden, und verstärkt zumindest potentiell den Status der Gerichte gegenüber der Legislative. Ich werde auf diese Bedeutungen des Erfordernisses des offensichtlichen Konflikts zurückkommen.
§ 98 Verfassungsgerichtsbarkeit in Finnland › III. Aspekte der Evaluierung › 2. Zeichen der Vergerichtlichung
2. Zeichen der Vergerichtlichung
97
Wohl ist das finnische Modell nicht so anfällig für das Demokratieargument wie Modelle der gerichtlichen Kontrolle ohne modifizierende parlamentarische Elemente. Im Hinblick auf den anderen wesentlichen Kritikpunkt finden sich aber auch im finnischen Modell, das die Rolle der abstrakten ex ante-Kontrolle betont, Zeichen einer Vergerichtlichung der Politik. Immerhin repräsentiert der Grundgesetzausschuss ein quasi-gerichtliches Element innerhalb der Legislative und seine gesteigerte Bedeutung kann zu einer gewissen Vergerichtlichung der gesetzgebenden Politik führen. Falls der Ausschuss das Oberhaupt des Reiches des Verfassungsrechts in Finnland ist, stellen nicht die parlamentarischen Mitglieder des Ausschusses die Prinzen dar, sondern eher die Experten, die der Ausschuss hinzuzieht: vorwiegend Juraprofessoren. Präzedenzfälle und Lehre spielen eine wichtige Rolle in der Praxis des Ausschusses, wie auch in der gerichtlichen Verfassungskontrolle in anderen Systemen, obwohl diese nicht Erkenntnisse von Richtern, sondern von Verfassungsrechtlern sind. Dennoch würde ich wagen zu behaupten, dass ausdrückliche Entwicklungen in der Dogmatik, die soziale und kulturelle Entwicklungen widerspiegeln, leichter in einem System zu erreichen sind, in dem eine parlamentarische Körperschaft die letzte formale Entscheidung trifft.
98
In den Regierungsvorschlägen, die dem Parlament in Finnland unterbreitet werden, nehmen die Bezüge auf verfassungsrechtliche Grundrechtsbestimmungen zu. Dies spiegelt das erhöhte Bewusstsein für Grundrechte in der rechtlichen und politischen Kultur wider und kann, dementsprechend, grundsätzlich als positives Phänomen angesehen werden. Trotzdem sollte man sich auch der Gefahren bewusst sein, die in dieser Entwicklung angelegt sind: nämlich die Vergerichtlichung und die ungerechtfertigten Beschränkungen der Möglichkeiten der demokratischen Legislative.
99
Die Verfassungskontrolle in Ländern wie Finnland schließt alle großen rechtlichen Akteure des modernen Rechts mit ein: nicht nur die Legislative und die Gerichte, sondern auch die Wissenschaftler. In Übereinstimmung mit ihrer Rolle in anderen Rechtsbereichen tragen Wissenschaftler zur Artikulierung und Ausgestaltung der Verfassungslehre durch ihre Konzepte, Prinzipien und Theorien bei. Und wie auch in anderen Rechtsbereichen erfüllt die Lehre eine wichtige Aufgabe bei der Sicherung der Konsistenz der Verfassungsrechtsanwendung und bei der Förderung der normativen Kohärenz. In Finnland hat sich der wissenschaftliche Diskurs, dank des Bruches in der Verfassungskultur in den letzten Jahrzehnten, im Verfassungsrecht verstärkt und neue Beteiligte aufgenommen. Die finnische Staatsrechtslehre war seit jeher international ausgerichtet, wobei insbesondere die deutsche Lehre traditionell großen Einfluss hatte. Ein auffallendes Merkmal in der neueren Verfassungslehre war die Erweiterung internationaler Inspirationsquellen. Die deutsche Lehre ist zwar immer noch wichtig, aber der Prozess der Europäisierung hat Verfassungsrechtler dazu verleitet, sich auch anderswo in Europa umzuschauen. Zusätzlich nehmen auch die Kenntnisse des US-Rechts zu, insbesondere in der jüngeren Generation der Verfassungsrechtler.
100
Das Verfassungsrecht sollte, wie durch die Kritik an der Verfassungskontrolle in Erinnerung gebracht, besonders auf die Gefahren einer exzessiven Abhängigkeit von der Lehre achten. Die Lehre sollte nicht versteinern, sondern sollte für eine ständige (Wieder)bewertung in einem fortwährenden Verfassungsdiskurs offen sein und dabei soziale, kulturelle und politische Veränderungen gebührend beachten: Weder die verfassungsrechtlichen Probleme noch die verfassungsrechtlichen Lösungen einer spätmodernen Post-Wohlfahrtsstaatsgesellschaft ähneln denen einer vergangenen Ära. Insbesondere in einem System wie dem finnischen, in dem die Akademiker sehr wichtige Akteure in der Verfassungskontrolle sind, trägt die Wissenschaft eine zentrale Verantwortung dafür, ein angemessenes Gleichgewicht zwischen Stabilität und Erneuerung in der Verfassungslehre zu pflegen. Sie sollte auch die Gefahren einer Vergerichtlichung im Auge behalten: Dogmatische Konzepte und Theorien werden benötigt, aber sie sollten den verfassungsrechtlichen Diskurs nicht für die Akteure der Zivilgesellschaft unzugänglich machen. Eine demokratische Prüfung der Verfassungskontrolle durch öffentliche Debatten hat hohe Priorität, wenn man die Vergerichtlichung vermeiden und die Spannung zwischen Verfassungskontrolle und Demokratie bewältigen will. In dieser Hinsicht bleibt in Finnland viel zu tun: Verfassungsangelegenheiten, die vor dem Grundgesetzausschuss anhängig sind oder schon entschieden wurden, werden nicht sonderlich oft in den Medien erörtert. Ein Grund dafür ist, dass Wissenschaftler, die vom Ausschuss hinzugezogen wurden, sich im Allgemeinen verpflichtet zu fühlen scheinen, die Sache in der Öffentlichkeit nicht zu kommentieren.
101
In kritischen Untersuchungen der Vergerichtlichung wird die Rechtswissenschaft oft als Verbündete der Judikative abgestempelt, die der Letzteren hilft, ihre Macht auf Kosten der Legislative auszudehnen[63] und auch ihre eigenen strategischen Interessen auf dem Gebiet des Rechts zu verfolgen. Jedoch ist es leicht, Gegenbeispiele zu finden, die beweisen, dass eine solche Symbiose zwischen oder Zusammenarbeit von Rechtswissenschaft und Judikative ein zufälliges Phänomen ist und dass Erstere auch einen kritischen Standpunkt gegenüber Letzterer einnehmen kann. In Finnland gibt es keine Anzeichen einer solchen Allianz zwischen Richtern und Wissenschaftlern; vielmehr finden Wissenschaftler ihren Platz in möglichen institutionellen Konflikten zwischen Gerichten und dem Parlament höchst selbstverständlich auf Seite des Letzteren. In der Tat war die allgemeine Haltung der Verfassungsrechtler gegenüber der gerichtlichen ex post-Kontrolle häufig kritisch. Und tatsächlich ist ein wachsames Auge auf die gerichtliche Kontrolle von Seiten der Wissenschaftler nötig, um die Grenzen der rechtfertigbaren Verfassungskontrolle zur Geltung zu bringen.
102
Unabhängige Wissenschaft ist für das Verfassungsrecht vielleicht wichtiger als für jedes andere Rechtsgebiet. Aber besondere Umstände wirken gegen die wissenschaftliche Unabhängigkeit. Verfassungsrechtsprofessoren bilden typischerweise eine einflussreiche Gruppe von Richtern am Verfassungsgericht und sind auch als Berater und Experten aktiv an der Verfassungskontrolle beteiligt. In Finnland sind Wissenschaftler als Experten tief in die Arbeit des Grundgesetzausschusses eingebunden. Unter diesen Umständen besteht die Gefahr einer Kooptation unmittelbar. Die finnische Verfassungsrechtslehre kann möglicherweise für exzessiven Respekt gegenüber dem Grundgesetzausschuss getadelt werden: Es ist schwierig, eine kritische Distanz zu einer Lehre und den entsprechenden Entscheidungen zu bewahren, zu denen man selbst beigetragen hat.
§ 98 Verfassungsgerichtsbarkeit in Finnland › III. Aspekte der Evaluierung › 3. Die Rolle der deutschen Lehre
3. Die Rolle der deutschen Lehre
103
Die Folgen der Verfassungskontrolle für die Vergerichtlichung der Politik zeigen sich auch in den verfassungsrechtlichen Lehren und anderen Elementen der Verfassungskultur. Oft genug werden diese Elemente anhand der Alternativen des richterlichen Aktivismus und der richterlichen Selbstbeschränkung besprochen. Wie die Erfahrung der Vereinigten Staaten zeigt, können sich Phasen der Selbstbeschränkung und des Aktivismus abwechseln: Dies stimmt u.a. überein mit der Resonanz, die Gegner der Verfassungskontrolle in der rechtlichen und politischen Kultur finden. Viel mag auch von kulturellen und soziologischen Vorbedingungen eines demokratischen Rechtsstaats abhängen, wie die aktivistischen Verfassungsgerichte in Zentral- und Osteuropa zeigen. Der Aktivismus des EuGH – des „Verfassungsgerichts“ der EU – für seinen Teil war eindeutig mit den Schwierigkeiten bei der transnationalen politischen Entscheidungsfindung und den besonderen Erfordernissen, eine völlig neue Rechtsordnung zu schaffen, verknüpft.[64]
104
Auch der in der Verfassungsrechtsprechung vorhandene dogmatische Apparat beeinflusst den Grad der richterlichen Selbstbeschränkung bzw. des richterlichen Aktivismus. Selbst ausdrückliche Verfassungsbestimmungen können eine Rolle spielen, wie etwa das Erfordernis eines offensichtlichen Konflikts, das sowohl in der finnischen – wie auch in der schwedischen – Verfassung ausdrücklich genannt wird: Dieses Erfordernis hat das Anliegen von richterlicher Selbstbeschränkung positiviert. Es gibt auch speziellere Lehren, welche die Verfassungsrechtsprechung auffordern, gegenüber den politischen Bereichen des Staates institutionelle Zurückhaltung zu zeigen, wie etwa die political question-Doktrin der Vereinigten Staaten, die beispielsweise die Entscheidungsfindung bezüglich der Außenpolitik großenteils von gerichtlicher Einmischung abgeschirmt hat, oder die margin-of-appreciation-Doktrin (Lehre vom Beurteilungsspielraum), die als Instrument dient, damit der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Bewertung der Umstände durch nationale Staatsbehörden, welche Beschränkungen der Konventionsrechte rechtfertigen, nicht anzweifelt. Aber natürlich gibt es auch Lehren, die richterlichen Aktivismus rechtfertigen und die deshalb kritisiert wurden. In der deutschen Kritik des verfassungsgerichtlichen Jurisdiktionsstaates wurde vielfach der Lehre von den Grundrechtsnormen als Rechtsprinzipien mit weitem Anwendungsbereich, der Lehre von der Drittwirkung von Grundrechten und der Lehre von der Schutzpflicht des Staates die Schuld gegeben. Diese Lehren haben eine klare Wirkung auf die travaux préparatoires der finnischen Grundrechtsreform von 1995 hinterlassen und die Verfassung hat sogar die Schutzpflicht in einer ausdrücklichen Norm geregelt (Art. 22). Aber wie ich im Folgenden argumentieren werde, bremst das Erfordernis des offensichtlichen Konflikts die Vergerichtlichung, die diese Lehren vielleicht sonst bewirken würden.
a) Ausdehnung der Freiheitsrechte
105
Nach dem üblichen Verständnis sind Grundrechte subjektive Rechte, die private Individuen vor der willkürlichen Gewaltausübung durch den Staat und andere öffentliche Behörden schützen. Diese Anschauung bezieht sich auf das traditionelle Verständnis der Gewaltbegrenzung durch den Rechtsstaat. Die Drittwirkung (oder Horizontalwirkung) dehnt die Schutzfunktion der Freiheitsrechte auf Machtbeziehungen aus, in denen beide Parteien private Personen darstellen. Eine solche Ausdehnung erscheint begründet im Lichte der oft künstlichen und sogar porösen Grenze zwischen dem Öffentlichen und dem Privaten. Je weiter private Beziehungen sich von den Prinzipien der Freiheit und Gleichheit entfernen, welche die ideologische Basis des Privatrechts ausmachen, desto mehr Elemente übernehmen sie, die für das öffentliche Recht typisch sind und desto berechtigter ist es, sie in den Anwendungsbereich der verfassungsrechtlichen Freiheitsrechte aufzunehmen.[65]
106
Die kürzliche Privatisierungswelle hat der Drittwirkung der Grundrechte, verstanden als subjektive Abwehrrechte, eine neue Bedeutung und eine neue Rechtfertigung verliehen. Falls Verwaltungsaufgaben privatisiert werden, sollte die Schutzfunktion der Grundrechte auch „privatisiert“ werden, d.h. in ihrer Anwendung auf die empfangende Privatorganisation ausgedehnt. Eine Neuerung der finnischen Verfassung aus dem Jahre 2000 ist es, für solche Privatisierungen vorzusorgen. Art. 124 bestimmt, dass, wenn Aufgaben der öffentlichen Verwaltung an andere als öffentliche Behörden delegiert werden, man durch Gesetz sicherstellen muss, dass die Grundrechte, der Rechtsschutz und andere Erfordernisse einer guten Verwaltung nicht gefährdet werden. Wenn Aufgaben der öffentlichen Verwaltung unter Art. 124 auf Funktionseinheiten der sogenannten indirekten öffentlichen Verwaltung übertragen werden, gliedert man diese Funktionseinheiten in die öffentlichen Behörden ein, die durch die Grundrechtsbestimmungen unmittelbar gebunden sind.
107
Alles in allem ist es vernünftig, den Freiheitsrechten eine horizontale Wirkung in hierarchisch strukturierten Beziehungen zuzubilligen. Dennoch ist es, zumindest in kontinentaleuropäischen Zivilrechtsländern wie Finnland, auch gerechtfertigt zu fragen, wer berechtigt sein sollte, über eine solche Ausdehnung der Reichweite der Grundrechte zu entscheiden: die Legislative oder die Gerichte? Man kann behaupten, dass es hauptsächlich Sache der Legislative und nicht der Gerichte sei zu bewerten, welche Arten der privaten Beziehungen den verfassungsrechtlichen Freiheitsrechten unterfallen sollten. Beschreibt man die öffentlichen Behörden, die unmittelbar durch Grundrechtsnormen gebunden sind, existieren recht genaue formal-organisatorische Kriterien. Im Gegensatz dazu sind bei der Beschreibung der Reichweite der Horizontalwirkung der subjektiven Freiheitsrechte keine solchen formalen Kriterien zur Hand; hierfür bedarf es einer grundlegenden Überlegung und die Gesetzgebung ist dafür vielleicht besser geeignet als die Gerichte.
108
Im finnischen System vertrete ich die Auffassung, dass die Gerichte in der Regel nicht ihre Kontrollmacht nach Art. 106 anwenden, um einem Freiheitsrecht eine unmittelbare horizontale Wirkung zu gewähren. Angesichts der Zweideutigkeit der Horizontalwirkung ist es zweifelhaft, dass man ein einfaches Gesetz für in offensichtlichem Konflikt mit der Verfassung stehend befinden könnte, weil es keinen ausreichenden Schutz eines Freiheitsrechts in privaten Beziehungen bietet. Im Gegensatz dazu umfasst die Pflicht der Gerichte, Gesetze im Einklang mit der Verfassung auszulegen, auch die Schutzfunktionen der Freiheitsrechte in privaten Beziehungen. Beispielsweise sollten Gesetzesbestimmungen, die in Finnland den Arbeitgebern ein eingeschränktes Recht geben, die Vertraulichkeit der E-Mail Korrespondenz ihrer Arbeitnehmer zu verletzen, eng ausgelegt werden.