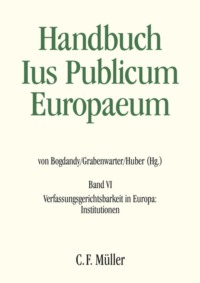b) Grundrechtsnormen als allgemeine Rechtsprinzipien
109
In den Debatten in Deutschland sieht man als eine der Hauptschuldigen für die angebliche Entwicklung in Richtung eines verfassungsgerichtlichen Jurisdiktionsstaates die Lehre von den Grundrechten als Rechtsprinzipien mit allumfassendem Anwendungsbereich und die daraus folgende Verpflichtung aller Staatsorgane, zu deren Realisierung beizutragen. Seit der wegweisenden Entscheidung Lüth aus dem Jahre 1958 hat das Bundesverfassungsgericht immer argumentiert, dass Grundrechtsbestimmungen nicht nur subjektive Rechte schaffen, sondern auch Grundsatznormen ausdrücken, welche die Grundwerte der Rechtsordnung offenbaren und ihren Einfluss in allen Rechtsgebieten zur Geltung bringen. Grundrechtsnormen bestimmen die Grundordnung nicht nur des Staates, sondern der gesamten Gesellschaft und enthalten im Keim die normative Substanz der gesamten Rechtsordnung. Eine solche Konzeption ist bereits in der Lehre von der Drittwirkung angelegt, die durch die Lüth-Entscheidung eingeführt wurde. Ursprünglich wurde jedoch nur auf die Ausstrahlungswirkung verwiesen, die Grundrechte als objektive Wertordnung innerhalb des Rechts entfalten.[66]
110
Ernst-Wolfgang Böckenförde argumentiert, dass die Lehre von der Drittwirkung und der Schutzpflicht des Staates von der Definition der Grundrechte als Grundwerte oder Grundprinzipien der gesamten Rechtsordnung abgeleitet sind.[67] Bei einer solchen Interpretation enthalten Grundrechtsnormen verfassungsrechtliche Aufträge an alle staatlichen Körperschaften und verlangen nach ihrer Umsetzung durch legislative, exekutive und administrative wie auch durch gerichtliche Betätigung. Die Anwendung der Grundrechtsnormen wird von Auslegung zu Konkretisierung umgewandelt: Die Realisierung der Grundrechte setzt sowohl durch die Gesetzgebung als auch durch das Bundesverfassungsgericht nicht nur die interpretative Spezifizierung ihrer Inhalte, sondern die kreative Konkretisierung der verfassungsrechtlichen Wertvorstellungen oder Optimierungsgebote voraus.[68] Das angebliche Ergebnis ist die Vergerichtlichung der gesetzgeberischen Politik und Politisierung der Verfassungsrechtsprechung.
111
Böckenförde versuchte auch zu zeigen, dass in der deutschen Lehre keine klare Unterscheidung zwischen unmittelbarer und mittelbarer Horizontalwirkung von Grundrechtsprinzipien getroffen werden kann. Die mittelbare Wirkung wird durch die Generalklauseln der Zivilrechtsgesetzgebung und die Gesetzesauslegung im Allgemeinen realisiert. Falls jedoch Grundrechte nicht durch Gesetzesauslegung implementiert werden können, ist dies nicht das Ende ihrer Drittwirkung. Dementsprechend hat sich das deutsche Bundesverfassungsgericht die Befugnis angemaßt, Zivilrechtsgesetzgebung für unwirksam zu erklären, wenn sie den Grundrechtsprinzipien nicht genug Aufmerksamkeit widmet. Das Bundesverfassungsgericht hat auch zugelassen, die Verfassungsbeschwerde auf die Drittwirkung der Grundrechte zu stützen. Der Beschwerdeführer könnte argumentieren, dass die einfachen Gerichte in einem Zivilrechtsfall der unmittelbaren oder mittelbaren Horizontalwirkung einer Grundrechtsnorm nicht die notwendige Beachtung zuerkannt haben. Kritiker, unter ihnen Böckenförde, waren besorgt, dass das Bundesverfassungsgericht zu einer letzten Berufungsinstanz in Zivilrechtsfällen werden könnte und sich damit nicht nur im öffentlichen Recht, sondern auch im Zivilrecht die letztendliche Auslegungsmacht aneignen könnte.[69]
112
Die Konzeption der Grundrechte als allgemeine Rechtsprinzipien, die einen umfassenden Anwendungsbereich haben und alle Rechtsgebiete mit ihrer normativen Grundlage versorgen, offenbart die Konstitutionalisierung der Rechtsordnung. Besonders nach der Grundrechtsreform von 1995 war diese Tendenz in der finnischen Rechtsordnung ebenfalls deutlich sichtbar. Dementsprechend enthält die Rechtsliteratur viele Vorschläge, um grundrechtsbezogene Prinzipien in die allgemeinen Lehren verschiedenster Rechtsgebiete einzuführen – wie etwa das Strafrecht, das Umweltrecht, das Eigentumsrecht oder das Schuldrecht. Sollten wir hier von einer Gefahr der Überkonstitutionalisierung sprechen, die zu einem „Jurisdiktionsstaat“ führt? Sollten solche Vorschläge als Entgleisungen abgewendet werden, welche die Prinzipien der Demokratie und der Gewaltenteilung gefährden?
113
Die allumfassenden Folgen der Verfassungskontrolle ergeben sich aus dem Zusammenspiel der institutionellen und dogmatischen Faktoren. Welche Auswirkungen das Verständnis der Grundrechtsnormen als objektiv-rechtliche Prinzipien haben wird, hängt davon ab, wie die Verfassungskontrolle organisiert ist und wie die Macht der Judikative bestimmt wird. Die deutsche Kritik setzt das Vorhandensein eines Verfassungsgerichts und der Verfassungsbeschwerde als Rechtsmittel voraus. Das finnische System beinhaltet kein spezialisiertes Verfassungsgericht oder etwas der deutschen Verfassungsbeschwerde Entsprechendes. Auch haben die einfachen Gerichte nicht die Macht, Zivilrechtsgesetzgebung wegen ihres behaupteten Widerspruchs zu Grundrechtsprinzipien für unwirksam zu erklären. Jedoch enthält die finnische Verfassung eine ausdrückliche Bestimmung hinsichtlich der Schutzpflicht. Art. 22 der Verfassung sieht vor, dass „[d]ie öffentliche Gewalt (…) die Verwirklichung der Grundrechte und der Menschenrechte zu sichern [hat]“. Dennoch ist es kaum vorstellbar, dass ein Gericht bei einer solchen Gelegenheit einen Widerspruch zwischen einem Grundrechtsprinzip und einer Gesetzesbestimmung findet, die eine Anwendung des Art. 106 der Verfassung rechtfertigen würde. Die Prinzipien der Demokratie und der Gewaltenteilung bewirken, dass die Schutzpflicht gemäß Art. 22 der Verfassung vor allem dem Gesetzgeber zufällt: Es ist an der Legislative, die Realisierung von Grundrechtsprinzipien in den horizontalen Beziehungen zwischen Privatpersonen zu garantieren. Demgemäß sollten die Gerichte ihre Schutzpflicht innerhalb des legislativen Rahmens erfüllen und den Grundrechtsprinzipien lediglich mittelbare Wirkung gewähren, die sich durch die Gesetzesauslegung entfaltet.
114
Matthias Kumm hat die Bedeutung der Unterscheidung zwischen unmittelbarer und mittelbarer Wirkung für die deutsche Verfassung in Frage gestellt, wobei er im Großen und Ganzen ähnliche Argumente anführt wie Böckenförde. Allerdings sieht Kumm, anders als Böckenförde, das Zusammenfallen von mittelbarer und unmittelbarer Wirkung hauptsächlich in positivem Licht.[70] Er porträtiert die Auflehnung gegen eine „totale Verfassung“ und gegen die Unterwerfung des Zivilrechts unter das Verfassungsrecht als Kampagne der Führungsschicht des deutschen Zivilrechts, um den hohen Status zu bewahren, den sie als Hüter des Bürgerlichen Gesetzbuchs – als Gipfel der deutschen Rechtswissenschaft und der Rechtskultur – genießt.[71] Umgekehrt mögen Wissenschaftler aus anderen Rechtsgebieten die Ausdehnung der Reichweite der Grundrechte als Zeichen von „verfassungsrechtlichem Imperialismus“ sehen. Die strategischen Interessen der Gesprächspartner im Machtspiel auf dem Gebiet des Rechts erhellen sicherlich den Kontext der diskursiven Interventionen. Aber natürlich hält uns das nicht davon ab, die Interventionen im Hinblick auf die normative Glaubwürdigkeit ihrer Argumente zu diskutieren.
115
Viel kann zugunsten des Übergreifens der Grundrechtsprinzipien auf andere Rechtsgebiete angeführt werden. Verbindungen zu Grundrechten verstärken die Rechtfertigung der allgemeinen Rechtsprinzipien und erzeugen Bedingungen für eine neue Art des grenzüberschreitenden Dialogs zwischen den Rechtsgebieten; ein Dialog, der durch die häufig grenzüberschreitende Natur gegenwärtiger Rechtsprobleme notwendig geworden ist. Außerdem trägt eine gemeinsame Grundrechtsbasis zur Kohärenz des auf Prinzipien beruhenden Rechts bei. Schließlich kann eine erhöhte Sensitivität für Grundrechte und Rechtsprinzipien zu einer offeneren Argumentation in den kontinentaleuropäischen Rechtssystemen führen. Selbst diejenigen, die sich hinsichtlich der Folgen der Vergerichtlichung vom Standpunkt der Demokratie her sorgen, können dies kaum anders denn als positive Entwicklung betrachten: Es erleichtert die diskursive Überwachung der gerichtlichen Entscheidungen nicht nur durch Juristen, sondern auch durch die Medien und die allgemeine Öffentlichkeit.
116
Dennoch wäre es auch fehlerhaft, das gesamte einfache Recht als Implementierung des Verfassungsrechts und die gesamte Rechtsprechung als (potentielle) Verfassungsrechtsprechung zu betrachten. Den dogmatischen Traditionen der etablierten Rechtsgebiete, wie etwa des Zivilrechts mit seinen Unterfeldern oder des Strafrechts, sollte Respekt gezollt werden. Grundrechtsprinzipien sollten ihre Wirkungen hauptsächlich mittelbar entfalten, durch die Vermittlung der „disziplin-spezifischen“ Prinzipien. Die Konstitutionalisierung trägt zur Rechtfertigung und der institutionellen Unterstützung der für das jeweilige Gebiet spezifischen Prinzipien bei und kann auch zu Anpassungen ihrer normativen Inhalte führen, aber die allgemeinen Lehren der anderen Rechtsgebiete sollten nicht durch die Verfassungslehre ersetzt werden dürfen. Anderenfalls würde viel etablierte rechtliche ratio verloren gehen. Auch sollten die spezialisierte Rechtskompetenz und das Vorverständnis der Richter und Wissenschaftler, die sich mit anderen Rechtsgebieten befassen, durch eine Überkonstitutionalisierung nicht entwertet werden dürfen.
§ 98 Verfassungsgerichtsbarkeit in Finnland › III. Aspekte der Evaluierung › 4. Zusammenfassung
4. Zusammenfassung
117
Dem finnischen Modell, basierend auf einer Kombination von abstrakter parlamentarischer ex ante-Kontrolle und gerichtlicher ex post-Kontrolle, ist es gelungen, zumindest einige Gefahren abzuwehren, vor denen die Kritiker der Verfassungskontrolle und der darauffolgenden Tendenz zu einem Jurisdiktionsstaat gewarnt haben. Eine eindeutige Betonung liegt auf der ex ante-Überwachung und die Gerichte scheinen die Rolle, welche ihnen nach dem ultima ratio-Einwand für eine gerichtliche Kontrolle zukommt, zu akzeptieren. Ein integraler Bestandteil des gegenwärtigen Gleichgewichts zwischen parlamentarischer und gerichtlicher Kontrolle besteht aus dem Erfordernis des „offensichtlichen Widerspruchs“, das durch Art. 106 der Verfassung aufgestellt wird. Es hat einen allgemeinen Ruf nach richterlicher Selbstbeschränkung ausgedrückt und die Auswirkung der deutschen Lehren von den Grundrechten als Rechtsprinzipien mit allgemeinem Anwendungsbereich, der Drittwirkung der Grundrechte und der Schutzpflicht des Staates eingeschränkt.
118
Ursprünglich ist das Kriterium des offensichtlichen Widerspruchs von der schwedischen Verfassung entliehen worden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt berät man sowohl in Schweden als auch in Finnland über eine Verfassungsreform und es haben sich Stimmen erhoben, die für die Abschaffung dieser Beschränkung der gerichtlichen ex post-Verfassungskontrolle eintreten; in Schweden wurde sogar ein Gesetzesvorschlag, der eine Bestimmung zu diesem Zweck enthält, dem Parlament vorgelegt.[72] Meiner Auffassung nach wäre die Abschaffung des Kriteriums des offensichtlichen Widerspruchs ein Fehler. Dieses Kriterium birgt wichtige Botschaften, die immer noch sachdienlich sind: einen allgemeinen Ruf nach richterlicher Selbstbeschränkung, der durch die Prinzipien der Demokratie und der Gewaltenteilung gerechtfertigt ist, den Vorrang der abstrakten ex ante-Kontrolle durch den Grundgesetzausschuss und die Rolle der Gesetzesauslegung bei der Lösung von Spannungen zwischen Gesetzgebung und der Verfassung. Die Tatsache, dass Gerichte sich selten auf ihre Macht nach Art. 106 der Verfassung berufen, ist an und für sich kein Problem; es könnte ganz einfach anzeigen, dass die Verfassungskontrolle ungefähr so funktioniert, wie sie es in einem demokratischen Rechtsstaat sollte. In Finnland waren Kritiker des Kriteriums des offensichtlichen Widerspruchs nicht in der Lage, irgendeinen Fall zu nennen, in dem dieses Kriterium eine notwendige gerichtliche ex post-Kontrolle verhindert hat.[73] Hätte es mehr gerichtliche Fälle der Verfassungskontrolle gegeben, hätte dies, auf der anderen Seite, ernsthafte Probleme im demokratischen Gesetzgebungsprozess und der ex ante-Kontrolle offenbart. Falls das Erfordernis des offensichtlichen Widerspruchs abgeschafft würde, könnte dies ebenfalls leicht als Botschaft verstanden werden: als eine Ermunterung der Gerichte, die Schwelle in der Verfassungskontrolle niedriger anzusetzen. Eine derartige Botschaft wäre kaum zu rechtfertigen.
119
Im Hinblick auf die ex ante-Kontrolle durch den Grundgesetzausschuss wurde dies, im Gegensatz zur abstrakten ex ante-Kontrolle durch viele Verfassungsgerichte oder Quasi-Gerichte wie den französischen Conseil constitutionnel, nicht in ein Instrument der Opposition umgewandelt. Im Regelfall kommt die Initiative, den Grundgesetzausschuss zu befragen, von der Regierung, und es kommt sehr selten vor, dass das Anregen einer Verfassungskontrolle politische Leidenschaften entfacht. Als Politiker sind die Mitglieder des Ausschusses im Prinzip für den politischen Druck der Partei empfänglich, was nicht gut zur quasi-gerichtlichen Natur der Körperschaft passt. Jedoch ist ein derartiger Druck selten, und die Abwesenheit von Parteidisziplin und der Ausschluss der vor dem Ausschuss anhängigen Sachen von Gruppentreffen zeigen das Verständnis für den besonderen Charakter der Angelegenheiten der Verfassungskontrolle. Dennoch gibt es Beispiele mangelnden Respekts der Repräsentanten der Exekutive gegenüber Positionen des Grundgesetzausschusses. Selbst Versuche der Beeinflussung laufender Beratungen im Ausschuss sind vorgekommen. Falls solche Phänomene häufiger werden, wäre dies für die Autorität des gegenwärtigen Systems der Verfassungskontrolle nachteilig und Forderungen nach einem Systemwechsel würden laut werden.
120
Jedoch sehe ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt keinen Grund für grundlegende Veränderungen im System der ex ante-Verfassungskontrolle, wie etwa eine extensivere Beteiligung der höchsten Gerichte oder gar der Errichtung eines Verfassungsgerichts. Allerdings finde ich die Macht des Präsidenten, den Obersten Gerichtshof oder den Obersten Verwaltungsgerichtshof auf verfassungsrechtlicher Grundlage anzurufen, nachdem ein Gesetzesentwurf durch das Parlament angenommen wurde, recht problematisch. Sie kann zu verfassungsrechtlichen Kontroversen und zu einer Schwächung der Autorität des Grundgesetzausschusses führen. Außerdem könnte dies, wie die Venedig-Kommission in ihrem Bericht über die finnische Verfassung bemerkte, Spannungen vom Blickwinkel der Gewaltenteilung her erzeugen.[74] Die Verfassungsreform, die am 1.3.2012 in Kraft trat, hat die Bestimmungen über die Verfassungskontrolle nicht verändert, anders – darauf sei abschließend hingewiesen – die schwedische Verfassungsreform: Sie hat zum 1.1.2011 die Erforderlichkeit eines offensichtlichen Konflikts abgeschafft.
§ 98 Verfassungsgerichtsbarkeit in Finnland › Bibliographie
Bibliographie
| | Robert Alexy, Theorie der Grundrechte, 1986. |
| | Richard Bellamy, Political Constitutionalism: A Republican Defense of the Constitutionality of Democracy, 2007. |
| | Alexander M. Bickel, The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics, 1962. |
| | Ernst-Wolfgang Böckenförde, Grundrechte als Grundsatznormen, in: Ernst-Wolfgang Böckenförde (Hg.), Staat, Verfassung, Demokratie, 1991, S. 159–199. |
| | Erwin Chemerinski, Rethinking State Action, Northwestern University Law Review 80 (1985), S. 503–557. |
| | Paul Craig, Report on the United Kingdom, in: Ann-Marie Slaughter/Alec Stone Sweet/J.H.H. Weiler (Hg.), The European Court and National Courts – Doctrine and Jurisprudence, 1998, S. 195–224. |
| | Neil Duxbury, Patterns of American Jurisprudence, 1995. |
| | Ronald Dworkin, Freedom’s Law, 2003. |
| | Stephen Gardbaum, The „Horizontal Effect“ of Constitutional Rights, Michigan Law Review 102 (2003), S. 387–459. |
| | Ders., The New Commonwealth Model of Constitutionalism, American Journal of Comparative Law 49 (2001), S. 707–760. |
| | Jürgen Habermas, Faktizität und Geltung, 1992. |
| | Ulrich R. Haltern, Verfassungsgerichtsbarkeit, Demokratie und Mißtrauen, 1998. |
| | Learned Hand, The Bill of Rights: The Oliver Wendell Holmes Lecture, 1958. |
| | Ran Hirschl, Juristocracy, 2007. |
| | Osmo Jussila, Suomen perustuslait venälaisten ja suomalaisten tukintojen mukaan 1808–1863, 1969. |
| | Antero Jyränki, Lakien laki, 1989. |
| | Paavo Kastari, Kansalaisvapauksien perustuslainsuoja, 1972. |
| | Ders., Suomen perusoikeusjärjestelmä käytännössä, Lakimies 1958, S. 529–539. |
| | Duncan Kennedy, A Critique of Adjudication, 1997. |
| | Martti Koskenniemi, The Effect of Rights on Political Culture, in: Philip Alston (Hg.), The EU and Human Rights, 1999, S. 99–117. |
| | Matthias Kumm/Victor Ferreres Comella, What is So Special about Constitutional Rights in Private Litigation? A Comparative Analysis of the Function of State Action Requirements and Indirect Horizontal Effect, in: András Sajó/Renáta Uitz (Hg.), The Constitution in Private Relations: Expanding Constitutionalism, 2005, S. 241–286. |
| | Matthias Kumm, Institutionalising Socratic Contestation: The Rationalist Human Rights Paradigm, Legitimate Authority and the Point of Judicial Review, European Journal of Legal Studies, Vol. 1 No. 2 (2007). |
| | Ders., Who is afraid of the Total Constitution? Constitutional Rights as principles and the Constitutionalization of Private Law, German Law Journal 8 (2006), S. 341–369. |
| | Christopher P. Manfredi, Judicial Power and the Charter, 1993. |
| | Tuomas Ojanen, Perustuslain 106§:n etusijasäännös – timivuuden ja muutostarpeiden arviointi, in: Report of the Constitution 2008 Working Group, S. 134–151. |
| | Opinion on the Constitution of Finland adopted by the Venice Commission at its 74th plenary session (Venice, 14–15 March 2008). |
| | Perustuslain tarkistamiskomitean mietintö. Helsinki: Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 9/2010. |
| | Jens Plotner, Report on France, in: Ann-Marie Slaughter/Alec Stone Sweet/J.H.H. Weiler (Hg.), The European Court and National Courts – Doctrine and Jurisprudence, 1998, S. 41–76. |
| | Ulrich Preuss, The German Drittwirkung Doctrine and Its Socio-Political Background, in: András Sajó/Renáta Uitz (Hg.), The Constitution in Private Relations: Expanding Constitutionalism, 2005, S. 23–32. |
| | Esko Riepula, Eduskunnan perustuslakivaliokunta perustuslakien tulkitsijana, 1973. |
| | Kimmo Sasi, Asiantuntijat perustuslakivaliokunnan lausuntotyössä, in: Pia Letto-Vanamo/Olli Mäenpää/Tuomas Ojanen (Hg.), Juhlajukaisu Mikael Hidén 1939–7/12–2009, 2009, S. 153–166. |
| | Martin Scheinin, Ihmisoikeudet Suomen oikeudessa, 1991. |
| | Kim Lane Scheppele, Democracy by Judiciary. Or, why Courts Can be More Democratic than Parliaments, in: Czarnota Adam/Martin Krygier/Wojciech Sadurski (Hg.), Rethinking the Rule of Law after Communism, 2005. |
| | Bernhard Schlink, German Constitutional Culture in Transition, Cardozo Law Review 14 (1992–1993), S. 711–736. |
| | Alec Stone Sweet, The Judicial Construction of Europe, 2004. |
| | Mark Tushnet, Policy Distortion and Democratic Debilitation: Comparative Illumination of the Countermajoritarian Difficulty, Michigan Law Review 94 (1995), S. 245–301. |
| | Ders., Taking the Constitution away from Courts, 1999. |
| | Ders., Weak Courts, Strong Rights, 2008. |
| | Veli-Pekka Viljanen, Kansalaisten yleiset oikeudet, 1988. |
| | Jarmo Vuorinen, Perustuslakivaliokunnan laja tehtäväkenttä, in: Matti Myrsky/Perttu Vartiainen/Tarmo Miettinen (Hg.), Juhlakirja Teuvo Pohjolainen 1945–14/10–2005, 2005, S. 107–121. |
| | Jeremy Waldron, The Core of the Case against Judicial Review, Yale Law Journal 115 (2006), S. 1346–1407. |