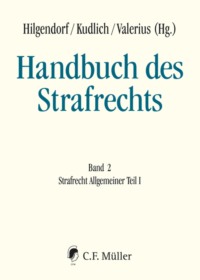Kitabı oku: «Handbuch des Strafrechts», sayfa 35
II. Die Äquivalenztheorie
5
Besteht damit Einigkeit, dass die Kausalität zwischen Handlung und Erfolg beim Erfolgsdelikt eine unabdingbare Voraussetzung darstellt, ist damit noch nicht beantwortet, wie diese Kausalität beschaffen sein muss. Der Gesetzgeber selbst beantwortet diese Frage nicht. Die ständige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wendet im Anschluss an das Reichsgericht[6] die Äquivalenztheorie an, die auch Bedingungstheorie genannt wird. Der österreichische Prozessualist Julius Glaser wird als Begründer diese Theorie angesehen.[7] Insbesondere der spätere Richter am Reichsgericht Maximilian von Buri[8] baute die Theorie weiter aus.[9] Der 2. Strafsenat des BGH stellte schon in seiner Entscheidung vom 28. September 1951 klar:[10] „Das Reichsgericht hat in ständiger Rechtsprechung für das gesamte Gebiet des Strafrechts die Bedingungstheorie angewandt. Das Schrifttum ist dem überwiegend gefolgt. Diese Auffassung herrscht auch heute noch vor. Auch der Senat teilt sie.“
6
Inhaltlich wird dabei die Bedingungstheorie in der Rechtsprechung folgendermaßen umschrieben:[11] Ursächlich ist jede Bedingung, die nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der Erfolg entfiele, also jede „condicio sine qua non“.
7
Kennzeichnend für die Äquivalenztheorie ist dabei die Gleichwertigkeit aller Bedingungen.[12] Nicht nur die letztgesetzte Bedingung, die typischen Bedingungen oder eine wie auch immer geartete „überwiegende Bedingung“ oder „Hauptursache“ sind danach ursächlich, sondern alle, welche zu dem Erfolgseintritt beigetragen haben, selbst, wenn sie lediglich zufällig eingetreten sind; sie sind eben äquivalent. Das gilt auch, wenn sich eine weitere Bedingung als „Zwischenursache“ zwischen die in Rede stehende Handlung und den Erfolg einschiebt und es sich dabei um die Handlung eines anderen Menschen handelt.[13] Ein Regressverbot, wie es zum Teil früher im Schrifttum vertreten wurde,[14] wonach das vorsätzliche und schuldhafte Dazwischentreten eines Dritten die Kausalität entfallen lassen soll, wird also nicht anerkannt[15] und ist mit der Äquivalenztheorie unvereinbar. Die Kausalität des Täterhandelns wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass das Verhalten des Opfers oder das deliktische oder undeliktische Verhalten eines Dritten bei der Herbeiführung des Erfolges mitgewirkt haben.[16]
8
Gleichgültig ist also, ob neben der Bedingung noch andere Bedingungen bei der Herbeiführung des Erfolges wirksam geworden sind.[17] Mitursächlichkeit reicht aus.[18] Das führt natürlich zu einer weit ausgedehnten Kausalität: So ist in dem Fall, dass ein Angreifer A das Opfer O mit einem Messer verletzt, nicht nur A ursächlich; vielmehr haben auch der Verkäufer und der Hersteller des Messers sowie die Eltern, Großeltern usw. des A zu dem Erfolg beigetragen und sind ursächlich im Sinne der Äquivalenztheorie. Ihre jeweiligen Handlungen – so etwa das Herstellen des Messers und die Zeugung des A – können nämlich nicht hinweggedacht werden, ohne dass der Verletzungserfolg bei O entfiele.
9
Vor dem Hintergrund der Gleichwertigkeit der Bedingungen entfällt die Kausalität auch nicht bei einem ganz außergewöhnlichen Geschehensablauf, mit dem niemand zu rechnen braucht.[19] Mit anderen Worten ist die Ursächlichkeit einer Bedingung auch bei atypischen Kausalverläufen gegeben.[20] Sticht der Täter A mit Tötungsvorsatz auf das Opfer O ein und flieht nun der verletzte O vor weiteren Misshandlungen auf die Straße, wo er von einem herabstürzenden Satelliten tödlich getroffen wird, dann handelt es sich um einen ganz atypischen, außergewöhnlichen Geschehensablauf, mit dem niemand zu rechnen braucht. Dennoch ändert dies nichts daran, dass A für den Tod des O ursächlich geworden ist. Seine Messerattacke kann nämlich nicht hinweggedacht werden, ohne dass der Erfolg entfiele.
10
Auch im strafrechtlichen Schrifttum wird oft die Äquivalenztheorie zur Feststellung der Kausalität herangezogen.[21] Kritik entzündet sich jedoch zum einen an der Uferlosigkeit der Theorie, sodass ihr Erkenntnisgewinn gering sei.[22] Zudem könne die Äquivalenztheorie Verursachungszusammenhänge nicht selbst erklären, sondern setze voraus, dass ein allgemeines Kausalgesetz existiert, wonach von einer bestimmten Ursache auf den Eintritt einer Bedingung geschlossen werden kann.[23]
III. Die Formel von der gesetzmäßigen Bedingung
11
Angesichts dieser Kritikpunkte an der condicio sine qua non-Formel wird in der Strafrechtswissenschaft zur Bestimmung der Kausalität oft die von Engisch[24] entwickelte Formel von der gesetzmäßigen Bedingung herangezogen:[25] Danach ist eine Handlung kausal, wenn sich an sie zeitlich nachfolgende Veränderungen in der Außenwelt anschließen, die mit der Handlung nach den bekannten Naturgesetzen notwendig verbunden sind und sich als tatbestandsmäßiger Erfolg darstellen.[26] Zu fragen ist danach, ob die konkrete Handlung im konkreten Erfolg tatsächlich wirksam geworden ist.[27] Auch diese Theorie geht von der Gleichwertigkeit aller Bedingungen aus.[28] Als Vorteil dieser Formel gegenüber der Äquivalenztheorie erachtet man, dass das Erfordernis eines naturgesetzlichen Zusammenhangs deutlich angesprochen werde; zudem verzichte diese Formel auf hypothetische Überlegungen.[29] Andererseits ändert auch diese Formel nichts an der Uferlosigkeit der Bedingungen, welche ursächlich sind. Zudem hilft diese Formel ebenfalls nicht weiter, wenn das Naturgesetz nicht sicher oder nicht bekannt ist.[30] Man muss sich bewusst machen, dass stets die generelle Kausalität[31] vorliegen muss, bevor die Frage nach der konkreten beantwortet werden kann; dann ist aber die condicio sine qua non-Formel weitaus griffiger.[32] Zudem ist sie einfacher zu handhaben als die Formel von der gesetzmäßigen Bedingung bei der psychisch vermittelten Kausalität wie etwa im Bereich der Anstiftung.[33] In Konstellationen psychisch vermittelter Kausalität geht es nämlich nicht um naturgesetzlich vorgeschriebene Reaktionen, sondern um einen Motivationszusammenhang.[34] Dennoch fehlt es in diesen Fällen nicht an der Kausalität. Beide Ansätze – Äquivalenztheorie und Formel von der gesetzmäßigen Bedingung – kommen im Übrigen zu übereinstimmenden Ergebnissen.[35]
IV. Einzelheiten zur Äquivalenztheorie
12
Die soeben erwähnte Umschreibung der Äquivalenztheorie bedarf der weiteren Präzisierung, um die Kausalität insbesondere in Grenzfällen feststellen zu können.
1. Hypothetische Kausalverläufe
13
Ein bedeutsamer Gesichtspunkt ist dabei, inwieweit mögliche hypothetische Kausalverläufe auf die Ursächlichkeit Auswirkungen haben. Wenn der Angreifer A sein Opfer O mit einem Messerstich tötet, O jedoch ohne den Messerstich des A wenige Sekunden später von dem B, der unabhängig von A agiert, erschossen worden wäre, stellt sich die Frage, ob der Messerstich hinweggedacht werden kann, ohne dass der Erfolg – Tod des O – entfällt, und damit die Ursächlichkeit des Handelns des A für den Erfolg zu verneinen ist. Eine solche Sicht wird jedoch einhellig abgelehnt. Der Bundesgerichtshof führt insofern aus, eine Handlung könne auch dann nicht hinweggedacht werden, ohne dass der Erfolg entfiele, wenn die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit besteht, dass ohne die Handlung des Täters ein anderer eine – in Wirklichkeit jedoch nicht geschehene – Handlung vorgenommen hätte, die ebenfalls den Erfolg herbeigeführt haben würde.[36] In der strafgerichtlichen Rechtsprechung werde nicht bezweifelt, dass ein Handeln im Rechtssinne als Ursache des Erfolges angesehen werden müsse, das ohne Hinzudenken einer anderen in Wirklichkeit nicht geschehenen Handlung nicht weggedacht werden kann, ohne dass der Erfolg entfiele.[37] Es müsse bei der rechtlichen Beurteilung des Sachverhalts von dem wirklichen Geschehen oder Verhalten des Angeklagten ausgegangen werden.[38] Der BGH führt zudem aus, ausreichend für die Kausalität sei, dass ein ohnehin drohender Erfolg durch den Täter in einem zeitlich früheren Stadium herbeigeführt wird.[39] Das Hinzudenken einer nicht erfolgten Ersatzursache ist danach unzulässig.[40]
14
Im Schrifttum wird zum Ausscheiden derartiger hypothetischer Kausalverläufe teilweise die Bedingungstheorie dahingehend präzisiert, dass es auf den Erfolg in seiner konkreten Gestalt ankomme.[41] Dieser bestimmt sich nach dem Ort, der Zeit, den konkreten Umständen, der Art der Verletzung sowie dem genauen Tathergang.[42] Der Erfolg in seiner konkreten Gestalt in dem angeführten Beispiel ist nun aber der Tod des O zu einem ganz konkreten Zeitpunkt an einem konkreten Ort durch einen Messerstich in einen bestimmten Körperbereich, nicht aber der Tod durch Erschießen.[43] Andererseits wird zum Teil aus dem Gesichtspunkt „Erfolg in seiner konkreten Gestalt“ die Schlussfolgerung gezogen, selbst ein Arzt, der einem todkranken Patienten ein lebensverlängerndes Medikament verabreicht, setze im Sinne der Äquivalenztheorie eine Bedingung für den Tod.[44] Hierbei wird jedoch verkannt, dass in diesem Fall bereits die als Vorstufe zur konkreten Kausalität erforderliche generelle Kausalität[45] fehlt. Die Verabreichung eines lebensverlängernden Medikaments ist schon abstrakt gesehen gar nicht in der Lage, den Tod herbeizuführen, sodass von vornherein die konkrete Kausalität nicht vorliegen kann. So liegt es im Übrigen auch in Fallkonstellationen, die im Schrifttum unter dem Gesichtspunkt unbeachtliche „Begleitumstände“[46] erörtert werden: Derjenige, welcher eine Vase bemalt hat, ohne dass dies Auswirkungen auf ihre Stabilität hat,[47] ist deswegen nicht kausal für die spätere Beschädigung der Vase, da schon kein allgemeines Kausalgesetz existiert, wonach das Bemalen einer Vase abstrakt geeignet ist, eine Vase zu beschädigen. Hier muss also nicht argumentiert werden, das Bemalen sei für den Erfolg der Sachbeschädigung nicht „relevant“,[48] womit unnötig wertende Gesichtspunkte mit der Kausalität verknüpft werden.[49] Es spielt deswegen auch „ersichtlich keine Rolle“,[50] in welchem Hemd das Opfer erschossen wird, sodass die Ehefrau des Opfers, die am Morgen der Tat ein Hemd für ihren Mann herausgelegt hat, nicht kausal für dessen Tod ist, weil schon kein allgemeines Kausalgesetz existiert, wonach das Tragen eines Hemdes den Tod herbeiführen kann.
2. Abbruch rettender Kausalverläufe
15
Obwohl also das Hinzudenken einer in Wirklichkeit nicht geschehenen Handlung unzulässig ist, muss von diesem Grundsatz beim Abbruch rettender Kausalverläufe eine Ausnahme gemacht werden. Es geht etwa um den Fall, dass der Täter A den Rettungsschwimmer R daran hindert, das Kind K vor dem Ertrinkungstod zu bewahren, sodass K stirbt. In diesem Fall ist ausnahmsweise das Verhalten des R – die Rettung des Kindes – hinzuzudenken, um festzustellen, dass A für den Tod des K ursächlich geworden ist. Insofern wird also auf den hypothetischen weiteren Verlauf abgestellt. Das ist hier jedoch erlaubt, da eine in der realen Welt bereits vorhandene Bedingung, die Rettung gebracht hätte, vom Täter ausgeschaltet wird.[51] Es geht zudem nicht um die Ersetzung des tatsächlichen Geschehens durch einen hinzugedachten Verlauf, sondern um die Ergänzung des tatsächlichen Geschehens.[52]
3. Alternative Kausalität
16
Weitere Fragen ergeben sich, wenn mehrere für sich taugliche Bedingungen den Erfolg herbeiführen. So hatte sich der BGH mit einem Fall zu befassen, in dem zwei Schüsse auf das Opfer abgegeben worden waren.[53] Jeder der beiden Schüsse war zunächst in dem Sinne tödlich, dass er für sich allein zum Tod geführt hätte. Das Opfer verstarb aber tatsächlich an den vielfachen durch beide Schüsse entstandenen Organverletzungen, also an einem Zusammentreffen der Verletzungsfolgen beider Schüsse. Der BGH führt aus, dass es sich hierbei um einen Fall der alternativen Kausalität oder Doppelkausalität handele.[54] Diese liege vor, wenn mehrere unabhängig voneinander gesetzte Bedingungen zusammenwirken, die zwar auch für sich allein zur Erfolgsherbeiführung ausgereicht hätten, tatsächlich aber alle in dem eingetretenen Erfolg wirksam geworden sind. In diesem Fall seien alle Bedingungen ursächlich für den Erfolgseintritt.[55] Davon geht auch das Schrifttum aus: Können mehrere Bedingungen zwar nicht kumulativ, jedoch alternativ hinweggedacht werden, ohne dass der Erfolg in seiner konkreten Gestalt entfiele, sei jede dieser Bedingungen ursächlich.[56]
17
Hingewiesen sei darauf, dass sich die Ursächlichkeit der beiden Bedingungen letztlich zwanglos bereits aus dem Umstand ergibt, dass der Beurteilung das wirkliche Geschehen zugrunde zu legen ist.[57] Hier nun haben aber tatsächlich beide Bedingungen in ihrem Zusammenwirken den Erfolg herbeigeführt, sodass Ursächlichkeit beider Bedingungen anzunehmen ist. Dass der Tod auch nur durch eine der beiden gesetzten Bedingungen eingetreten wäre, ist ein unbeachtlicher hypothetischer Kausalverlauf. Die Formel der alternativen Kausalität ist vor diesem Hintergrund gar nicht notwendig zur Lösung des Falls.[58]
18
Anders zu beurteilen sind aber folgende Konstellationen: Wenn sicher feststeht, dass der erste Schuss den Tod allein herbeigeführt hat, nicht jedoch der zweite, so ist nur der erste Schuss ursächlich für den Todeserfolg.[59] Umgekehrt gilt dies natürlich ebenso, also in dem Fall, dass allein der zweite Schuss den Tod herbeigeführt hat.
19
Schließlich ist zu klären, was zu gelten hat, wenn nicht sicher feststeht, ob der erste oder der zweite Schuss den Tod verursacht hat, jedoch nur einer von beiden zum Tod führte. In diesem Fall bestehen Tatsachenzweifel; insofern geht es dann nicht um eine Konstellation der alternativen Kausalität, da diese voraussetzt, dass zwei für sich genommen erfolgstaugliche Bedingungen tatsächlich in ihrem Zusammenwirken den Erfolg herbeigeführt haben. Vielmehr greift bei Tatsachenzweifeln, welcher der beiden Schüsse den Tod verursacht hat, der Grundsatz in dubio pro reo ein, sodass zwei unabhängig voneinander handelnde Täter nur jeweils wegen eines versuchten Tötungsdelikts bestraft werden können.[60] Eine Vollendungsstrafbarkeit kommt in einem solchen Zweifelsfall nur bei Vorliegen von Mittäterschaft in Betracht, da dann die Tatbeiträge gegenseitig zugerechnet werden können.
4. Kumulative Kausalität
20
Unproblematisch ist die Ursächlichkeit in den Fällen der kumulativen Kausalität gegeben.[61] Bei dieser Konstellation wird der Erfolg erst im Zusammenwirken zweier oder mehrerer Bedingungen herbeigeführt, jede Bedingung für sich genommen reicht jedoch zur Erfolgsherbeiführung nicht aus. Geben A und B jeweils unabhängig voneinander eine nicht tödliche Menge Gift in den Kaffee des Opfers O, wobei beide Giftmengen in ihrem Zusammenwirken eine tödliche Wirkung entfalten, dann ist ohne Weiteres jede einzelne Giftbeibringung kausal für den Todeserfolg. Sie kann nämlich jeweils nicht hinweggedacht werden, ohne dass der Erfolg entfiele.
5. Überholende Kausalität
21
Von den bisherigen Konstellationen zu unterscheiden sind Fälle der überholenden Kausalität. Nach der Rechtsprechung und dem Schrifttum liegt eine Unterbrechung des Kausalverlaufs – also überholende Kausalität – vor, wenn ein späteres Ereignis die Fortwirkung einer früheren Ursache beseitigt und unter Eröffnung einer neuen Kausalreihe den Erfolg allein herbeiführt.[62] Gibt also der Täter A in den Kaffee des Opfers O ein tödlich wirkendes Gift, das der O trinkt, wird jedoch O nun davon unabhängig von dem Täter B, der von der Giftbeibringung nichts weiß, erschossen, bevor das Gift des A überhaupt seine Wirkung entfalten konnte, wirkt die von A gesetzte Bedingung nicht mehr bis zum Erfolg fort und ist von der Zweitbedingung – der Schussabgabe – überholt. Man spricht insofern auch von abgebrochener Kausalität.[63] In diesem Fall ist unabhängig von der zunächst gesetzten Bedingung eine neue Ursachenreihe in Gang gesetzt worden. A ist dann mit seinem Verhalten nicht ursächlich für den Tod des O. Anders ist dies zu beurteilen, wenn etwa O unter den Wirkungen des Gifts bereits leidet, was B erkennt, der dann den O zur Verkürzung der Qualen erschießt. Dann ist sowohl die von A als auch die von B gesetzte Bedingung ursächlich, denn beide wirken bis zum Erfolg fort. Die Giftbeigabe kann im letzteren Fall nämlich nicht hinweggedacht werden, ohne dass der Erfolg in seiner konkreten Gestalt entfiele; hätte A den O nicht vergiftet, wäre es bei O nicht zu den Qualen gekommen, die B veranlasst haben, den O zu töten. Der Zweittäter knüpft damit an die Ersthandlung an, die Kausalität wirkt fort.
6. Kausalität bei Gremienentscheidungen
22
Problematisch kann die Feststellung der Kausalität bei Gremienentscheidungen sein. Wenn etwa der mit sieben Personen besetzte Vorstand der X-AG mit einer Mehrheit von fünf zu zwei Stimmen entscheidet, dass giftiger Müll vorschriftswidrig in den Boden eingebracht werden soll (§ 324a StGB), stellt sich die Frage, welches der Mitglieder für den Erfolg der Bodenverunreinigung[64] ursächlich geworden ist. Zu verneinen ist dies in Bezug auf diejenigen Vorstandsmitglieder, welche dagegen gestimmt haben. Fraglich erscheint, ob ein Befürworter des Beschlusses einwenden kann, er sei nicht kausal geworden, denn auf seine Stimme sei es bei diesen Mehrheitsverhältnissen gar nicht angekommen. Letztlich dringt dieser Gedanke jedoch nicht durch. Das gilt einmal, wenn die Abstimmenden als Mittäter zu qualifizieren sind, da dann die jeweiligen Tatbeiträge zugerechnet werden können.[65] Aber selbst, wenn dies nicht der Fall ist, greift der Einwand nicht durch. Der Erfolg in seiner konkreten Gestalt beruht nämlich auf dem tatsächlichen Abstimmungsergebnis mit seiner Stimmenverteilung. Der Einwand, auch ohne ihn sei das Ergebnis so ausgefallen, stellt wiederum das Hinzudenken einer in Wirklichkeit nicht geschehenen hypothetischen Ersatzursache dar, was wie gesehen unzulässig ist.[66] Es ist auf das wirkliche Geschehen abzustellen. Von kumulativer Kausalität ist bei einem Abstimmungsverhältnis von vier gegen drei Stimmen auszugehen, da dann die vier Stimmen nur in ihrer Gemeinsamkeit den Erfolg herbeiführen können.[67]
7. Kausalität beim Fahrlässigkeitsdelikt
23
Auch im Bereich der Fahrlässigkeit beurteilt sich die Kausalität nach der Äquivalenztheorie. Insofern bestehen also hinsichtlich der Feststellung der Ursächlichkeit keine Unterschiede zum Vorsatzdelikt. Das missachtet hingegen die Rechtsprechung. So verneint der BGH beim fahrlässigen Delikt die Ursächlichkeit, wenn der Erfolg auch bei einem pflichtgemäßen Verhalten des Täters eingetreten wäre. Ursächlich sei ein sorgfaltswidriges Handeln nur, wenn sicher sei, dass es bei verkehrsgerechtem Verhalten nicht zu dem Erfolg gekommen wäre.[68] Diese Sichtweise des BGH hängt damit zusammen, dass der Gesetzestext (vgl. §§ 229, 222 StGB) nicht das Handeln des Täters mit dem Erfolg verknüpft, sondern dessen Fahrlässigkeit.[69] Damit werden jedoch hypothetische Ersatzursachen, die sich tatsächlich nicht ereignet haben, hinzugedacht. Es geht dann nicht mehr um den Erfolg in seiner konkreten Gestalt. Man würde bei der Fahrlässigkeit einen anderen Kausalbegriff als beim Vorsatzdelikt zugrunde legen. Richtigerweise ist die vom BGH aufgeworfene Frage keine der Kausalität. Vielmehr ist der Gesichtspunkt des rechtmäßigen Alternativverhaltens ein eigenständiger Prüfungspunkt beim Fahrlässigkeitsdelikt, welcher von der Kausalitätsfrage zu unterscheiden ist.[70]