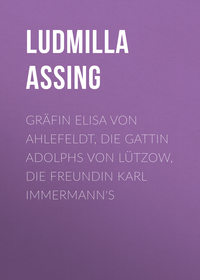Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «Gräfin Elisa von Ahlefeldt, die Gattin Adolphs von Lützow, die Freundin Karl Immermann's», sayfa 10
11
Magdeburg, den 14. März 1824.
Was Sie mir, theure Freundin, von den Carnevalslustbarkeiten und Ihren Aengsten erzählt haben, hat mich (Sie verzeihen mir) sehr ergötzt, und ich sah Sie ganz deutlich bei verschlossenen Thüren hinter dicken Mauern zittern. Ehe ich Sie näher kannte, hielt ich Sie immer für eine Art von Heroine, bei genauerer Betrachtung ist zwar dieser erhabne Glanz von Ihnen abgefallen, dafür sprang aber eine um so angenehmere Aengstlichkeit hervor, wie denn überhaupt alles bei Ihnen sich in Liebenswürdigkeit kleidet. – Ich habe diese Tage, wie alle meine Tage, hier sehr still verlebt, nichts erinnert hier an das Fest, welches den Süden so tumultuarisch bewegt, als die sonnabendlichen Redouten im Schauspielhause, die aber auch herzlich schlecht sind. Sonst waren in den kleinen Städten um Magdeburg Maskenbälle, wozu die Honetten, welche sich auf die hiesigen nicht wagen dürfen, eilten, jetzt ist das auch eingegangen. Was soll aus der Welt werden, wenn wir im trocknen Ernste so fortschreiten, wie bisher? Nicht viel Kluges, meiner Meinung nach, denn die Menschheit bedarf, wie der Einzelne, zuweilen einen Thorensprung, um sich zu erfrischen, und um mit desto größerer Kraft sich nachher wieder auf Tugend und Vernunft legen zu können. Die bedeutendsten, würdigsten Ereignisse in der Geschichte sind immer diejenigen Handlungen, durch welche ein Einzelner oder ein Volk eine große Narrheit oder Sünde gut zu machen strebt, wie soll er aber dazu noch kommen, wenn man am Ende nur regelrechte Verstandesmäßigkeit kennt?
In diesen Tagen las ich in den Charakteristiken und Kritiken von den beiden Schlegel's manches gute, treffende Wort, welches ich Ihnen gern, frisch wie ich es empfangen, wiedererzählt hätte. Lassen Sie sich doch einmal die beiden Bände geben, und lesen Sie was darin über »Romeo und Julia« und über »Wilhelm Meister« gesagt wird. Es ist gar nicht zu läugnen, daß die Schlegel's den Funken, der zuerst durch Lessing entzündet wurde, zur Flamme angefacht, und eine neue Art der Kritik gegründet haben, nämlich die auslegende, ergänzende, nachweisende, statt daß früher die vernichtende, zersetzende, absprechende galt. Der Streit zwischen beiden ist noch nicht ganz ausgefochten, doch neigt sich der Sieg schon sichtbar auf die Seite, welche mir die bessere zu sein scheint.
Der Grundbegriff der Schule, welcher ich auch angehöre, ist: daß man zu einem Kunstwerk nicht mit dem bloßen Verstande, sondern mit dem Einklang aller seiner Kräfte, Phantasie und Gefühl mitgerechnet, treten muß, wenn man es begreifen will, daß man von dem Glaubenssatze ausgeht: alles, was einmal entstand, mußte nach Gesetzen entstehen, und daß man eine unendliche Mannigfaltigkeit der Wege, die das künstlerische Vermögen einschlagen kann, zugiebt. – Hieraus folgen gewisse Maximen. Man wird nichts unbedingt verwerfen, sondern die Gesetze, aus denen sich die einzelne Erscheinung nachweisen läßt, aufsuchen, man wird nicht bei der ersten Lesung oder Anschauung ein Urtheil fällen, sondern zuerst das Werk auf die offene Seele einwirken lassen, und endlich, man wird die kritische Wissenschaft für eine äußerst schwere halten, weil eine große Menge von Erfahrungen, Beobachtungen und Beispielen dazu gehört, um darin nur zu den ersten Resultaten zu gelangen.
Ich steige von meiner Kanzel, auf der ich Ihnen bisher predigte, und Ihre Geduld ermüdete, um Sie zu bitten, den einliegenden Brief an Bilstedt dem Herrn General nebst bester Empfehlung von mir zu geben. – Mit Vergnügen bin ich zu aller ferneren Correspondenz bereit. –
Ein herzliches Lebewohl sagt
Ihr Freund
Immermann.
12
Magdeburg, den 21. März 1824.
Endlich wird sich doch, theure Freundin, der Himmel bei Ihnen entwölkt haben, wie hier geschehen ist, und Sie zu einem heitern Gefühl Ihres Daseins gelangen lassen. Seitdem ich Ihre vom Wetter abhängige Natur kenne, interessirt es mich sehr, und Sie erlauben mir, da es ein Gegenstand von Wichtigkeit ist für Sie, davon zu reden, wenn man gleich dies Gespräch aus der guten Unterhaltung verbannt hat. Freilich sind die Gespräche über die Fehler der Nächsten ein viel interessanteres und reichhaltigeres Kapitel.
Für das übersendete Buch meinen herzlichen Dank, so wie für den Anfang der Uebersetzung. Ich bedaure nur, daß letztere, wie ein unschuldiges Kind, bei dem ersten Kapitel stehen geblieben ist. Meine Arbeit hat gleich wieder begonnen, und es ist auch hohe Zeit damit.
Ich kann mich ganz in Ihr Gefühl und in Ihren Wunsch nach Beschäftigung hineinfinden, und sinne nur, was für Arbeit ich Ihnen rathen soll. Möglich wäre es, daß Sie für Ihre eigne Rechnung den Frauenverein überbieten, und in der Stille Mutter einiger Dürftigen werden könnten, die Ihr Auge wohl zu entdecken im Stande wäre; denn es giebt in allen Orten des Elendes genug. Wohlthätigkeit und Werke der Menschenliebe haben zu allen Zeiten edle Herzen beruhigt. Glück kann die Erfüllung der Pflicht nie schaffen, wer das behauptet, kennt das Leben und das menschliche Gemüth nicht, aber beschwichtigen kann sie, versöhnen und den herben Schmerz mildern. Auch ich ertrüge ein nüchternes, leeres Dasein nicht, wenn nicht jede Stunde ihr beschiednes Theil Arbeit hätte. Diese fortgesetzte Beschäftigung macht mich allein fähig, zu existiren, und es graut mir vor allen Gesellschaften, vor allen Besuchen bei meinen Bekannten und Verwandten in der Gegend, weil solche arbeitslose Stunden und Tage mich sehr unglücklich machen und verstimmen. – Mitunter kommt es mir so vor, als sei unser jetziges Leben und Treiben besonders veraltet und abgenutzt – dann aber lese ich wieder in einem griechischen Tragiker oder in Shakespear Stellen, die nur aus demselben Gefühl entspringen konnten, und es kommt der Trost über mich, daß das Leben zu keiner Zeit ohne Dissonanzen gewesen ist, und daß sich in allen Zeiten Annäherungen zur Harmonie finden lassen.
Man spricht in der hiesigen Militairwelt von Veränderungen. Hake soll abgehn, wohin weiß ich nicht, und das Generalcommando des 4. Armeekorps hieher kommen. Dem Herrn General bitte ich diese Notizen nebst meiner Empfehlung zu sagen, wenn sie ihn interessiren.
Es fehlt hier in Magdeburg gar nicht an Gelegenheit, das charmanteste Leben zu führen, und jeder junge Mann hat es, wie die Tanten behaupten, sich selbst beizumessen, wenn er nicht in Cours kommt; hohe Generalität, Präsidentschaft, Beamte mit unversorgten Töchtern, Kaufleute, welche die Geige spielen u. s. w. alle Ingredienzien, die zum herrlichsten Dasein gehören. Leider hat es Ihrem Freunde noch nicht gelingen wollen, in dieses große Räderwerk als brauchbare Walze einzugreifen. Ich finde, daß die Leute, die ich zufällig kennen gelernt habe, so unendlich mit sich zufrieden sind, daß ein Dritter ihnen nichts mehr bieten kann, und finde es daher angemessen, sie ihrem Reichthum zu überlassen.
Mit herzlichster Erinnerung und Freundschaft
der Ihrige
Immermann.
13
Magdeburg, den 27. März 1824.
An diesem regnichten Nachmittage, liebe Freundin, will ich wenigstens im Geiste mich in heitre Regionen – nämlich zu Ihnen flüchten. Es ist ganz abscheuliches Wetter, so recht zum Todtschießen geeignet, wenn man sonst dazu Gelüst hat.
Nun ist es beinahe ein Vierteljahr her, daß wir getrennt sind, und ich weiß nicht, wo die Zeit blieb. Freilich lebe ich hier auch nur wie im Traume, und meine Existenz hat durchaus kein Interesse und keine Bedeutung. Ich hoffe, es soll anders werden, denn würde es nicht, so wäre es freilich schlimm.
Ich freue mich, daß Ihnen der »Kaufmann von Venedig« einen heitern Abend gemacht. Diese herrliche Dichtung gehört zu dem Besten, was ich kenne. Es giebt Poesien, die wie manche Häuser sind, ohne durch Pracht zu blenden, ziehen sie unwiderstehlich an, man verweilt gern darin, man fühlt sich überall heimisch, und wie in guter, bequemer Gesellschaft. Solch einen Eindruck macht immer das Stück auf mich.
Selbst das Gewitter, welches über den armen Antonio heraufzieht, kann nur mäßig erschrecken, denn man ahnet gleich seine Rettung – wo ein Weib wie Portia mit in die Handlung verflochten ist, da kann nichts untergehn. In dieser Portia spiegelt sich die reinste Weiblichkeit, und jene reizende Mischung von tiefem Gefühl, weicher Herzlichkeit, Schalkheit und einem gewissen Hang zur Intrigue ab, die Ihr Geschlecht auszeichnet. Auch die vielen Freier dienen vortrefflich, die Erscheinung hervorzuheben; wenn man einen Mann bedeutend schildern will, so muß man ihn an der Spitze eines Heers, oder unter einem Haufen von Schülern und Anhängern zeigen, soll dagegen eine Frau recht prächtig erscheinen, so muß sie eine vielumworbene sein. – Bassanio und sie werden ein herrliches Paar machen, recht geschaffen Glück und Glanz um sich zu verbreiten.
Ich möchte wohl wissen, ob jemand schon den Grund von Antonio's Traurigkeit, mit der er gleich Anfangs auftritt, erklärt habe. Die Wirkung derselben ist groß, er steht gleich mit Einem Zuge unter den schwatzenden, lachenden Freunden als eine fremdartige, von ihnen nicht begriffene Erscheinung da, seine schwärmerische Freundschaft für Bassanio, sein sonderbares Pfui! als man ihn fragt, ob er verliebt sei? – alles, der Abscheu vor den Zinsen mit dazugenommen, charakterisirt ihn als einen von denen, mit welchen das Schicksal sich gern eine kleine Belustigung macht, und so bringt er gleich einen ernsten Ton in das sonst so fröhliche Stück.
Der Grund seiner Schwermuth läßt sich leicht finden, wenn man ihn in Beziehung auf seinen Stand betrachtet. Kann es wohl eine schlechtere Anlage zu allem Kaufmännischen geben, als er besitzt? Mit dieser Weichheit, Empfindsamkeit, mit diesem ritterlichen Zuge in der Seele, unter Handel und Wandel, Wechsel und Geldverkehr, muß sich ein stilles Mißbehagen in ihm ausbilden, welches er selbst nicht versteht, wie es seinen Freunden unerklärlich ist.
Nehmen Sie, Beste, heute mit dieser Abhandlung statt eines Briefes vorlieb. Ich habe eben nichts besseres zu geben, und wünschte nur, daß ich mich in Ihrer Nähe von manchem ausheilen könnte, was mein Gemüth bedrängt. Gedenken Sie meiner, wie ich Ihrer gedenke.
Immermann.
14
Magdeburg, Sonntags, den 18. April 1824.
Wenn Sie das Fest, theure Freundin, so heiter verleben, als ich es Ihnen wünsche, muß es Ihnen Festtage bieten. Sie haben nun den Druck der Charwoche überstanden, der auch uns Protestanten dort fühlbar genug wird, der Leib des Herrn ist aus dem Grabe genommen, und die Auferstehung zeigt ihr fröhliches Symbol in den Knospen und Blüthen, die sich schon überall hervordrängen. Ich mag gern ein etwas spätes Ostern, es ist häßlich, wenn das Sommerhalbjahr uns noch mit Schnee und Reif bewillkommnet. – Wie ich bei allem, was mir Gutes begegnet, immer zuerst an Sie denke, so wünschte ich Sie auch in voriger Woche zu mir, da ich die Gewächshäuser des reichen Gutsbesitzers Nathusius in Althaldensleben besah. Sie werden vielleicht von den ausgedehnten Besitzungen und weitgreifenden Wirkungen dieses Mannes gehört haben, der aus einem Bettler ein Millionair wurde, und sein eignes Papiergeld fabricirt, welches bei allen Wechslern Cours hat. Er ist selbst Botaniker, und bei seinen Mitteln lassen sich denn freilich herrliche Pflanzen und Blumen ziehen. Sie würden das alles aber noch vielmehr genossen haben, als ich.
Ein Besuch von Heine fällt in die Zeit, da ich Ihnen nicht geschrieben. Er hat mir einige sehr schöne Gedichte recitirt, von denen eins besonders (eine Rheinfahrt schildernd) mir ungemein gefallen hat. Wenn Sie es lesen wollen, Sie finden es in einer von ihm in den letzten Stücken des »Gesellschafters« abgedruckten Sammlung von 33 Liedern. Es ist das Letzte der Sammlung.
Wenn ich nur durch meine Arbeiten erst durch wäre! Ein und einen halben Band »Ivanhoe« zu übersetzen, einen Aufsatz über das Verhältniß Falstaff's zum Prinzen Heinrich, den ich nothwendig bis zu Johannis liefern muß, zu fertigen, und dabei die Vorbereitungsarbeiten zum dritten Examen zu machen – das ist keine Kleinigkeit. Wenn ich aber erst durch bin, und meine Zwecke damit erreicht habe, dann will ich mir auch wohl sein lassen, und mein Leben genießen.
Leben Sie wohl, meine liebe Freundin, und gedenken Sie Ihres
Freundes
Immermann.
15
(Ohne Datum.)
– Ruhe und Stille werde ich wohl haben im Sommer, ich ziehe in ein Gartenhaus, und werde da ganz für mich leben. Sie trauen Magdeburg gar nichts zu, Sie sehen aber hieraus, daß wir wenigstens Gärten haben. – Was ich Ihnen eigentlich sagen wollte, ist, daß Eßlair hier angekommen ist, um Gastdarstellungen zu geben, heute beginnt er mit dem Wallenstein. Ich freue mich, daß das stockende Leben doch einmal etwas geistig aufgeregt wird, wie sehnlich wünschte ich, mit Ihnen den Genuß zu theilen. Ich werde mich ohne alle Kritik heute Abend in einen Sperrsitz setzen, und das Schöne mit dankbarer Seele empfangen, werde Ihnen auch getreulich berichten, was ich gesehen.
So schmerzlich der Todesfall den alten Möller getroffen haben mag, so war es doch eigentlich ein Glück zu nennen. Die Jugendlichkeit des Alten wird ihn hoffentlich wieder aufrichten. – Der ** hat sich also wieder einen Korb geholt? Er scheint dazu vom Schicksal vorherbestimmt. Leben Sie wohl!
Ihr Freund
Immermann.
16
Magdeburg, den 22. April 1824.
Die Wunder treten uns nahe. Ein Schäferknecht, Namens Gottlieb Grabe, hat in Torgau ein Siechenhaus von Gichtbrüchigen und Lahmen um sich versammelt, heilt durch Berührung verjährte Uebel. Mehrere Hunderte von Kranken befinden sich in Torgau, viele Menschen sind von hieraus hingereist, und was man zu vernehmen bekommt, klingt sonderbar genug. Indessen ist der Schäferknecht bereits denen in die Hände gefallen, welche ein Privilegium haben, das Publikum zu schröpfen, den Obrigkeiten, und sie verfolgen bereits den Unprivilegirten. Von Rechtswegen, denn jedes Gewerk haßt den, der hineinpfuscht.
Was Sie mir von dem Baron von Sydow und seiner goldnen Dose sagen, bestätigt die alte Erfahrung, daß den Narren die Welt gehört. Oft ist mir dieser Mann, so unbedeutend er auch sein mag, ein Gegenstand stiller Betrachtung gewesen. Selbst ein Nichts, drehn sich seine Tage um nichts, er kommt, ohne daß man weiß, warum, und geht, ohne daß wir sagen können, zu welchem Zwecke. Und doch lebt er, ist überall eingeführt, gilt so viel als jeder andere, und bringt sich durch – lauter Dinge, die Andere ebenfalls nur mit Kenntnissen und Kraftanstrengungen erreichen. Ich fürchte, er wird Sie, wenn er von Kopenhagen absegelt, wieder heimsuchen. Jetzt wollte ich mich schon besser fassen, noch immer macht mir die Erinnerung an das Vergangene manche unangenehme Stunde. Sich über einen solchen Paradiesvogel zu ereifern, es war wirklich thöricht! Ein Unglück, daß man selbst so schwerfällig angelegt ist. Wie leicht wäre mir's mein Glück zu machen, könnte ich mich nur von manchen Vorurtheilen befreien. Ich glaube, wenn ich mir recht viel Mühe gäbe, wollte ich wohl Clauren oder Houwald überbieten, und beide bei dem Publico ausstechen, denn ich weiß ja auch, wo deren aesthetische Zwiebeln wachsen – und wäre ein angesehener, wohlhabender Mann, es will aber nicht gehn. Mit den Musen geht es einem, wie mit jedem geistreichen Umgange, im Anfang fürchtet man sich davor, wenn man aber einmal vertraut ist, kann man nicht wieder los, und ist für den Gevatterschnack verdorben.
Von Eßlair habe ich noch nachzuholen, daß er einen sehr großen, würdigen Begriff von der Kunst in sich trägt. So sagte er mir, es sei ein Ehrenpunkt bei ihm, wenn ein Componist einen seiner tragischen Charaktere zu einer Oper verarbeitet habe, denselben zurückzulegen. Er spielt z. B. den »Othello« nicht mehr, seitdem Rossini ihn in Musik gesetzt hat. Er ist auch der Meinung, daß wir dem gänzlichen Verfall aller wahren Kunst mit starken Schritten entgegengehn. Eine tröstliche Ansicht, wenn man noch nicht dreißig Jahr alt ist.
Die anliegenden Briefe theile ich Ihnen unsrer Verabredung gemäß mit. Ich werde von der Post reichlich bedacht; was irgend Interesse hat, erhalten Sie von mir. Leider hat mir Heine die Karte, deren sein Brief gedenkt, von Hitzig nicht mitgesendet, ich würde sonst gewiß die Bekanntschaft gemacht haben.
Ich stehe von der Kälte in meiner Gartenstube etwas aus, und schreibe Ihnen dieses mit frostblauen Händen. Ich komme mir mitunter in meiner Klause vor wie ein in den Polargegenden eingefrorner Seefahrer, und stehe oft in Versuchung die Sommerfreude in Pelzstiefeln und Klappmütze zu genießen. Ein seltsamer Zustand in meinem hiesigen überhaupt seltsamen Leben! Wir wollen beide den Himmel um Phlegma anflehen, ich finde, daß die Phlegmatiker die einzigen Weisen sind. Dagegen ein armer empfindsamer Thor sich fruchtlos abhaspelt, bis ihn der Tod zum unfreiwilligen Phlegmatiker macht.
Leben Sie wohl, theure Freundin, und erhalten Sie mir Ihre Gesinnung.
Immermann.
17
Magdeburg, den 8. Mai 1824.
Wie ich mir es vorgenommen hatte, liebe Freundin, so will ich es ausführen, mich mit Ihnen über Eßlair's Spiel auf der hiesigen Bühne diesesmal unterhalten. Ich beschloß anfangs, an jedem Abend Ihnen den frischen Eindruck hinzuschreiben, indessen ich gab bald diesen Vorsatz auf, da bei einer unerwarteten Erscheinung der Mensch zuerst zu befangen ist, als daß er einem andern ein Bild geben könnte.
Um vom Aeußeren zu beginnen, denken Sie sich einen Mann nahe an den Fünfzigen (so dünkt mich wenigstens sein Alter) in reinen, kraftvollen Verhältnissen aufgebaut, etwas zu viel Embonpoint, welcher jedoch wegen seiner Größe nicht gar zu störend wird, Hände und untere Theile des Körpers von außerordentlicher Schönheit, die Brust eines Löwen, das Gesicht ein herrliches Oval, die Nase groß und gebogen, die dunkeln Augen von unendlichem Feuer, welches durch sehr viel Weißes noch mehr erhöht wird, auf dem Haupte das Zeichen des herannahenden Alters – der Anfang einer Platte – welcher aber, wie dies immer zu sein pflegt, die Verhältnisse des Kopfes um so bedeutender hervorhebt.
Diese Gestalt trat dann am Sonntag vor acht Tagen als »Wallenstein« durch die Flügelthür, in höchst einfacher Kleidung, ruhig majestätisch. Der Anfang des Spiels war ganz gelassen, fast trocken zu nennen, ohne alle Prätention. Nur die große Anmuth aller Bewegungen deutete das Besondre an. Richtiges Einfallen, gutgehaltne Pausen, Benutzung aller Höhe und Tiefe des Theaters gaben dem Zuschauer das Gefühl der Sicherheit, welches der Künstler in sich trug. Was nun aber immer mehr eigentlich fesselte, war der große Sinn, in welchem der Charakter genommen wurde. Ganz vortrefflich entfaltete er denselben in der Scene mit Illo und Terzky, worin er diesen den Traum vor der Lützner Schlacht erzählt. Da trat die Doppelnatur Wallenstein's ganz hervor, die Verachtung der Menschen, welche er unter sich erblickt, und die ahnungsvolle Seite, die den Sternen zugekehrt ist. Die Worte:
»Es giebt im Menschenleben Augenblicke« –
sprach er sonderbar heimlich, die Schauder des herannahenden Schicksals wehten über die Bühne, man fühlte sich in seinem Innersten berührt, man war nun schon ganz in seinen Banden. Unübertrefflich war das Spiel bei dem Aufstande der Truppen, nie werde ich diese Feldherrnstellungen, diese militairische Kürze und Schärfe vergessen. Als er zurückkommt, und alles verloren ist, sprach er die befehlenden Worte an Buttler und an Terzky sehr streng, fast tyrannisch – wie mich dünkt außerordentlich richtig. Denn Wallenstein kann das Unglück nur noch fester und herrischer machen. In der Attitüde, worin er zu Max sprach:
»Wie ist's? Versuchst Du einen Gang mit mir?«
hätte ich ihn mögen gemalt sehen, er stand wirklich wie ein Römischer Imperator da, die Füße übereinander geschlagen, den rothen Mantel halb emporgezogen. Das Herantreten an die Liebenden geschah, ohne daß er auch nur die geringste Bewegung machte, und das Wort: »Scheidet!« wurde ohne allen Affekt gesprochen, wirkte aber eben deßhalb um so furchtbarer. Der Ausdruck in seiner Darstellung, als er den Tod des Max erfährt, war einfach groß. Eine bloße Seitenbewegung und ein Zusammenziehn des ganzen Körpers, dann aber wieder der Schein völliger Ruhe und Fassung. Im fünften Auszug erreichte das Spiel stellenweise seinen Gipfel. Als er am Fenster in die Nacht hinausstarrte, sah man wirklich mit ihm in die unendlichen Tiefen des Himmels, nun sank er mit ungemeiner Grazie über den Stuhl, und das Gesicht zeigte die rührendste Trauer, auch wurden die schönen Worte über Maxens Tod ganz ihrem Werthe gemäß gesprochen. Er hielt sich auf dieser Höhe bis zum Ende, wo er mir die Worte:
»Ich denke einen langen Schlaf zu thun,
Denn dieser letzten Tage Qual war groß,
Sorgt, daß sie nicht zu zeitig mich erwecken.«
doch mit zu viel Wichtigkeit aussprach, da sie nach meiner Meinung ganz leicht und sorglos vorgetragen werden müssen.
Sehr oft erscheint die Schönheit in seinem Spiel, welches das höchste ist, was man von einem Künstler sagen kann, so gewaltig das Wort auch verschwendet und gemißbraucht wird. Das sogenannte interessante und charakteristische Spiel ist noch himmelweit davon verschieden. Es ist offenbar etwas Bedeutendes, wenn man die größte Kraft, Wahrheit und Natur schaut, und alles dieses durch eine Anmuth gemildert, und in einem sanften Reize verklärt wird, so daß man nirgends sich erdrückt, sondern immer erhoben und befreit fühlt. Vor allem zu loben ist seine Action, der Körper ist ganz Muskel, er ist im Stande mit dem kleinen Finger mehr zu machen, als andre, wenn sie mit Armen und Beinen hanthieren. Sein Auftreten und Abgehn ist wahrhaft königlich, er sitzt und steht ganz herrlich. Eine Eigenheit von ihm ist, daß er sich gern über den Stuhl lehnt. – Seine Recitation und Declamation ist nicht so tadelfrei, häufige, fehlerhafte Betonung, mitunter leerer Pathos, entstellen sie. Das Organ leidet, obgleich die Stimme tief und sonor ist, an einiger Rauhheit, und der oberdeutsche Dialect spricht zuweilen durch. Am meisten leistet er im ruhigen, würdevollen, kräftigen Vortrag, auch im Ausdruck des Rührenden, weniger in den leidenschaftlichen Scenen, wo zuweilen Uebertreibung ohne eigentliche Gediegenheit eintritt. Eine köstliche, trockne Ironie hat er in seiner Gewalt, glänzend zeigte er sie in seinem Spiel zu den Frauen im »Wallenstein,« die er sichtlich als Beiwerk behandelte, wie sie es auch in dieser Tragödie sind. –
Montag gab er Kriegsrath Dallner in »Dienstpflicht« – Mitwoch »Wilhelm Tell,« Donnerstag Hugo in der »Schuld,« Freitag den Oberförster in den »Jägern.« Morgen wird »Dienstpflicht« repetirt, dann giebt er noch eine Vorstellung, die bis jetzt unbestimmt ist. – Wallenstein ist mir als die großartigste Erscheinung vorgekommen; obgleich er in den übrigen Stücken, namentlich als Dallner eigentlich viel correcter gespielt hat, so fehlte die von innen nach außen dringende Poesie, welche aber freilich auch nur von einem ächten Dichterwerke hervorgerufen werden kann. Das Publikum zeigt sich im Ganzen theilnehmend, empfängt ihn jedesmal mit Applaus.
Wie sehr hätte ich gewünscht, theure Freundin, daß Sie ihn sehen möchten. Ihr feiner Sinn für das Schöne würde großen Genuß gehabt haben. Alles Gute wünscht, wie Sie wissen, mit Ihnen zu theilen
Ihr Freund
Immermann.