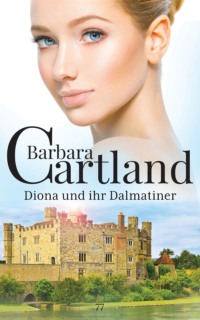Kitabı oku: «Diona und ihr Dalmatiner»
Diona und ihr Dalmatiner
Barbara Cartland
Barbara Cartland E-Books Ltd.
Vorliegende Ausgabe ©2017
Copyright Cartland Promotions 1985
Gestaltung M-Y Books
Inhaltsverzeichnis
1 ~ 1819
Sir Hereward Grantley ließ sich ächzend auf dem großen Sessel nieder und hievte mit schmerzverzerrtem Gesicht seinen von Gicht gepeinigten Fuß auf einen Stuhl. Schweratmend sank er gegen die Rückenlehne des Sessels.
Eben hatte er seine Lage gefunden, die ihm die wenigsten Schmerzen bereitete, als ein Dalmatiner mit wedelndem Schwanz durch den Raum auf ihn zu getrottet kam. Dabei stieß er ein Glas mit Brandy um, das neben Sir Hereward auf einem niedrigen Tischchen stand. Das Glas fiel zu Boden und zerbrach. Sir Hereward wurde von jähem Zorn erfaßt.
„Kannst du nicht auf deinen verdammten Hund aufpassen!“ fuhr er seine Nichte an. „Ich habe dir schon einige Male gesagt, daß er kein Recht hat, sich in diesem Haus herumzutreiben. Ich will ihn hier nicht sehen. Er soll in seiner Hütte bleiben.“
Diona hob die Glassplitter auf und warf sie in einen Papierkorb.
„Es tut mir leid, Onkel Hereward“, versicherte Diona. „Sirius hat es ja nicht böse gemeint. Er wollte dich nur begrüßen, weil er dich gernhat.“
„Ich habe genügend eigene Hunde, ich brauche deinen Köter nicht. Entweder bleibt er in seiner Hütte, oder ich werde ihn aus dem Weg räumen lassen.“
Diona unterdrückte einen Laut des Entsetzens.
„Ich finde, das ist eine gute Idee, Papa“, sagte eine Stimme vom anderen Ende des Raumes. „Hunde im Haus sind ein Ärgernis. Ich habe Sirius schon durch die Wälder jagen sehen. Das stört die Vögel, die dort ihre Nester gebaut haben.“
„Das ist nicht wahr!“ protestierte Diona. „Sirius läuft draußen nie ohne mich, und da ich weiß, daß die Vögel zur Zeit brüten, haben wir uns von den Wäldern ferngehalten.“
„Ich habe ihn mit eigenen Augen gesehen.“
Diona wußte, daß ihr Cousin Simon log, und sie kannte auch den Grund dafür.
Seit sie in das große häßliche Haus gezogen war, das ihrem Onkel gehörte, hatte Simon sie mit Annäherungsversuchen belästigt. Als sie ihm klargemacht hatte, daß er sie in Ruhe lassen sollte, war er gehässig geworden und hatte ihr nur Schwierigkeiten bereitet.
Diona war sich wohl bewußt, daß Simon seinen Ärger über sie an Sirius auslassen wollte. Zwei Abende zuvor hatte Simon versucht, Diona auf der Treppe zu küssen. Sie hatte sich gegen seine Zudringlichkeiten gewehrt, und als sie gemerkt hatte, daß er stärker war als sie, hatte sie ihm heftig auf den Fuß getreten, so daß Simon vor Schmerz und Wut aufgeschrien hatte.
Während sie vor ihm davongelaufen war, hatte sie ihm noch zugerufen: „Laß mich in Frieden! Ich hasse dich, und wenn du noch einmal versuchst, mich anzufassen, werde ich es Onkel Hereward sagen.“
Simon hatte nur auf eine Gelegenheit gewartet, Rache zu nehmen. Langsam erhob er sich vom Tisch, wo er gierig und hemmungslos wie immer sein üppiges Frühstück verzehrt hatte, und trat lässig zu seinem Vater.
„Laß den Hund aus dem Weg räumen, Papa“, sagte er wieder. „Ich werde Heywood bitten, daß er ihn erschießen soll, so wie er Rufus erschossen hat, als er zu alt wurde.“
„Niemand darf meinen Hund erschießen“, rief Diona erregt. „Er ist noch jung, er ist auch nicht ungeschickt. Außerdem ist es das erste Mal, daß er im Haus etwas umgestoßen hat.“
„Du meinst, es ist das erste Mal, daß wir es bemerkt haben“, bemerkte Simon ironisch.
Diona schaute ihren Onkel an.
„Bitte, Onkel Hereward, du weißt, wie sehr ich Sirius liebe und wieviel er mir bedeutet. Er ist das einzige, was mir von meinem Vater geblieben ist.“
Während Diona noch sprach, wußte sie, daß sie einen Fehler begangen hatte. Sir Hereward Grantley hatte seinen jüngeren Bruder Harry nie gemocht. Harry war in der Grafschaft nicht nur beliebter gewesen, er war auch ein besserer Sportler und Schütze gewesen, und er hatte auch bedeutend besser ausgesehen als Hereward. Manchmal hatte Diona das Gefühl, ihr Onkel war in Wahrheit froh darüber, daß ihr Vater bei dem Versuch, ein ungezähmtes Pferd über ein hohes Hindernis zu reiten, zu Tode gekommen war.
Es war ein Unfall gewesen, wie er nur einmal in hundert ähnlichen Situationen geschehen konnte, und es war unfaßbar, daß ausgerechnet ihr Vater, der ein so erfahrener, besonnener Reiter gewesen war, einen so unglücklichen Sturz verursacht haben sollte.
Die gesamte Grafschaft hatte um Harry Grantley getrauert. Diona hatte danach oft den Eindruck gehabt, daß ihre Mutter in demselben Augenblick gestorben war. Sie war völlig apathisch geworden, hatte gekränkelt und war ein Jahr nach dem Tod ihres Mannes beerdigt worden. Für Diona hatte das bedeutet, daß sie das Haus verlassen mußte, in dem sie und ihre Eltern so glücklich gewesen waren.
In Dionas Elternhaus schien stets die Sonne geschienen zu haben, während das riesige, zugige und kalte Herrschaftshaus, in dem die Grantleys seit über dreihundert Jahren lebten, dunkel und unheimlich wirkte.
Diona wohnte noch nicht lange auf dem Besitz, als sie schon merkte, daß ihr Leben durch Simon zur Qual zu werden drohte. Der einzige Punkt, in dem Sir Hereward sich seinem toten Bruder überlegen fühlte, war der, daß er einen Sohn gezeugt hatte, während Harry es nur zu einer Tochter gebracht hatte.
Nun war Simon unglücklicherweise kein Sohn, auf den ein Vater besonders stolz sein konnte. Mit seinen vierundzwanzig Jahren stand er auf der geistigen Stufe eines dummen Jungen von sechzehn Jahren. Er zeichnete sich in nichts aus - herausragend war allenfalls seine Freßsucht: Die Portionen, die er verschlang, konnten normalerweise nur drei ausgewachsene Männer zusammen bewältigen.
Sollte sein Vater sterben, würde Simon der sechste Baron Grantley werden, und da keine Hoffnung bestand, daß Dionas halbinvalide Tante weitere Kinder gebar, schickte Sir Hereward sich in das Unvermeidliche.
Er gab Simon in jeder Hinsicht nach, er verwöhnte ihn und hoffte wohl, daß er ihn durch stete Ermutigungen, noch selbstsüchtiger zu sein, als er ohnehin schon war, durch irgendein Wunder in einen Mann verwandeln konnte.
Diona, die sehr einfühlsam war, benötigte nur wenige Tage, um die Sorgen ihres Onkels zu begreifen, und sie empfand tiefes Mitleid mit ihm. Ihre persönliche Lage verbesserte sich dadurch allerdings nicht. Da sie nicht nur außergewöhnlich hübsch, sondern auch intelligent war, merkte sie bald, daß allein schon ihr Anblick den Onkel nur ärgerte. Wie er einst seinen Bruder Harry abgelehnt hatte, so lehnte Sir Hereward nun Diona ab.
Sie konnte ihn durch nichts erfreuen, und selten verging ein Tag, an dem ihr Onkel sie nicht beschimpfte, gewöhnlich wegen irgendeiner Kleinigkeit, oder weil er seinen aufgestauten Ärger an irgendjemandem auslassen wollte.
Seine Frau lag den ganzen Tag klagend und weinend in ihrem Bett. Es bestand keine Aussicht auf Genesung.
Da Sir Hereward regelmäßig dem Alkohol zusprach, litt er unter heftigen Gichtanfällen. Sein Bein war zu doppeltem Umfang angeschwollen, und in jüngster Zeit griff die Krankheit auch auf die Hände über.
Endlich hatte er wieder einmal ein Opfer für seinen Ärger gefunden.
„Du hast recht“, stimmte er seinem Sohn zu. „Sag Heywood, er soll uns den Hund noch heute abend vom Hals schaffen. Ich habe nicht die Absicht, mir die Herbstjagd von diesem Vieh verderben zu lassen.“
Diona sank neben dem Sessel in die Knie und flehte: „Das kannst du nicht wollen, Onkel Hereward! Du kannst doch nicht so - so grausam sein. Du weißt, wieviel Sirius mir bedeutet.“ Sie hatte mit so weicher und trauriger Stimme gesprochen, daß sie einen Augenblick lang glaubte, Sir Hereward würde sich erbarmen.
Da mischte Simon sich erneut ein: „Dieser Hund jagt hinter allem her was läuft. Erst gestern habe ich gesehen, wie er hinter den Hühnern her war. Wenn wir keine Eier mehr zum Frühstück haben, dann ist es seine Schuld.“
„Das ist eine Lüge! Eine Lüge!“ rief Diona.
Doch Simon konnte triumphieren. Sir Hereward hatte seine Entscheidung getroffen.
„Gib Heywood die Anweisung“, sagte er zu seinem Sohn. „Er soll dafür sorgen, daß die Wildhüter alles erschießen, sei es Hund oder Katze, was sie in den Wäldern entdecken.“
Diona kannte diesen entschlossenen Ton. Es hatte keinen Sinn, ihn länger zu bitten. Sie hätte schreien mögen, angesichts der Grausamkeit und Ungerechtigkeit ihres Onkels, doch sie stand nur auf und verließ mit mühsam bewahrter Würde das Frühstückszimmer. Der Triumph und die Genugtuung in Simons Blick entgingen ihr nicht.
Erst als sie die Tür hinter sich geschlossen hatte und draußen in der Eingangshalle stand, begann sie wie gehetzt die Treppe hinaufzulaufen, gefolgt von Sirius.
Er war ein Geschenk ihres Vaters, das er ihr kurz vor seinem Tod gekauft hatte. Sirius war ein quirliger Welpe gewesen, bei dem sich die schwarzen Flecken auf dem weißen Fell bereits zeigten, da er älter als zwei Wochen war. Seine Augen konnten rührend um Liebe betteln, so daß Diona ihn fest an sich drückte. Einen Hund wie Sirius hatte sie sich immer gewünscht.
Als ihr Vater und bald darauf ihre Mutter gestorben waren, hatte Sirius sie getröstet. Er hatte über ihre Wangen geleckt und sich an sie geschmiegt, während sie in hilfloser Verzweiflung weinte. Er schien zu wissen, daß Diona ohne ihn völlig allein wäre auf der Welt.
Sie hatte noch weitere Verwandte, doch keiner lebte in der Grafschaft, und keiner war in der Lage, Diona ein Heim anzubieten. Zudem war sie völlig mittellos.
Ihr Vater hatte jeden Penny seines kleinen Vermögens für Pferde ausgegeben, die er trainieren und dann mit Gewinn verkaufen wollte. Die ersten drei, vier Pferde, die er gekauft hatte, übertrafen seine Erwartungen, und er plante, ein richtiges Gestüt aufzubauen.
„Vielleicht scheint es übertrieben“, hatte er zu seiner Frau gesagt, „aber ich habe die Möglichkeit, einige ungewöhnlich gute Rassetiere von dem Gut eines alten Freundes in Irland zu kaufen, der gerade Bankrott gemacht hat. Ich wäre dumm, wenn ich mir diese Gelegenheit entgehen ließe.“
„Natürlich, Liebster“, hatte seine Frau erwidert. „Keiner hat ein besseres Gefühl für Pferde als du. Ich bin sicher, daß sie guten Profit abwerfen werden.“
Aufgrund seiner bisherigen Erfahrung vertraute Harry Grantley seinem Können, und als die Tiere eintrafen, zeigte sich, daß sie noch mehr Klasse besaßen, als er gehofft hatte. Natürlich waren sie ausnahmslos wild, und es war ein hartes Stück Arbeit gewesen und hatte schier endlose Geduld erfordert, sie zu zähmen. Für Diona war es immer ein Erlebnis gewesen, ihrem Vater bei der Arbeit zuzusehen. Er hätte sie niemals ein Pferd reiten lassen, wenn er nicht von Dionas Sicherheit überzeugt gewesen wäre. Trotzdem wußte Diona, daß sie eine außergewöhnlich gute Reiterin war. Sie hatte schon im Sattel gesessen, als sie gerade erst zu laufen begonnen hatte.
Eines der irischen Pferde war es gewesen, das ihren Vater getötet hatte. Da die meisten Pferde des Gestüts noch nicht gezähmt waren, erzielte Dionas Mutter beim Verkauf dieser Tiere kaum noch das, was sie einmal gekostet hatten. Dennoch schafften sie es, in den folgenden Monaten nach dem Tod ihres Vaters einigermaßen über die Runden zu kommen.
Diona blieb es nicht verborgen, daß ihre Mutter immer mehr abmagerte und daß es ihr zunehmend schwerer fiel, sich für irgendetwas außer ihrer Tochter zu interessieren. Schon ein Lächeln wurde für sie zur Anstrengung, zu einem Lachen gar war sie nicht mehr fähig. Obwohl ihre Mutter sich tagsüber tapfer zusammennahm, wußte Diona, daß sie den größten Teil ihrer Nächte in Tränen verbrachte, mit denen sie ihren geliebten Ehemann betrauerte.
Später hatte Diona sich oft gefragt, ob sie es nicht vermocht hätte, ihre Mutter zu retten. Doch wenn sie darüber nachsann, wußte sie, daß ihre Mutter nicht eigentlich körperlich krank gewesen war. Sie hatte einen seelischen Zusammenbruch erlitten, der es ihr unmöglich gemacht hatte, ohne den Mann weiterzuleben, den sie geliebt und mit dem sie ihr Leben geteilt hatte.
Wenigstens waren sie zusammen glücklich, dachte Diona in der Kälte, die ihr überall im Haus ihres Onkels begegnete. Bis zu diesem Zeitpunkt war ihr nicht bewußt gewesen, daß nicht Ziegelsteine und Mörtel ein Haus zu einem Heim machen, sondern die Menschen, die darin leben.
Grantley Hall hätte ein schönes Haus sein können, denn Dionas Onkel war ein reicher Mann, und die Möbel und die Bilder, die er geerbt hatte, waren Prachtstücke verschiedener Epochen, die sich zu einer Familiensammlung zusammengefügt hatten.
Doch weil ihr Onkel ein schwieriger und enttäuschter Mann war, in dessen Leben es kein Glück gab, erschien Diona das ganze Haus so dunkel und so kalt wie die Herzen derer, die darin lebten.
Selbst das Personal war alt und mürrisch. Es mochte keine Befehle entgegennehmen, fürchtete aber andererseits, auf einen Protest hin, die Stellung zu verlieren.
In den Ställen von Grantley Hall waren einige ausgezeichnete Pferde untergebracht, und in den Zwingern sprangen die Hunde herum. Doch Diona fand, daß selbst diese Tiere sich von den Pferden ihres Vaters und den Hunden, die sie so sehr liebte, unterschieden, denn da gab es niemanden, der sich für sie als Lebewesen interessierte.
Anfangs hatte ihr Onkel eingewilligt, daß Sirius neben ihrem Bett schlief und ihr überallhin folgen durfte. Dann brachte Simon ihn gegen den Hund auf, so daß er Sirius fast nur noch als „verdammten Köter, der uns noch Haus und Hof wegfrißt“ beschimpfte. Damit spielte er taktlos auf die Tatsache an, daß Diona kein eigenes Geld besaß und er nach dem Tod von Dionas Mutter die Schulden ihres Vaters bezahlt hatte. Wenn die Summe der offenen Rechnungen auch nicht groß war - Mrs. Grantley hatte Monat für Monat in Raten die Schulden abbezahlt -, so war Sir Hereward doch sehr ungehalten darüber. Auch den Bediensteten gegenüber, die ihre Eltern beschäftigt hatten, verhielt er sich nicht sozial. Drei von ihnen wurden entlassen, während ein älteres Paar sich vorläufig um das Haus kümmern sollte.
„Ihr könnt hierbleiben“, hatte Sir Hereward zu den alten Leuten gesagt, „bis ich einen Käufer für dieses Anwesen gefunden habe. Dann werde ich wohl eine Hütte für euch suchen müssen. Ansonsten, das ist wohl klar, bedeutet das für euch das Armenhaus.“
Diona protestierte zwar über seine Art, wie er mit diesen Menschen umging, doch sie konnte nichts dagegen tun. Wenn Sir Hereward seine Drohung mit dem Arbeitshaus auch nicht wahrmachen würde, so genügte doch bereits die Ankündigung, um die alten Leute einzuschüchtern und ihnen schlaflose Nächte zu bereiten. Bevor sie ging, hatte Diona den beiden versprochen, alles zu tun, um ihnen zu helfen, falls das Haus verkauft würde.
„Ich persönlich halte einen Verkauf für wenig wahrscheinlich“, hatte sie gesagt, um das Paar aufzumuntern. „Nicht viele Menschen würden in einer so einsamen Gegend leben wollen, und Papa mochte das Haus nur deshalb so sehr, weil er in seiner Umgebung so gut ausreiten konnte.“
Diona wußte, daß ihr Vater seinem Bruder und Grantley Hall nahe sein wollte, wo er als Junge so glücklich gewesen war.
Als sein Vater noch lebte und bevor er zur Armee ging, waren Harry und seine Freunde auf Grantley Hall immer willkommen gewesen. Einige Jahre später hatte er eine Frau geheiratet, in die er unsterblich verliebt gewesen war.
Im Jahr des Friedens zwischen England und Frankreich, 1802, war Dionas Vater auf das kleine Gut gezogen, weil er, wie er optimistisch verkündete, eine große Familie gründen wollte. Vielleicht war er enttäuscht gewesen, daß ihre Ehe nur mit einem Kind gesegnet war, und das war auch noch eine Tochter, doch hatte er es Diona niemals fühlen lassen.
Erst nach dem Tod ihres Vaters kam es Diona manchmal in den Sinn, daß er lieber einen Sohn gehabt hätte, der die Baronetswürde hätte übernehmen können. Da ihr Onkel keinen älteren männlichen Erben hatte, würde ihr Cousin Simon eines Tages diesen Rang einnehmen. Für Diona war dies eine logische Abfolge, nur betrübte es sie, daß Simon offensichtlich nicht ganz normal war.
Nein, es hatte keinen Sinn, an Wenn und Aber zu denken. Sie mußte sich dem trostlosen Alltag auf Grantley Hall stellen, auch wenn sie sich verzweifelt fragte, ob sie überhaupt eine Zukunft hatte. Wenn ihr Onkel wieder einmal besonders unfreundlich zu ihr gewesen war, lag Diona nachts wach und überlegte, ob sie sich ihren Lebensunterhalt nicht selbst verdienen konnte. Oder ob sie es wagen dürfte, ihren Verwandten zu schreiben und sie zu bitten, bei ihnen leben zu dürfen.
Diona hatte das Gefühl, er wollte sie nicht bei sich haben, würde sie aber andererseits am Weggehen hindern.
„Ich bin dein Vormund, und du tust, was ich sage.“
Das war einer seiner Lieblingssätze. Offensichtlich wollte er der Tochter seines Bruders nur ihre Abhängigkeit beweisen.
Diona liebte das Landleben, wie es ihre Eltern geliebt hatten, die das aufregende Leben Londons nie vermißten, wenngleich sie dort auch immer wieder ihren gesellschaftlichen Pflichten nachkommen mußten.
Ihre Mutter hatte einmal davon gesprochen, Diona bei Hofe vorzustellen, sie auf Bälle und Empfänge mitzunehmen und sie nach Beendigung ihrer Schulausbildung zur Debütantin zu machen, doch ihr Vater war sechs Monate vor ihrem achtzehnten Geburtstag gestorben. Nun näherte Diona sich schon dem neunzehnten Geburtstag, ohne jemals einen Ball besucht oder London gesehen zu haben.
Als Diona noch ein Kind gewesen war, hatte es in der Grafschaft natürlich Partys gegeben, zu denen ihre Mutter sie mitgenommen hatte. Als Diona jedoch älter wurde, genoß sie es viel mehr, ihrem Vater bei den Pferderennen zuzusehen oder im Winter zu jagen. Dort traf sie jedes Mal eine Menge Leute, auch solche, die dem Landadel angehörten.
Ihr Vater war von den Yeoman-Farmern bewundert worden. Sie nannten Diona die „hübsche kleine Miss Grantley“, zogen vor ihr den Hut und luden sie auf ihren Hof zu frischem Brot ein, das ihre Frauen gebacken hatten, bestrichen mit goldgelber Butter, die aus der Sahne frischer Kuhmilch hergestellt war.
Doch so freundlich die Bauern auch waren, sie waren nicht die Freunde, die ihre Mutter sich für Diona gewünscht hatte.
„Ich möchte, daß du den gleichen Erfolg hast wie ich, als ich Debütantin war“, sagte Mrs. Grantley. „Ich bin nicht eingebildet, wenn ich dir verrate, daß ich sehr verehrt worden bin und daß eine ganze Anzahl von sehr charmanten und reichen jungen Männern meinen Vater gefragt haben, ob sie mir den Hof machen dürften.“
„Heißt das, daß sie dich heiraten wollten, Mama?“
„Ja, aber ich wollte sie nicht heiraten“, hatte ihre Mutter erwidert. „Ich wartete, obwohl ich nicht wußte worauf, bis ich deinen Vater kennenlernte.“
„Und dann?“
„Dann verliebte ich mich in ihn. Er war der schönste und aufregendste Mann, den ich je gesehen hatte.“ Mrs. Grantley hatte geseufzt, bevor sie hinzugefügt hatte: „Ich wünschte, du hättest ihn in seiner Uniform sehen können. Jedes Mädchenherz hat bei seinem Anblick schneller geschlagen.“
„Und hat er sich auch in dich verliebt?“ hatte Diona gefragt.
„Auf den ersten Blick“, hatte ihre Mutter erwidert. „Und ich kann mir nicht vorstellen, daß zwei Menschen glücklicher sein können, als wir es sind.“
Und dieses Glück vermißte Diona jetzt, ein Glück, das wie der Sonnenschein strahlte. Sie konnte sich nicht daran erinnern, daß der Himmel während ihrer Kindheit einmal grau gewesen war und der Regen gegen die Fensterscheiben getrommelt hatte.
Jetzt, als sie, gefolgt von Sirius, in ihr Schlafzimmer lief und die Tür schloß, hatte sie das Gefühl, als müßte sie sich ihren Weg durch schwarzen Nebel kämpfen, der sie zu ersticken drohte.
Sie warf sich auf die Knie und schlang die Arme um Sirius, während ihr die Tränen über die Wangen liefen.
Der Hund fühlte, daß etwas nicht in Ordnung war, und leckte ihre Tränen fort. Diona wußte, daß sie ihn nicht verlieren durfte, denn wenn sie ihn verlor, q dann mußte auch sie sterben, da sie dann nichts mehr hatte, wofür es sich zu leben lohnte.
Als sie Sirius’ warmen Körper eng an den ihren drückte, erwachte in ihr plötzlich etwas Starkes und Entschlossenes, ein Gefühl, das sie noch nie zuvor gekannt hatte.
Sie war so unglücklich gewesen, als sie in das Haus ihres Onkels gekommen war, daß sie das Elend akzeptierte wie ein Kreuz, das sie tragen mußte, da sie keine andere Wahl hatte. Wenn sie für etwas geschimpft worden war, was sie gar nicht getan hatte, dann hatte sie keinen Sinn darin gesehen, sich zu wehren, sondern hatte sich entschuldigt und Besserung versprochen.
Jetzt wußte sie, daß sie kämpfen mußte, nicht nur für sich, sondern auch, um Sirius zu retten.
Sie drückte Sirius noch einmal an sich, woraufhin er erneut über ihr Wange leckte und wedelte, sich dann hinsetzte und sie flehentlich anblickte, als ob er ihr vorschlagen wollte, daß sie mit ihm einen Spaziergang an der frischen Luft machte.
„Genau das werden wir tun, Sirius“, sagte Diona zu ihm. „Wir werden spazieren gehen und nicht zurückkommen. Warum habe ich nicht schon früher daran gedacht!“
Sie stand auf und versperrte die Tür, um nicht überrascht zu werden. Dann breitete sie auf dem Bett ein großes seidenes Tuch aus, das ihrer Mutter gehört hatte, und begann alles auf das Tuch zu legen, was sie für absolut notwendig hielt. Sie wußte, daß sie nicht viel mitnehmen durfte, da die Last sonst zu schwer werden würde. Sie wählte deswegen nur leichte Sachen, darunter zwei Musselinkleider. Und trotzdem wurde das Bündel beträchtlich groß, als sie die Tuchzipfel zusammenknotete.
Sie zögerte nur kurz. Schließlich schlüpfte sie in ihr bestes Kleid sowie in ihr neues Paar Schuhe und setzte den hübschesten Hut auf, der ihrer Mutter gehört hatte.
Sie hatte die Trauerkleidung vor einem Monat abgelegt, da ihr Onkel in einem Wutanfall geäußert hatte, daß er es nicht ausstehen könne, wenn eine„schwarze Krähe“ in seinem Haus herumflatterte. Von dem Geld, das er ihr gegeben hatte, damit sie sich kurz nach ihrem Einzug ins Haus Trauerkleider kaufen konnte, hatte sie noch einen kleinen Betrag übrig, und da sie die Kleider eben nicht lange hatte tragen können, waren sie noch verhältnismäßig neu. Darüber war Diona jetzt froh, denn sie wußte, daß ihre Kleidung noch lange halten mußte.
Diona konnte es allerdings nicht übers Herz bringen, sich von den paar Schmuckstücken zu trennen, die ihrer Mutter gehört hatten. Da waren der Verlobungsring, eine Brosche mit Diamanten, die ihr Vater seiner Frau bei Dionas Geburt geschenkt hatte, und ein ziemlich häßlicher, aber wertvoller Armreif, den ihre Mutter von ihrer Mutter geerbt und den sie des Andenkens wegen nie verkauft hatte.
„Wenn ich diese Schmuckstücke verkaufe, kann ich Sirius eine ganze Weile lang durchfüttern“, sagte Diona laut vor sich hin, steckte Schmuck und Geld in einen Beutel, den sie an ihr Handgelenk hängte, und nahm ihr Bündel auf. Während sie die Tür aufsperrte, flüsterte sie Sirius zu, mit ihr zu kommen.
Sirius glaubte natürlich, sie würden einen Spaziergang machen, und sprang vor Freude immer wieder hoch, doch Diona hieß ihn, ruhig zu sein, und er verstand.
Diona mied den Küchenbereich, denn sie wußte, daß um diese Tageszeit dort die Bediensteten ihr zweites Frühstück einnahmen.
Kaum hatte sie das Haus verlassen, schritt sie schnell die rückwärtige Auffahrt entlang, die von keinem der Haupträume des Hauses gesehen werden konnte. Diese Auffahrt war auch nicht so breit und beeindruckend wie die mit Eichen gesäumte Hauptauffahrt zur Vorderseite des Hauses.
Diona eilte über die Wiese, während Sirius ein kurzes Stück von ihr entfernt nach Kaninchen suchte. Er war jedoch sofort an ihrer Seite, sobald sie ihn rief.
Diona brauchte ungefähr zehn Minuten, um das Pförtnertor zu erreichen, das nicht so groß und stabil gebaut war wie das des Haupteingangs. Diona wußte, daß das alte Paar, das in dem Pförtnerhäuschen wohnte, recht nachlässig war und nur selten das Tor schloß, nämlich nur dann, wenn es ausdrücklich angeordnet worden war.
Von den beiden war nichts zu sehen, und da Diona auch nicht gesehen werden wollte, huschte sie durch das Tor und auf die staubige Straße hinaus.
Einen Augenblick zögerte sie und überlegte, wohin sie sich wenden sollte. Da entdeckte sie einen Pferdekarren, der aus Richtung des Dorfes kam.
Voller Freude erkannte sie den alten Fuhrmann und lief ihm entgegen.
Jeder im Dorf kannte den alten Ted, dessen einzige Aufgabe darin bestand, Pakete und Gutsprodukte von Dorf zu Dorf zu fahren.
Jetzt zügelte er sein stämmiges Pferd und rief: „Guten Morgen, Miss Diona. Kann ich Ihnen helfen?“
„Könnten Sie mich bitte mitnehmen?“ fragte Diona.
„Wohin wollen Sie denn?“ fragte Ted zurück.
„Das sage ich Ihnen sofort.“
Noch während Diona sprach, kletterte sie auf den Karren und setzte sich neben Ted. Hinter ihr war der Wagen voll von jungen Küken in vergitterten Kisten.
Ted nahm Diona das Bündel aus der Hand, legte es vor ihren Füßen auf den Boden und setzte den Karren in Gang.
„Ich habe Sie lange nicht mehr gesehen, Miss Diona“, sagte Ted. „Ihr Hund sieht sehr gut aus.“
Sirius war schnell hinter Diona auf den Karren gesprungen, und da es ihm nicht gefiel, auf dem Boden zu sitzen, war Diona näher an Ted herangerückt, um Sirius neben sich Platz zu lassen. Sofort erwachte das Interesse des Hundes für alles, was um ihn herum vor sich ging, und er schaute neugierig nach rechts und links.
Diona legte schützend den Arm um ihn und fragte: „Wohin fahren Sie, Ted? Weit weg, hoffe ich.“
„Sehr weit weg“, entgegnete Ted. „Ich bringe diese Küken zu einem der Gutshöfe des Lords. Ich werde wohl den ganzen Tag fahren müssen.“
„Zum Gutshof des Lords?“ fragte Diona.
Ted nickte.
„Zum Marquis von Irchester“, sagte er. „Die Küken sind für seine Farm bestimmt.“
„Für den Marquis von Irchester“, wiederholte Diona.
Sie kannte den Namen natürlich, wenn sie auch den Marquis selbst noch nie gesehen hatte. Sie wußte, daß sein Gut in der angrenzenden Grafschaft und näher bei London gelegen war. Dionas Vater hatte davon gesprochen, daß der Marquis ausgezeichnete Rennpferde besaß, und erst vor kurzem hatte sie in der Zeitung gelesen, daß er das große Rennen in Newmarket gewonnen hatte.
Sie fuhren ein Stück schweigend dahin, bevor sie sagte: „Halten Sie es für möglich, Ted, daß ich eine Anstellung auf einem der Gutshöfe des Marquis erhalte?“
„Eine Anstellung, Miss Diona? Warum sollten Sie denn arbeiten wollen?“ rief Ted überrascht.
„Ich bin weggelaufen, Ted.“
„Warum wollen Sie gehen und so etwas tun? Ihr Vater hätte nicht gewollt, daß Sie das tun.“ Er machte eine Pause, bevor er hinzufügte: „War ein feiner Reiter, Ihr Vater. Ich habe ihn oft beim Ausreiten gesehen oder wenn er Ihren Onkel in Hall besucht hat. Niemand konnte besser auf einem Pferd sitzen als er.“
„Das stimmt“, sagte Diona. „Aber Ted, ich muß weggehen. Onkel Hereward hat befohlen, daß Sirius erschossen wird.“
Der alte Ted starrte sie an, als wollte er seinen Ohren nicht trauen.
Dann rief er: „Das ist nicht gerecht. Ihr Hund ist jung. Es gibt keinen Grund, weshalb er erschossen werden sollte.“
„Papa hat ihn mir geschenkt, kurz bevor er ums Leben kam“, sagte Diona. „Und - und ich kann ihn nicht - verlieren. Ich kann es einfach nicht.“
„Natürlich nicht“, pflichtete Ted ihr bei. „Vielleicht könnte sich jemand anderer um den Hund kümmern.“
„Das wäre noch schlimmer“, meinte Diona. „Er war immer mit mir zusammen, und ich hätte Angst, daß jemand grausam zu ihm ist und ihn nicht ordentlich füttert. Das wäre - unerträglich für mich.“
Der Ausdruck ihrer Stimme verriet mehr von ihren Gefühlen als ihre Worte.
„Sie können für sich selbst sorgen. Miss Diona“, sagte Ted schließlich. „Haben Sie niemanden, zu dem Sie gehen und den Hund mitnehmen könnten?“
„Ich habe schon daran gedacht“, erwiderte Diona, „aber ich glaube, Onkel Hereward würde darauf bestehen, daß ich zu ihm zurückkehre, und dann hätte ich keine Chance mehr, Sirius zu retten.“
Es entstand eine Pause, während der Ted alle ihre Worte verarbeitete.
Endlich fragte er: „Was haben Sie vor, Miss Diona?“
„Ich kann auf einem Gut arbeiten.“
„Aber Sie verstehen nichts von der Landwirtschaft“, erinnerte Ted sie.
„Ich kann es lernen.“
Wieder entstand eine lange Pause, während der das scheckige Pferd in stetem Trott über die Straße trabte. Welches Wetter auch immer herrschte, Ted führte seine Aufträge stets gewissenhaft aus.
Diona sprach ihre Gedanken nun laut aus: „Worin ich mich auskenne, das sind Pferde und natürlich Hunde.“
„Seine Lordschaft hat ein paar herrliche Hunde“, bemerkte Ted. „Jagdspaniels zum größten Teil.“
Diona wurde ganz aufgeregt und wandte sich an ihn: „Vielleicht braucht er jemanden, der sich um seine Hunde kümmert?“
„Er hat schon Hundewärter.“
„Warum keine Hundewärterin?“ fragte Diona.
„Davon habe ich noch nie gehört.“
„Es gibt bestimmt viele Berufe, die eine Frau genauso ausüben kann wie ein Mann“, beharrte Diona. „Ich könnte mich um die Welpen kümmern und die ausgewachsenen Hunde pflegen, wenn sie krank sind. Ich kann die gesunden Hunde dressieren, so wie das jeder Mann auch könnte.“
Lange Zeit herrschte Schweigen, bis Ted langsam meinte: „Ich habe gerade an all die Häuser gedacht, in denen es Hunde und Pferde gibt, und ich habe noch nie gesehen, daß Frauen mit ihnen arbeiten.“
„Es gibt aber keinen Grund, weshalb sie eine Frau nicht anstellen sollten, wenn sie die Gelegenheit dazu haben. Die Bauern haben auch ihre Melkerinnen. Warum soll es dann keine Hundewärterinnen oder Stallmägde geben?“
Ted nahm die Zügel in eine Hand und kratzte sich mit der anderen am Kopf.
„Sie fragen mich das so, aber ich weiß nicht, weshalb es keine geben sollte. Aber ich weiß jedenfalls, daß es sie im Augenblick noch nicht gibt. Jedenfalls habe ich noch keine gesehen.“