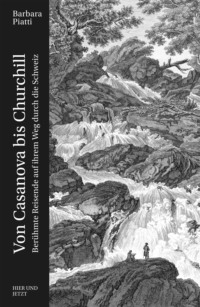Kitabı oku: «Von Casanova bis Churchill», sayfa 4
Auszüge aus Jens Immanuel Baggesens «Rousseau’s Insel oder St. Peter im Bielersee», 1795
Von einer der höchsten Spitzen des Jura über das Thal Fraimvilliers hin, auf dem Birs- und Susa-Wege von Basel nach Biel, übersieht man die Gegend, worin die von einem spiegelhellen See umflossene St. Peters Insel liegt. Die lachende Herrlichkeit, in welcher sich dieses kleine Eiland im vollen Sonnenglanze darstellt, geht über alle Beschreibung. Ein Reichthum von Reitzen entfaltet sich dem erstaunten Auge, der mit verdoppeltem Zauber den Wanderer überwältigt, wenn er von dem engen, von steilen Klippen eingeschlossenen Labyrinthe aus dem Münsterthale ersteigt – und plötzlich mit einem Blick ein Amfitheater von ungefähr 80 Meilen im Umfange übersieht. Welche Mannigfaltigkeit! welche Abwechselung! Fruchtbare, gartenmässig angebaute Gefilde, von der Aar, Emme und Zihl durchströmt! Solothurn, Nidau, Biel, zahlreiche Dörfer, Meyerhöfe und einzelne Bauerstellen, hingestreut unter finstere Wälder auf den hellgrünen Wiesen und goldenen Kornfeldern; – des Bielersees reiner, glimmernder Krystal, in dem sich die mit Reben bekränzten Küsten spiegeln; – Berge, die hinter einander immer höher und höher sich gegen die Füsse der Alpen zu aufthürmen; – die Perspektive in der ganzen weitgestreckten Landschaft, und die wollüstige Weichheit, welche die alles in einander verschmelzende Entfernung ihr giebt; – im fernsten Hintergrunde endlich der majestätische Alpenbogen, von den Schneebergen in Uri und Unterwalden bis zu den Savoyischen bey Genf, – und mitten im Busen dieser Natur-Schönheit das klein Pathmos, wo J. J. Rousseau in stillen himmlischen Träumen das Weltgetümmel vergass! – Wehe dem Herzen, das bey einem solchen Anblick nicht wenigstens für Einen Augenblick allen seinen Kummer vergisst! Die Wunde, in welche die Natur mit der reizendsten jungfräulichen Hand vergebens Balsam giesst, ist unheilbar.
Ich hatte mein Auge im Anschauen dieser Gegend berauscht, – und befand mich nun mitten in ihr, als wenn ich vom Olymp nach Tempe hinabgeschwebt wäre. So zufrieden ich auch über alles war, was ich neulich überschauet hatte, über alles, was mich da umgab: so brannte mein Verlangen doch ungeduldig nach dem Allerheiligsten, nach der letzten Gnadenbezeugung der Natur in Rousseaus winkendem Paradiese.
Es war der schönste Tag, den man sich denken kann. Einzelne hin und her flatternde Wolken spielten Verstecken mit den Bergspitzen, – einzelne Sonnenstrahlen mit den leicht von einem leisen Winde hingetriebenen Wellen; – der Himmel schien unter Weinen und Lachen zu wählen, und die Erde wartete still auf die Entscheidung.
Von Biel ab spazierten wir durch die angenehme neue Allee am westlichen Arm des Susaflusses, ungefähr eine halbe viertel Meile von der Stadt, zu der Brücke, die an einem Weinberge liegt, wo sich die Susa in den See ergiesst. – Hier stiegen wir in eine rothe mit weissen Flecken besprengte Gondel. Zwey rasche Schweitzer mit braven Nazionalgesichtern ruderten. O! Diese Fahrt übertraf alle Landscenen! Auf dem Odinshügel, bei Hellebek, wo sich das Auge in die Kehle der Nordsee verliert, und auf den tobenden Wogen der Ostsee wird man zu Pindars Ausruf gezwungen – hier wird man zu demselben gelockt. Dort ist es das stärkste, gewaltigste, herrlichste Element – hier das zärtlichste, das reizendste, das sanfteste.
Langsam fuhren wir hin, unter dem malerischen Ufer zur rechten Hand, im Schatten seiner mit Tannen bekränzten Höhen – die Insel gerade vor uns. Rund um uns her ein Kranz von abwechselnden in einander laufenden Landschaften. – Biel am Fusse der mit Wald besetzten Klippen des finstern Jura; Nidau mit einzelnen Pappeln hinter uns; gegen Süden fruchtbare Felder, blühende Wiesen, bepflanzte Anhöhen und stille Lauben; gegen Norden die steilen Bergrücken, hinankletterndes Gesträuch, Eichen und Tannen; im fernsten Hintergrunde ein Horizont von glimmernden Schneefeldern und Wolken unter einander; jede Minute ein neuer Himmel und eine neue Erde! mit jedem Athemzuge eine neue Aussicht! Ein sanfter Regen, der kaum fünf Minuten währte, in dessen Tropfen die Sonne einen Regenbogen bildete, während der ganze übrige Himmel klar war, verschönerte dies alles nur noch mehr.
Der geringe Wind, der da wehte, legte sich allgemach; die Seefläche ward ein wenig von der leisen Luft gekräuselt; der letzte Hauch verschwand – es ward ganz stille. Welche paradiesische Ruhe! welches Umfassen! welches Umarmen! Die ganze lächelnde Natur schien im wollüstigen Schlummer mit liebevollen Bildern zu spielen – und kaum vermochten wir es über uns, sie und uns selbst mit den schlagenden Rudern aus dem seeligen Traume zu erwecken.
Wir näherten uns allmählig der herrlichen Insel. Die sanfteste Erinnerung mischte sich in unsern stillen Genuss – die Erinnerung an ihren ehemaligen Bewohner, unsers Jahrhunderts menschlichsten Menschen. Wie oft glitt er in einem kleinen Boote über diesen Smaragdspiegel hin! – Wie viele angenehme Stunden verträumte er hier in süssen Schwärmereyen! O, warum ist er nicht länger hier? Noch ist die Natur eben so schön, noch lächelt sie eben so freundlich! So eben opferte sie ihrem abgerufenen Freunde eine Thräne; aber sein Geist schwebte im Regenbogen. – So ward sein Leben in stetswährenden Widerwärtigkeiten vollbracht; so waren seine hellern Schriften im Nebel seines Zeitalters – ein Wiederschein von der Sonne der Wahrheit im Prisma der edelsten Gefühle.
Ich fragte den ältesten von unsern Ruderern, ob er etwas von einem gewissen Rousseau gehört hab? – «Ja gewiss!» antwortete er, «Jean Jacques Rousseau, so hiess er; ich habe ihn recht gut gekannt – er wohnte im Hause auf jener Insel; aber er wollte sich nie recht sehen lassen, und doch wollte jedermann ihn so gerne sehen. Es war ein braver Mann – Ja er hat viele Bücher gemacht», fuhr er fort, da ich ihm seine Bekenntnisse zeigte, – «das war sein Unglück! Hätte er es nur seyn lassen; obgleich man doch sagt, dass viel Verstand darin seyn soll. – Sie werden jetzt seine Stube sehen, in der er so manche Nacht geschlafen hat», u.s.w. Er erzählte uns in seinem gebrochenen französischen Dialekt verschiedene Anekdoten von seinem Aufenthalte hier auf der Insel; aber da ich sie nachher vollständiger und zuverlässiger von dem alten Meier und seiner Frau in Twann hörte, so will ich sie hier übergehen.
Die Gondel näherte sich endlich der östlichen Seite der Insel, die aus einem ziemlich hohen, übermässig steilen, ganz nackten Felsen besteht, dessen oberster Rand mit Buschwerk bekränzt ist. Wenn man von Biel oder Nidau herkommt und nur diese Aussenseite sieht, sollte man sie für eine öde, ganz unbewohnbare Klippe halten. Aber wir drehten uns jetzt nach ihrer südlichen Küste, wo der See eine kleine Bucht bildet, und hier ward die Scene ganz verändert. Etwas einladenderes als dieses Vorland kann man sich nicht vorstellen. Der See scheint sich hier zwischen die Fruchtbäume und Weinreben einzuschleichen. Es ist der zu Küssen lockende Mund der Natur.
Wir stiegen ans Land. Meine Knie zitterten. Es war mir zu Muthe wie einem furchtsamen Liebhaber, der zum erstenmahl sich der Geliebten nähert, um ihr seine Leiden zu erklären. Ich stieg ans Land, oder eigentlich ich sank darauf hin; denn am ersten Stein kniete ich unwillkührlich, und küsste die Erde. Ich ward über mich selbst verlegen, und verbarg diese Bewegungen vor den Leuten, die sie nicht verstanden, und selbst vor M[oltke], indem ich etwas zu suchen schien; denn die Vernunft, wenn sie auch gleich die Gefühle des gerührten Herzens billigt, erröthet doch über deren Ausdruck. Wir gingen durch eine kleine natürliche Allee, mit einem Weinberge auf der einen, und einem spiegelhellen Kanal durch die Wiese auf der andern Seite, herauf nach dem Meierhofe, dem einzigen Hause auf der Insel, das auswendig sehr einfach und vollkommen ländlich aussah. Hier trafen wir den Steuereinnehmer oder den Verwalter über dieses Paradies. Wir fragten ihn, ob wir die Nacht auf der Insel zubringen könnten; aber es hiess, es sey unthunlich, ohne Erlaubniss von dem Hospitalvorsteher, Herrn Tribolet zu Bern. Da es nun für uns weitläuftig und unpassend war, nach Bern zu laufen, um diese Erlaubniss zu holen, so versprachen wir ihm, alle Verantwortung auf uns zu nehmen, wenn er uns erlaubte da zu bleiben, und einen Brief an Hrn. Tribolet zu schreiben, der alles gut machen sollte. Der gute Mann gab endlich unsern inständigen Bitten nach. Unsere erste Frage war nun nach Rousseau’s Zimmer. Er führte uns dazu hinauf. Wir giengen vom Hofe eine ziemlich lange steinerne Treppe hinan, nach einem Gange, von dem wir zuletzt drei Tritte hinab durch eine Küche in Rousseau’s Kammer kamen, die kleinste und unansehnlichste in dem ganzen weitläuftigen Hause, die er aber eben ihrer Simplicität und abgesonderten Lage wegen sich gewählt hatte.
Ich weiss nicht, ob sein Schatten mir wirklich entgegen kam, oder ob es mir nur so schien; aber es war mir unmöglich, mit einem Sprung gerade hinein zu laufen. Es kam mir vor, als ob etwas mich fragte: Bist du Mensch? oder strebst du wenigstens ernstlich es zu werden? Ich blieb einige Sekunden auf der Treppe stehen, bis ich endlich mit einer gewaltsamen Anstrengung Muth fasste und hineingieng. Kaum war ich hineingekommen, und sein kleines Gypsbildniss, das auf dem Ofen stand, gewahr geworden, als Thränen mir so gewaltig aus den Augen stürzten, als wenn das Blut von meinem Herzen dahin geströmt wäre. Ich näherte mich ihm; – es war mir nicht länger ein Bildniss, es war er selbst – ich liess meine Thränen auf seine Füsse fallen. «Dein Geist ruhe über meinen Bestrebungen!» – war ungefähr der Inhalt meines Gebetes, die Summe meiner Gefühle.
Quelle: [Jens Immanuel Baggesen]: «Rousseau’s Insel oder St. Peter im Bielersee». Fragment aus Baggesens Reisen, aus dem Dänischen übersetzt. In: Neuer Teutscher Merkur (1795), S. 13–19.
1802
Heinrich
von Kleist
Paris —
Basel —
Bern —
Thun —
Bern —
Weimar

Thun mit einer Ansicht von Schloss, Aare und See. Farbkupferstich, gemalt von Friedrich Rosenberg, gestochen von Charles-Melchior Descourtis (um 1790).
Auf der Insel wohnt auch weiter niemand, als nur an der andern Spitze eine kleine Fischerfamilie, mit der ich schon einmal um Mitternacht auf den See gefahren bin, wenn sie Netze einzieht und auswirft.
Heinrich von Kleist (1802)
Von Heinrich von Kleist gibt es nur ein einziges Bildnis (siehe Porträt Seite 52), das uns eine ungefähre Ahnung davon vermittelt, wie dieser Wortmagier wohl ausgesehen haben mag, der Mann, der die Ausdrucksfähigkeit des Deutschen bis an die Grenzen des Möglichen getrieben hat. Es ist 1801 vom Maler Peter Friedel angefertigt worden und taucht auf praktisch jedem Buchumschlag, jedem Ausstellungsplakat, auf allem auf, was mit Kleist zu tun hat – eben weil es kein anderes gibt (um ganz präzise zu sein: ein zweites Porträt ist 1807 von einem Laien gemalt worden, es ist zwar ein visuelles Dokument, aber eben so ungelenk-dilettantisch ausgeführt, dass es fast wie eine Karikatur wirkt). Das Bildnis aus Friedels Atelier misst winzige 5,5 auf 7 Zentimeter. Kleist hat es seiner Verlobten Wilhelmine von Zenge geschenkt, bevor er im Sommer 1801 für längere Zeit auf Reisen ging. Und sie hatte ihm eins von sich mitgegeben, im selben Format. «Küsse mein Bild, Wilhelmine, so wie ich so eben das Deinige geküsst habe …», lauten Kleists Anweisungen aus der Ferne. So weit, so romantisch. Das Miniatur-Porträt zeigt einen scheuen, zerbrechlichen, aber irgendwie doch auch freundlich-verschmitzt wirkenden jungen Mann mit bubenhaftem Kopf – 24 Jahre alt war Kleist, als er Modell gesessen hatte. Aus seinen Zügen lässt sich vieles oder nichts lesen. Kleist selber war damit gar nicht zufrieden: «Mögest Du es ähnlicher finden als ich. Es liegt etwas Spöttisches darin, das mir nicht gefällt, ich wollte, er hätte mich ehrlicher gemalt – Dir zu gefallen, habe ich fleissig während des Malens gelächelt, u. so wenig ich auch dazu gestimmt war, so gelang es mir doch, wenn ich an Dich dachte.» Dieses kostbare Porträt, wie wahr oder unwahr es nun immer sein mag, wäre beinahe in einer Schublade in einem kleinen Häuschen in Thun für immer vergessen gegangen. Weshalb ausgerechnet in Thun? Das ist eine längere Geschichte. Und sie beginnt nicht am Thunersee, sondern in Paris.
Als Kleist im Juli 1801 in Paris ankam, ein ziellos Reisender, ohne festen Wohnsitz, ohne erlernten Beruf, praktisch ohne finanziellen Rückhalt, nur mit dem vagen Plan im Kopf, sein abgebrochenes Studium der Naturwissenschaften wieder aufzunehmen, fühlte er sich überfordert. Die Grossstadt wurde ihm zum Albtraum: «Ich gehe durch die langen, krummen, engen, mit Kot oder Staub überdeckten, von tausend widerlichen Gerüchen duftenden Strassen, an den schmalen, aber hohen Häusern entlang, die sechsfache Stockwerke tragen, gleichsam den Ort zu vervielfachen, ich winde mich durch einen Haufen von Menschen, welche schreien, laufen, keuchen, einander schieben, stossen und umdrehen, ohne es übelzunehmen, ich sehe jemanden an, er sieht mich wieder an, ich frage ihn ein paar Worte, er antwortet mir höflich, ich werde warm, er ennuyiert sich, wir sind einander herzlich satt, er empfiehlt sich, ich verbeuge mich, und wir haben uns beide vergessen, sobald wir um die Ecke sind […]», schrieb er an eine Freundin zwei Wochen nach seiner Ankunft.
Aus seinen Pariser Briefen schlägt einem auf fast jeder Zeile heftige Zivilisationskritik entgegen, und genau dort, in jenen dreckigen Strassen, entwickelte sich die Sehnsucht nach einem Leben auf dem Land – in der Schweiz! Diese Idee kam nicht einfach aus dem Nichts, sie hing eng mit den Rousseau’schen Idealen zusammen, vor allem mit Kleists gründlicher Lektüre der Nouvelle Héloïse (1761). In Clarens am Genfersee führt Julie, nachdem sie sich von der leidenschaftlichen, geheimen Liebe zu ihrem Hauslehrer Saint-Preux losgesagt hatte, ein ruhiges Leben im Kreis ihrer Familie, mit Gatte und Kindern. Es gibt dort keine Passionen, keine unstillbaren Wünsche, keinen Ehrgeiz, Glanz und Pomp werden verachtet, und alles Streben richtet sich auf die makellose Organisation des Landgutes, auf Felder, Garten, Haus (es sind, offen gestanden, sehr langweilige Passagen, in denen diese Freuden des Landlebens ausgemalt werden …). Wie dem auch sei: Kleist fühlte sich von solchen Aussichten offenbar sehr angesprochen und teilte seiner Wilhelmine die Pläne in einem Brief mit. Datiert ist er auf seinen Geburtstag am 10. Oktober 1801, denn just ab diesem Tag durfte Kleist ohne Vormund über sein Vermögen verfügen, sodass das «Schweizer Projekt» auch rein ökonomisch in greifbare Nähe rückte (dennoch musste er sich am Ende zusätzliches Geld von der Schwester leihen): «Was meinst Du, Wilhelmine, ich habe noch etwas von meinem Vermögen, wenig zwar, doch wird es hinreichen mir etwa in der Schweiz einen Bauernhof zu kaufen, der mich ernähren kann, wenn ich selbst arbeite […]. Ich will im eigentlichsten Verstande ein Bauer werden, mit einem etwas wohlklingenderen Worte, ein Landmann. – Was meine Familie und die Welt dagegen einwenden möchte, wird mich nicht irre führen. Ein jeder hat seine eigne Art, glücklich zu sein, und niemand darf verlangen, dass man es in der seinigen sein soll.»

Heinrich von Kleist (1777–1811), Miniatur-Porträt auf Elfenbein von Peter Friedel (1801).
Das alles klingt reichlich naiv und harmlos und ein bisschen dahergeplaudert, im Hintergrund steht aber eine grosse Krise, die als «Kant-Krise» in älteren Kleist-Biografien verzeichnet wird. Durch die eingehende Lektüre von Kant habe Kleist erkannt, dass es keine objektiven Wahrheiten gebe, nach denen man streben könne … – damit sei ihm der Boden entzogen worden für eine vernunftgesteuerte Lebensplanung. Kant mag einen gewissen Einfluss gehabt haben, in Tat und Wahrheit war Kleist schon Monate vorher innerlich blockiert durch Zögern, Scheitern, falsche Entscheidung. Die ganze Gesellschaft und alle ihre Ämter, die ihm allenfalls offengestanden hätten, wurden ihm «ekelhaft». Deshalb also der Plan, sich auf das Einfachste und Wesentlichste zu beschränken: Haus, Frau, Kinder.
Wilhelmine reagierte – zu Kleists grosser Enttäuschung – zurückhaltend auf den Vorschlag. Kleist hingegen war es wirklich ernst mit dem Plan. Er floh im Dezember 1801 aus dem «Abgrund» Paris in die Gegenwelt der Schweizer Natur. Basel wurde dabei zu einem Portal mit besonderer Bedeutung. Vom Rheinknie aus schrieb er an die Schwester: «Es war eine finstre Nacht als ich in das neue Vaterland trat. […] Mir war’s, wie ein Eintrit in ein anderes Leben.» Das neue Vaterland? Er hatte offenbar vor, für längere Zeit, wenn nicht gar für immer, zu bleiben. Sofort begann er mit der Suche nach einem geeigneten Objekt: «Mir ist es allerdings Ernst gewesen, mein liebes Ulrikchen, mich in der Schweiz anzukaufen, und ich habe mich bereits häufig nach Gütern umgesehen, oft mehr in der Absicht, um dabei vorläufig mancherlei zu lernen, als bestimmt zu handeln. Auf meiner Reise durch dieses Land habe ich fleissig die Landleute durch Fragen gelockt, mir Nützliches und Gescheutes zu antworten. Auch habe ich einige landwirtschaftliche Lehrbücher gelesen und lese noch dergleichen, kurz, ich weiss soviel von der Sache, als nur immer in so kurzer Zeit in einen offnen Kopf hineingehen mag.»
Aus dem Kauf wurde dann aber doch nichts, denn Kleist war sich wohl nicht ganz im Klaren darüber, dass die idyllenhafte Schweiz gerade sehr unruhige und teils sogar kriegerische Zeiten durchmachte. Nach dem Einmarsch napoleonischer Truppen 1798 und der Einführung der helvetischen Verfassung, die wesentliche Neuerungen brachte (Gleichberechtigung von Stadt und Land, Gewaltentrennung, die allgemeine Schulpflicht, Gewerbefreiheit, Niederlassungsfreiheit und so weiter), aber auch die alten Machtverhältisse durcheinanderwirbelte, stand die Schweiz faktisch unter französischer Fremdherrschaft. Von den Gegnern der Helvetik angeführt, kam es zu mehreren Aufständen, und in Teilen des Landes herrschten bürgerkriegsähnliche Zustände. Im Zuge der Helvetik wurde auch das übergrosse Bern in die vier Kantone Aargau, Waadt, Berner Oberland, mit Thun als Hauptstadt, und Bern Mittelland zerstückelt. Auch in diesem Gebiet kam es mehrfach zu Spannungen und Waffengewalt. Mit anderen Worten: Kleist begab sich ausgerechnet in eines der damaligen Zentren des politischen Geschehens, ja, er erlebt sogar einen «abscheulichen Volksaufstand», wo er sich doch gerade aus alledem zurückziehen wollte. Nicht ganz zu Unrecht äusserte er Befürchtungen über den weiteren Verlauf der Situation: «Mich erschreckt die Möglichkeit, statt eines Schweizerbürgers durch einen Taschenspielerkunstgriff ein Franzose zu werden.»
Statt ein Haus zu kaufen, mietete er eines. «Ich habe mir eine Insel in der Aare gemietet, mit einem wohleingerichtet Häuschen, das ich in diesem Jahre bewohnen werde, um abzuwarten, wie sich die Dissonanz der Dinge auflösen wird.» Womöglich meinte er mit Dissonanz der Dinge sowohl die politisch wirre Lage wie auch sein Verhältnis zu Wilhelmine. Zwischen den beiden Liebenden herrschte gegenseitiges Unverständnis, briefliche Fragen und Antworten wechselten nur noch sehr selten zwischen der Schweiz und Deutschland hin und her. Nun endlich fand Kleist Zeit, sich dem literarischen Schreiben zu widmen.
Als er in der Schweiz ankam, war er noch kein Dichter, als er sie verliess, schon. Auf der abgelegenen Aare-Insel in Thun ist Kleists erstes Drama entstanden, die Familie Schroffenstein. Hier, in einem kleinen Fischerhäuschen und dem angrenzenden Garten, gelingt Kleist der Durchbruch zum Schreiben. In den ihm verbleibenden zehn Jahren (1811 wählt er zusammen mit seiner Geliebten Henriette Vogel den Freitod durch Kopfschuss) wird er ungeheuerliche Sätze schreiben, Satzkaskaden, «die das Sprachgefüge bis ins Innerste zum Beben» bringen, «aber niemals zum Einsturz» (Ulrich Greiner).
Sein Leben auf der Fischerinsel verläuft äusserlich ruhig, sehr angenehm (siehe Originaltext). Manches aus Kleists Schilderungen darf man glauben, anderes sind reine Flunkereien. Das Schreckhorn etwa, das Kleist bestiegen haben will, während sein «Mädeli» in einer Andacht sitzt, ist ein alpinistisch höchst anspruchsvoller Viertausender (4078 Meter) und rund 70 Kilometer, also mindestens eineinhalb Tagesmäsche, von Thun entfernt. Über die Identität des «Mädelis» weiss man bis heute nichts Sicheres, ebenso wenig über Kleists Beziehung zu ihr, was den Germanisten Rüdiger Görner dazu bewegt, ironisch-süffisant von der «dortigen (wie auch immer gearteten) Betreuung durch das ‹Mädeli› oder ‹Meitschi›» zu schreiben. Aber zumindest von der Insel kann man sich ein Bild machen. Anders als zu Kleists Zeiten, als sie noch weit ausserhalb lag, ist sie nun von der wachsenden Stadt umfasst in Bahnhofsnähe zu finden. Sie ist auch heute in Privatbesitz und nur ausnahmsweise zu betreten, das Häuschen, in dem Kleist wohnte, ist in den 1940er-Jahren abgerissen worden. Aber eine Fotoserie des Thuner Fotografen Christian Helmle vermittelt einen Eindruck von diesem Rückzugsort: alter Baumbestand, belaubte Äste, die sich bis zum türkisblauen Wasserspiegel hinabsenken, Wege und Bänkchen, im Hintergrund die Berge, die Wolken. Hier also hat Kleist geschrieben, über eine bis aufs Blut verfeindete Familie, deren zwei Zweige sich gegenseitig ausrotten wollen – inspiriert hat ihn Shakespeares Romeo und Julia. Am Ende werden zwei sich liebende junge Menschen durch die Hand ihrer Eltern sterben. Überhaupt trieft das Drama vor Gewalt und Pessimismus.
Wichtiger als die Berner Oberländer Natur (von der er in seinen Schriften kaum Gebrauch macht, die Familie Schroffenstein spielt in Schwaben) waren für Kleist die Gesprächspartner in Bern: In der Gerechtigkeitsgasse diskutierte Kleist mit Heinrich Zschokke, Ludwig Wieland und Heinrich Gessner, Buchhändler, Verleger und Sohn des berühmten Idyllendichters Salomon Gessner. In dessen Verlag erschien 1803, anonym, die Familie Schroffenstein. Als Kleist erkrankte und vorerst für mehrere Wochen nach Bern übersiedelte, gab er den Traum vom Selbstversorgerleben endgültig auf. Sein Bildnis, das Wilhelmine ihm nach Auflösung der Verlobung (ohne dass sich die beiden noch einmal gesehen oder gespochen hätten) nach Thun schickte, vergass er, packte es jedenfalls nicht ein, ob nun absichtlich oder unabsichtlich. Mitte Oktober 1802 verliess er die Schweiz, um schon im Sommer 1803 zurückzukehren, diesmal in Begleitung seines Jugendfreundes Ernst von Pfuel. Unterbrochen von Ausflügen nach Meiringen und ins Reichenbachtal sowie Abstechern nach Bellinzona und Varese, hielten sie sich im August und September erneut in Thun und Bern auf. Offenbar zeigte Kleist dem Gefährten seine alten Aufenthaltsorte – und just da kam es zu Szenen, die die (biografische) Kleist-Forschung ganz schön auf Trab brachten. Vor einigen Jahren erst tauchte nämlich ein Brief auf, datiert auf den 7. Januar 1805, in dem Kleist an seinen Freund schreibt: «Du stelltest das Zeitalter der Griechen in meinem Herzen wieder her, ich hätte bei dir schlafen können, du lieber Junge; so umarmte dich meine ganze Seele! Ich habe deinen schönen Leib oft, wenn du in Thun vor meinen Augen in den See stiegest, mit wahrhaft mädchenhaften Gefühlen betrachtet. Er könnte wirklich einem Künstler zur Studie dienen.» Über diesen zweiten Schweizaufenthalt ist relativ wenig bekannt – dafür wuchern die Interpretationen über Kleists sexuelle Ausrichtung. Sicher ist: Anfang Oktober führte die Spur des rastlosen Dichters wieder nach Paris, wo er, frustriert über das Misslingen seines Guiskard-Projekts, das dazugehörige Manuskript verbrannte. Der Kreis scheint sich zu schliessen, Kleist war zurück im Grossstadt-Moloch, haltloser als je zuvor. Die Schweizer Monate waren womöglich eine (allzu) kurze Atempause in diesem erschütternd unruhigen Leben. Zumindest lassen die leicht dahingetupften Schilderungen der Thunersee-Idylle das glauben.