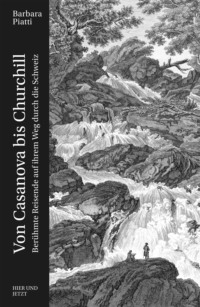Kitabı oku: «Von Casanova bis Churchill», sayfa 6
Am nächsten Morgen brachen wir nach Luzern auf. Während des ersten Teils unserer Reise regnete es heftig, doch gegen Ende klarte der Himmel auf, und die Sonnenstrahlen trockneten uns und munterten uns auf. Noch einmal und zum letzten Mal sahen wir die felsigen Ufer dieses wunderschönen Sees, seine fruchtbaren Inseln und die schneebedeckten Berge.
Wir gingen in Luzern an Land und blieben für die folgende Nacht in der Stadt, und am nächsten Morgen (dem 28. August) brachen wir in der diligence par-eau nach Laufenburg auf, einer Stadt am Rhein, wo die Wasserfälle dieses Flusses das Boot daran hinderten weiterzufahren. Unsere Reisegesellschaft entstammte den niedrigsten Klassen, sie rauchten unablässig und waren ausserordentlich abscheulich. Nachdem wir zur Erfrischung in der Tagesmitte an Land gegangen waren, entdeckten wir bei unserer Rückkehr, dass unsere vorherigen Sitzplätze besetzt waren; wir nahmen andere; doch deren ursprüngliche Inhaber bestanden zornig und beinahe gewaltsam darauf, dass wir sie wieder räumten. Ihre ungehobelte Grobheit uns gegenüber, die wir ihre Sprache nicht verstanden, reizte Shelley derart, dass er den Erstbesten niederschlug: Dieser schlug nicht zurück, sondern setzte sein Geschrei fort, bis sich die Bootsleute einmischten und uns andere Sitzplätze zuwiesen.
Die Reuss hat eine äusserst starke Strömung, und wir kamen über mehrere Fälle, von denen einer höher als acht Fuss war. Es liegt etwas sehr Köstliches in dem Gefühl, wenn man in einem Augenblick am oberen Ende des Wasserfalls schwebt, und bevor eine Sekunde verstrichen ist, hat man den Boden erreicht, während man durch die Beschleunigung, die durch das Hinunterfahren gewonnen wird, immer noch weitersaust. Die Wasser der Rhône sind blau, jene der Reuss sind von einem dunklen Grün. Ich glaube, dass dies etwas mit den Flussbetten zu tun haben muss und dass die Farbtöne der Ufer und des Himmels alleine diesen Unterschied nicht verursachen können.
Nach einer Übernachtung in Dettingen kamen wir am nächsten Morgen in Laufenburg an, wo wir ein kleines Kanu mieteten, um uns nach Mumpf zu bringen. Ich gebe diesen Booten eine indianische Bezeichnung, da sie von einfachster Bauart waren – lang, schmal und mit flachem Kiel: sie bestanden nur aus geraden Stücken von Planken aus Kiefernholz, waren unbemalt und mit so wenig Sorgfalt zusammengenagelt, dass ständig Wasser durch die Ritzen eindrang und das Boot andauernd ausgeschöpft werden musste. Die Strömung war stark, und der Fluss brauste hurtig voran und brach sich im Vorbeischnellen an den unzähligen Felsen, die nur knapp unter Wasser lagen: Es war ein einigermassen erschreckender Anblick, unser zerbrechliches Boot zwischen den an den Felsen entstehenden Wirbeln hindurchwinden zu sehen, wobei jede Berührung tödlich gewesen wäre, und die kleinste Neigung zu einer Seite hätte es sofort kentern lassen.
In Mumpf konnten wir kein Boot beschaffen, und wir dachten, wir hätten Glück, als wir einem cabriolet auf der Rückfahrt nach Rheinfelden begegneten; doch unser glückliches Geschick war nicht von langer Dauer: Ungefähr eine Meile von Mumpf entfernt brach das cabriolet zusammen, und wir mussten zu Fuss weitergehen. Zum Glück wurden wir von einigen schweizerischen Soldaten eingeholt, die man entlassen hatte und die auf dem Weg nach Hause waren; sie trugen uns unsere Reisekiste bis nach Rheinfelden, wo man uns den Weg zu einem Dorf in einer Meile Entfernung wies, in dem man für gewöhnlich Boote mieten konnte. Dort bekamen wir, allerdings nicht ohne einige Schwierigkeiten, ein Boot nach Basel und fuhren weiter, den schnell strömenden Fluss hinunter, während der Abend anbrach und das Wetter rauh und unfreundlich war. Unsere Reise war jedoch von kurzer Dauer, und wir erreichten unser Ziel um sechs Uhr am Abend.
Quelle: Mary W. Shelley & Percy B. Shelley: Flucht aus England. Reiseerinnerungen & Briefe aus Genf 1814–1816. Aus dem Englischen übertragen und herausgegeben von Alexander Pechmann. Hamburg, Genf, Friesland: Achilla Presse Verlagsbuchhandlung 2002, S. 35–43.
Editorische Notiz: Zurück in England, arbeiteten Percy und Mary ihre gemeinsamen Aufzeichnungen zu einer Buchpublikation um; History of a Six Weeks’ Tour, Marys allererste Buchveröffentlichung, erschien 1817.
1816
Lord Byron
London —
Basel —
Bern —
Murten —
Lausanne —
Genf —
Montreux —
Lauterbrunnen —
Wengneralp —
Grosse Scheidegg —
Grindelwald —
Meiringen —
Brienz —
Lausanne —
Mailand

Blick auf die Jungfrau von Lauterbrunnen aus. Solche Szenerien inspirierten Lord Byron zu seinem Drama «Manfred». Lithografie, gezeichnet von M. Villeneuve, lithografiert von Godfrey Engelmann (1823).
Nahezu alle fünf Minuten hörten wir Lawinen hinunterstürzen – wie wenn Gott den Teufel vom Himmel herab mit Schneebällen bewerfen wollte.
Lord Byron (1816)
Missolunghi, Griechenland, 19. April 1824: Auf seinem Sterbebett hauchte Lord Byron seinem Arzt folgende Worte ins Ohr: «Ich habe das Leben von Herzen über und werde die Stunde willkommen heissen, in der ich davon scheide, denn nur wenige Menschen können schneller leben, als ich es getan habe.» Schneller leben: Tatsächlich gehörte George Gordon Noel Byron (1788–1824), wie er mit vollem Namen hiess, zu jenen Menschen, deren Dasein so wirkte, als wäre es eine Fackel, die an beiden Enden brennt. Es war ein rauschhaftes Leben, er nahm und raffte an sich, was er bekommen konnte: Geld, Ruhm, Frauen, Männer, Knaben. Mit seinen ersten Dichtungen – insbesondere mit Childe Harold’s Pilgrimage (ab 1812), modelliert nach seinen eigenen Erfahrungen auf einer «Grand Tour» in ferne Länder – erlangte er Kultstatus, wurde abgöttisch verehrt, als Dichter, als Mann, ganz so wie später Franz Liszt, eine andere Ikone der Romantik. Byron, das war ein diabolischer Verführer. Wie passend, ist man versucht zu sagen, dass er mit einer Behinderung, einem Klumpfuss nämlich, geboren wurde. Der «hinkende Engel», wie er auch genannt wurde, war zu massloser Liebe ebenso fähig wie zu massloser Grausamkeit; will heissen: seinen Opfern fügte er kein körperliches, aber sehr viel seelisches Leid zu. Nur 36 Jahre alt ist er geworden, da hat ihn die Malaria dahingerafft (und er ist nicht etwa mit dem Säbel in der Hand auf dem Schlachtfeld gestorben, im Freiheitskampf für die Griechen, wie er es sich gewünscht hätte). Wie immens sein Ruhm war, zeigte sich unmittelbar nach seinem Tod: Als sein Leichnam auf der «Florida» nach London gebracht wurde, säumten Hunderte das Ufer der Themse; und laut Augenzeugenberichten besuchten Tausende den aufgebahrten und einbalsamierten Dichter, ehe er zu Grabe getragen wurde.
Sich wirklich ein Bild vom Menschen Byron zu machen, scheint ein Ding der Unmöglichkeit, denn egal, welche Biografie man aufschlägt, welche Quelle man konsultiert, es sind immer neue Facetten, die präsentiert werden. «In diesem Menschen kam alles zusammen, was es braucht, um im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen», fasst Michail Schischkin in seinem Wander- und Lesebuch Auf den Spuren von Byron und Tolstoi (2012) zusammen, «eine gute Herkunft sowie hübsche Gesichtszüge, Reichtum und ein skandalbelastetes Familienleben, der Nimbus eines Ausgestossenen sowie eine Leidenschaft für den Sturz in die Tiefen, eine körperliche Behinderung (‹born with a lame foot›) und poetisches Genie. Er hatte es nicht nötig, an seinem Image zu arbeiten und herumzufeilen, da all sein Tun und Lassen ohnehin seinem Image zugutekam. Sein Image deckte sich völlig mit seiner Person. Der Mensch Byron fesselt mehr als seine Helden, die erst dann interessant werden, wenn sie an ihn erinnern.»

Lord Byron (1788–1824) auf einem Porträt von 1814.
Im Sommer 1816 logierte der Dichter für einige Monate in der Schweiz. Nicht ganz freiwillig, denn er musste England verlassen aufgrund mehrerer Skandale – der grösste war die Trennung von seiner Frau und seiner Tochter Ada und parallel dazu seine wilde Ehe mit seiner Halbschwester Augusta, mit der er ebenfalls eine Tochter zeugte, Elizabeth Medora. Für dieses inzestuöse Verhältnis wurde er, ein Angehöriger des britischen Hochadels, von der Gesellschaft gebrandmarkt. Als Byron England am 25. April 1816 verliess, konnte er noch nicht ahnen, dass er nie wieder zurückkehren würde. Die Schweiz als vorläufiges Ziel kam überhaupt nur infrage, weil es nach den Friedensschlüssen von Amiens und Wien für die Engländer wieder möglich war, sich frei auf dem Kontinent zu bewegen. Lord Byron reiste mit Stil von der französischen Küste an den Genfersee: in einer grosszügig dimensionierten schwarzen Kutsche, einer Art Palast auf Rädern mitsamt Ruhebett, Bibliothek und kleinem Speisezimmer.
Für Byron bedeutete der Aufenthalt in der Schweiz die Trennung von seiner Augusta und bitteres Exil, für die Literaturgeschichte war er ein beispielloser Glücksfall. In Cologny trafen sich nämlich Percy Shelley, Mary Godwin und Claire Clairmont, die wir schon aus dem vorangehenden Kapitel kennen, sowie Lord Byron, sein Leibarzt Polidori und zwei Bedienstete. Mit dabei war auch Marys und Percys zweites gemeinsames Kind, Sohn William – von ihm ist erstaunlicherweise kaum die Rede, aber dennoch: ein Baby von acht Monaten gehörte mit zur Gesellschaft, die sich auf zwei Haushalte verteilte. Die Shelleys wohnten unten am Seeufer, in einem eher bescheidenen Häuschen, Byron und seine Entourage weiter oben am Hang in der herrschaftlichen Villa Diodati – die topografische Situation von oben und unten bildet auch das soziale «Ranking» ab, wie Padraig Rooney festhält, denn Byron stand auf der gesellschaftlichen Leiter einige Stufen über Shelley. Freunde wurden die beiden trotzdem, und Byron sollte Shelley just am Genfersee sogar das Leben retten, aber dazu später mehr. Zwischen den beiden Häusern ging es munter zu und her, Claire Clairmont führte ihre schon in England begonnene Affäre mit Byron weiter (obwohl er sich nur abschätzig über sie äusserte), und dieser entsprang Byrons drittes Kind, Allegra, dem nur ein kurzes und unglückliches Leben beschert war. Ob Mary auch in seinem Bett landete, wer kann das wissen, ganz ausgeschlossen ist es jedenfalls nicht. Sicher ist hingegen, dass neugierige Touristen das Treiben von den gegenüberliegenden Hotels beobachteten, bewaffnet mit Ferngläsern und Lorgnetten, einer Art Vorläufer des Opernguckers. Byron, der Superstar unter den zeitgenössischen Dichtern, war in jenen Tagen, wie überall, wo er sich aufhielt, die Sensation schlechthin.
1816 ging als «Jahr ohne Sommer» in die Geschichte ein. Es war selbst im Juni und Juli fürchterlich kalt, unablässig prasselte der Regen auf die Dächer: Einige Monate zuvor war im indonesischen Tambora ein Vulkan ausgebrochen, der grosse Mengen an Asche in die Atmosphäre geschleudert hatte. Das Resultat war, auch in Westeuropa, mit einem nuklearen Winter vergleichbar: Die Sonne verdüsterte sich, die Temperaturen fielen um mehrere Grad. In dieser Schlechtwetterperiode entstand aber viel Literatur, nicht irgendwelche, sondern Literatur von Weltrang. Mary Shelley schrieb bekanntlich Frankenstein or the Modern Prometheus, eine gothic novel, deren Siegeszug bis heute anhält und die fest im kollektiven Gedächtnis verwurzelt ist, Polidori verfasste The Vampyre, einen ersten Blutsaugerroman, den er 1817 unter Byrons Namen publizierte und der tatsächlich eine Art Humus für die spätere Dracula-Kreation von Bram Stoker bildete. Aus Shelleys Feder stammt ein berühmtes Gedicht auf den «Mont Blanc» und von Byron eines auf den «Prisoner of Chillon» – mit diesem Versepos um einen im 16. Jahrhundert in den Kerkern von Chillon dahinvegetierenden Gefangenen drückte er der Genferseeregion endgültig seinen Stempel auf. Nur deswegen wurde zum Beispiel in Villeneuve 1840 ein «Grand Hotel Byron» eröffnet, direkt gegenüber von Schloss Chillon. Später zog dieses Haus wiederum Berühmtheiten wie Franz Liszt, Felix Mendelssohn Bartholdy, Stefan Zweig und andere an.
An einem der wenigen zumindest anfangs regenfreien Tage machten sich Shelley und Byron zu einer gemeinsamen Bootsfahrt auf; sie sollte ganz anders enden als geplant. Die Idee war, die Schauplätze von Jean-Jacques Rousseaus Liebes- und Briefroman Julie ou La Nouvelle Héloïse zu besuchen, also ein Footstep Travelling zu unternehmen, so wie es Mendelssohn in der Zentralschweiz mit Schillers Wilhelm Tell in der Tasche tut (siehe das Kapitel über Felix Mendelssohn Bartholdy, Seite 117–131). Die beiden englischen Poeten befanden sich mitten auf dem See, als das Wetter umschlug: «Der Wind nahm stetig an Heftigkeit zu, bis es fürchterlich stürmte; und da er aus der entferntesten Ecke des Sees kam, erzeugte er Wellen von erschreckender Höhe.» Das Segel flatterte davon, das Steuerruder war nicht mehr zu gebrauchen, Wasser strömte ins Boot. Vorsichtshalber zogen die beiden schon einmal ihre Mäntel aus und sassen mit verschränkten Armen im Boot. Dieses kenterte dann auch wirklich – kein Problem für Byron, der in Nachahmung des Mythos von Hero und Leander schon den Hellespont, heute Dardanellen genannt, durchschwommen hatte, eine Meeresenge, die an ihrer schmalsten Stelle gut 1300 Meter misst; wohl aber eines für Shelley, der nicht schwimmen konnte; es war Byron, der ihn an Land zog … Danach trockneten die beiden in einer Taverne in Meillerie.
Im romantischen Zeitalter, so scheint es, kam es unablässig zu Durchmischungen und Durchmengungen von Erfundenem und Wirklichem. Bei allem Schrecken – es wird Byron und Shelley, zumindest im Nachhinein, amüsiert haben, dass sie genau das durchlebt haben, was auch die Romanfiguren bei Rousseau (auf deren Spuren sie ja unterwegs waren) durchgemacht hatten: Julie und Saint-Preux, ein Liebespaar, geraten in ihrem Boot in ein heftiges Gewitter und können sich nur mit Mühe ans Ufer retten. In einem Brief an seinen Verleger Murray, datiert auf den 27. Juni 1816, kommentierte Byron diese literarische Pilgerfahrt: «Ich habe Rousseaus gesamtes Terrain besichtigt, immer mit der Héloïse in der Hand, und ich bin erschlagen, so sehr, dass ich es nicht beschreiben kann, von der Kraft und Genauigkeit seiner Beschreibungen, und von der Schönheit ihrer Wirklichkeit.»)
Kurz nach diesem Seeabenteuer, zwischen dem 17. und dem 29. September, unternahm Byron, nun ohne die Shelleys, aber mit seinem Freund John Cam Hobhouse aus Cambridger Studientagen, eine Tour ins Berner Oberland. Hobhouse, selber kein grosser Dichter, führte Tagebuch, und wir erfahren daraus ein paar interessante Fakten: dass die Exkursion bei schönstem Wetter stattfand, dass sie eine Menge instruktiver und unterhaltsamer Aspekte bot (wie etwa die Gesangseinlage von vier Brienzer Mädchen nach Tisch), und all das bei überschaubaren Kosten von insgesamt 305.15 Schweizer Franken. Er hält aber auch witzig-selbstironische Augenblicke fest, zum Beispiel nach einem Aufstieg von der Wengneralp der Männlichen-Flanke entlang: «Wir legten uns für einen Augenblick hin, diese berühmte Szenerie zu betrachten, deren Unberührtheit jedoch etwas gestört wurde durch das Erscheinen von zwei oder drei weiblichen Wesen zu Pferd, gerade als wir uns beglückwünschten zur unübertrefflichen Einsamkeit dieser Szenerie, etwa im Vergleich zu Chamonix.»
Auch Byron hielt seine Eindrücke fest (siehe Originaltext), allerdings mit einer ganz bestimmten Adressatin im Hinterkopf: Augusta. Und bei allem Üblen, was man Byron nachsagen kann, insbesondere im Hinblick auf die Behandlung von Frauen, für Augusta trifft das alles nicht zu. Sie hat er immer zu schützen versucht, sie hat er offenbar wirklich geliebt, aber gerade das eben nicht gedurft: «An Dich, liebste Augusta, sende ich, und für Dich habe ich diesen Bericht von dem, was ich gesehen und empfunden habe, geschrieben. Liebe mich, wie Du von mir geliebt wirst.»
Die Tour durch das Berner Oberland hat der Nachwelt aber nicht nur Byrons Tagebuch beschert, sondern auch das Drama Manfred (1817), wobei das eine mit dem anderen sehr eng verknüpft ist. Byron selbst bestätigt, dass die «germs», die Samen des Dramas, in seinem Reisetagebuch für Augusta zu finden seien. Das Lauterbrunnental und vor allem die Jungfrau wurden für Byron zu Inspirationsorten und Schauplätzen, so wie zuvor Schloss Chillon. In dieser Berner Oberländer Kulisse aus Schnee, Eis und Fels siedelt Byron die dramatischen Szenen mit Manfred an, einem Helden, der in Weltschmerz versinkt, mit düsteren Mächten im Dialog steht und sich in seiner Not vom Gipfel der Jungfrau stürzen will, wäre da nicht ein einheimischer Gemsjäger, der ihn in letzter Sekunde rettet und dann vorsichtig, durch Eisfelder und Geröll, hinunterführt zu einer Sennhütte: «(Wie Manfred von der Klippe springen will, erfasst ihn der Gemsenjäger und reisst ihn mit raschem Griff zurück):
Gemsenjäger: Halt, Toller! Wenn auch lebenssatt – beflecke / Mit schuld’gem Blute nicht die reinen Täler. / Hinweg mit mir! Was ich ergreife, halt’ ich. Manfred: Ich bin höchst krank im Herzen – lass’ mich los! / Ich bin ganz Schwäche – die Gebirge tanzen, / Mich rings umwirbelnd. – Bin ich blind? – Was bist du?
Gemsenjäger: Gleich sollst du Antwort haben. Fort mit mir. / Gewölk kommt dichter. – Stütze dich auf mich! / Setz’ hier den Fuss – hier! Nimm den Stock und halte / Am Busch dich eine Weile! Gib die Hand! / Umfass’ am Gürtel mich. – Behutsam! – So! / Der Senne ist erreicht in einer Stunde. / Komm! bald gewinnen wir ein fest’res Fussen, / Etwas wie einen Saumweg, den der Giessbach / Seit Winter auswusch. Komm’! – So – das ist brav. / Du hättest Jäger werden sollen. – Folge!»
Byron hat das Berner Oberland sogar noch mehr beeindruckt als die Genferseegegend: «Mr. Hobhouse und ich sind gerade zurück von einer Reise zu Seen und Bergen. Wir waren in Grindelwald, bei der Jungfrau und haben auf dem Gipfel der Wengneralp gestanden; haben Wasserfälle von neunhundert Fuss Fallhöhe gesehen und Gletscher in allen Dimensionen. Wir haben Hirtenflöten gehört und Lawinen, und haben Wolken betrachtet, die schaumartig aus den Tälern aufstiegen, wie die Gischt eines höllischen Ozeans. Chamonix […] haben wir vor einem Monat gesehen. Aber obwohl der Mont Blanc höher ist, kommt er nicht an die Wildheit der Jungfrau, der beiden Eiger, des Schreckhorns und der Rosengletscher [Rosenlauigletscher] heran». In Tagebuch, Briefen und den Manfred-Versen finden sich teils fast identische Formulierungen: Als Manfred in die Tiefe starrt, beobachtet er die Nebelformen, denen er nur mit Vergleichen beizukommen weiss – Qualm, Schwefel, (Höllen-)Meeresschaum, ganz so wie im Brief an Murray:
«Am Gletscher qualmen Nebel auf, und Wolken / Zieh’n kräuselnd fast zu mir sich, weiss und schweflig, / Wie Schaum empörten Meers der tiefen Hölle […].»
Diese Szene «auf dem Gipfel der Jungfrau» – zwei Figuren auf einem Berggipfel, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten – ist von berühmten Künstlern illustriert worden, unter anderem von John Martin (1837), Ford Madox Brown (1842) und Gustave Doré (1853). Das hat der Verbreitung dieser Geschichte nochmals einen Schub verliehen. Bei Gustave Doré erscheint der Gemsjäger mit Flinte und in Gebirgstracht, Manfred in wallendem Mantel, mit Federbusch auf dem Hut und schwarzen, eng anliegenden Beinkleidern. Besonders eindrücklich ist die Szene bei Brown ausgeführt. Manfred rauft sich im Vordergrund das Haar, der Schrecken steht ihm ins Gesicht geschrieben, in spitzen Schuhe rutscht er bereits auf den Abgrund zu, kein Halt, nirgends. Dahinter erscheint der Gemsjäger, in Fell und Leder gehüllt. Bei Martin ist die Landschaft – in fantastische Blau- und Brauntöne getaucht, eine Szenerie wie aus einem Traum – weitaus wichtiger als die zwei winzigen Rückenfiguren, die sich nur als dunkle Silhouetten abzeichnen.
Die Wirkung von Manfred war schon kurz nach Erscheinen 1817 ungeheuer. Der touristische Zustrom auf die Kleine Scheidegg verdreifachte sich; die englischen Touristen wollten die Manfred-Schauplätze mit eigenen Augen sehen. Kein Wunder, Byron war ein ausgesprochener «poet of place», ein Dichter mit einem Faible für Schauplätze, was sich auch daran zeigt, dass über ein Jahr später die Erinnerung an die Manfred-Inspirationsorte noch ganz und gar lebendig ist. Seinem Verleger Murray erklärte er in einem Brief: «I have the whole scene of Manfred before me as if it was but yesterday & could point out spot by spot, torrent and all» – Ich habe die ganze Kulisse von Manfred vor Augen, als wäre es gestern gewesen, und könnte Punkt für Punkt zeigen, mit Wildbach und allem.