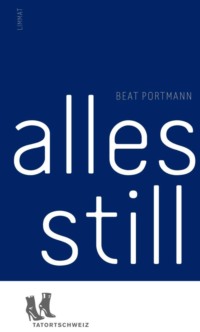Kitabı oku: «Alles still», sayfa 2
Während sie sich entfernte, wurde Salesia Pfyffers Aufmerksamkeit von einer Gesellschaft in Anspruch genommen, die unter lautem Stimmengewirr das Lokal betrat.
Nachdem der Kellner die Getränke gebracht hatte, sagte ich: «Ihre Mutter war eine gläubige Katholikin, nicht wahr?»
Ohne den Blick von der Gesellschaft zu wenden, die sich umständlich um einen langen Tisch verteilte, erwiderte sie: «Ich bin es im Übrigen auch.»
Ich wartete eine Weile und sagte: «Möchten Sie sich lieber zu denen setzen? Ich kann auch die Zeitung lesen.»
Sie sah mich fragend an. «Wie bitte?»
«Es ist nicht gerade angenehm, mit jemandem ein Gespräch zu führen, der mit seinen Augen dauernd woanders ist.»
Nun tat sie, was ich als Letztes erwartet hätte: Sie entschuldigte sich. «Ich weiss, dies ist eine Unart von mir.»
Sie sah mir in die Augen und begann zu lächeln. Dabei zeichneten sich winzige Falten auf ihrer Nasenwurzel ab. Etwas, was ich bisher immer für die Übertreibung verkitschter Autoren gehalten hatte, um eine reizende Person zu charakterisieren.
Ich beschloss, dass das Pfefferminzkraut nun lange genug im Wasser gelegen hatte und schenkte mir eine Tasse ein.
«Zur Zeit», begann ich aufblickend, «stehen für mich zwei Fragen im Vordergrund: Warum wollte Ihre Mutter unbedingt verhindern, dass Sie Ihren Vater kennenlernen? Und wer ausser Ihrem Vater könnte die Wahrheit kennen?»
Ich trank und verbrannte mir die Zunge und mindestens die halbe Speiseröhre. Verärgert stellte ich die Tasse wieder ab.
«Vielleicht gehörte Ihr Vater der falschen Konfession an …»
Ich machte eine Pause und fragte: «Wurde Ihre Tante eigentlich auch mit der Geschichte des adligen Engländers abgespiesen?»
«Sie sagt Ja. Aber vermutlich weiss sie mehr.»
«Warum glauben Sie das?»
«Weil sie nur widerwillig über die Zeit vor meiner Geburt spricht. Ich habe auch keine Lust, sie zu drängen.»
Ich registrierte einen Anflug von Unmut auf ihrem Gesicht.
«Sie haben diesen Jesuiten erwähnt. Ist es denkbar, dass er uns weiterhelfen könnte?»
«Könnte sein, ja. Er war über viele Jahre ihr Beichtvater. Er kannte sie wahrscheinlich besser als irgendwer sonst. Aber dass er dazu bereit ist, bezweifle ich.»
«War Ihre Mutter über die Weihnachtstage zweiundsiebzig in Luzern?»
«Abgesehen von kleineren Ausflügen in die Berge, ja.»
«Sie haben das also bereits überprüft?»
«Meine Tante hat es mir erzählt.»
Ich lehnte mich in meinem Stuhl zurück. «Was denken Sie?»
«Ich? Ich bin genau so ratlos wie Sie. Manchmal wünschte ich, ich könnte noch immer an die Geschichte mit dem Engländer glauben, den meine Mutter eines schönen Winters in Zermatt kennenlernte.»
«Ihre Mutter erwähnte, er sei adliger Abstammung gewesen?»
«Das gehörte zum Märchen.»
«Aber darauf legte sie wert.»
«Ja, schon.»
«Ihre Mutter hatte ein ausgeprägtes Standesbewusstsein, richtig?»
Salesia Pfyffer zündete sich eine Zigarette an. «Worauf wollen Sie hinaus?»
«Richtig oder falsch?»
Sie presste die Lippen zusammen.
Da ich einsah, dass ich so nicht weiterkam, erkundigte ich mich, ob sie in festen Händen sei. Sie lachte auf, stellte die Relevanz der Frage in Abrede.
«Ich will nur wissen, ob Sie einen Freund haben – ja oder nein?»
«Ja, ich habe einen Freund …»
«Patrizier?»
«Was?»
«Ob er patrizischer Herkunft ist!»
«Glauben Sie im Ernst, dass das für mich eine Rolle spielt?»
Ich griff nach der Tasse, liess sie dann aber an Ort und Stelle.
«Also kein Patrizier … Hat Ihre Mutter ihn gekannt?»
«Sie hat ihn ein paar Mal gesehen.»
«Und? Hat sie sich gut mit ihm verstanden?»
Sie machte ein Gesicht, als hätte ich einen wunden Punkt berührt.
«Also nicht wirklich … Darf ich raten? War sein Familienname zu wenig klingend in ihren …»
«Das hat doch damit nichts zu tun. Sie …»
«Ja?»
«Sie fand ihn – ordinär: seine Ausdrucksweise, seine Begeisterung für Sportwagen … Dass er mich ‹Chäferli› nennt.»
«Er nennt Sie ‹Chäferli›?»
«Im Spass, manchmal. Meine Mutter hat sich ein Urteil angemasst, obwohl sie ihn überhaupt nicht kannte.»
«Haben Sie sich deswegen gestritten?»
«Ein, zwei Mal. Aber es führte zu nichts. Meine Mutter behauptete immer, im Leben eines Menschen könne es nur eine einzige grosse Liebe geben. Man müsse sich daher gut überlegen, auf wen man sich einlasse.»
Ich bat den Kellner, der eben die Gesellschaft versorgt hatte, eine Flasche Mineral zu bringen. Um zu verhindern, dass Salesia Pfyffer ihre Aufmerksamkeit dem Nachbartisch zuwandte, erkundigte ich mich, ob viele Leute zur Beerdigung gekommen seien.
«Geht so …»
«Was heisst das?»
«Vielleicht dreissig, vierzig Leute …»
«Das ist nicht gerade viel für eine bekannte Persönlichkeit.»
«Ihr ironischer Ton gefällt mir nicht!»
«Hab ich? Das war nicht meine Absicht. Dreissig Personen sind wirklich nicht viel.»
Salesia Pfyffer drückte die Zigarette aus. «Meine Mutter verbrachte die letzten Jahre sehr zurückgezogen, der Kontakt mit Freunden und Bekannten beschränkte sich auf ein Minimum.»
Eine Gelächtersalve vom Nebentisch zerriss die nachmittägliche Restaurantruhe.
«Ist Ihnen jemand Unbekanntes aufgefallen», nahm ich das Gespräch wieder auf, «ein Mann ungefähr im Alter Ihrer Mutter?»
«Ich habe mich nicht nach den Leuten umgeschaut.»
«Und danach? Auf dem Friedhof? Niemand, der aus sicherer Distanz der Bestattung beigewohnt hätte?»
«Sie denken, mein … mein Vater könnte dort gewesen sein?»
«Warum nicht? Vermutlich hat er Ihre Mutter geliebt.»
«Ein Mann muss eine Frau nicht lieben, um sie zu schwängern!», belehrte sie mich.
Nachdem der Kellner das Mineral gebracht hatte, fuhr ich fort: «Und trotzdem. Denken Sie an den Vertrag: Für mich wirkt das wie eine Zurückweisung. Und zurückgewiesen werden in der Regel Menschen, die einen Anspruch geltend machen. Anspruch auf das Sorgerecht, womöglich. Aber vielleicht auch Anspruch auf Zuneigung. Bedenken Sie, dass Ihr Vater die Forderung des Vertrags einhielt, obschon er ihn offensichtlich nicht unterzeichnet und kein Geld angenommen hatte. Das klingt doch irgendwie – nach Entsagung aus Liebe …»
Salesia Pfyffer seufzte.
«Oder ist das zu – romantisch gedacht?»
Der Blick ihrer grossen braunen Augen war warm, aber er galt nicht mir. «Zumindest eine schöne Vorstellung …»
Nachdem sie mir versichert hatte, es sei ihr an der Beerdigung niemand Verdächtiges aufgefallen, brachte ich das Gespräch auf die Geschichte mit dem Engländer.
«Ich kann Ihnen auch nicht mehr erzählen, als Sie bereits erfahren haben.»
«Ihre Mutter lernt in Zermatt einen Engländer kennen, beginnt eine Romanze und wird schwanger, bevor der Mann vom ewigen Eis verschluckt wird. Damit haben Sie sich doch nicht abspeisen lassen!»
Salesia Pfyffer führte das Glas an die Lippen, trank und stellte es wieder ab. Dann begann sie mit leiser Stimme: Eines Abends vor dem Einschlafen, sie müsse da noch ein kleines Mädchen gewesen sein, habe sie ihre Mutter gefragt, warum alle Kinder einen Vater hätten; alle Kinder, nur sie nicht.
«Da erzählte mir meine Mutter das Märchen vom englischen Prinzen, der am Hof eines alpinen Fürsten die» – sie zeichnete Anführungszeichen in die Luft – «‹Frau seines Herzens› trifft. Er gesteht ihr seine Liebe und erfährt, dass seine Gefühle erwidert werden. Die Schwester der Geliebten aber zweifelt an seiner Aufrichtigkeit. Als Beweis seiner Liebe soll er in einer einzigen Nacht den Gornergletscher überqueren. Ohne zu zögern, bricht er noch am folgenden Abend auf. Er wird nie wieder gesehen. Die Geliebte aber kehrt in ihre Heimatstadt zurück, wo sie neun Monate später ein Kind zur Welt bringt.»
Nach einer kurzen Pause fuhr sie fort: «Immer aber, wenn es Winter wird und zu schneien beginnt, nimmt die Mutter ihr Kind bei der Hand und führt es nach draussen. Dann blicken sie nach oben, den Schneeflocken entgegen, die sie mit kalten Küssen bedecken. Denn nichts anderes sind diese ersten Schneeflocken als die Küsse des Vaters, der unentwegt an die beiden Menschen denkt, die er auf der Welt am liebsten hat.»
Salesia Pfyffer verstummte und blickte nach draussen.
Ich stellte mir vor, wie sie, als kleines Mädchen, an diese Geschichte geglaubt hatte wie andere an das Christkind.
«Von da an musste meine Mutter das Märchen jeden Abend erzählen. Mit der Zeit variierte sie es ein wenig; und ich stellte mir vor, wie ich den Prinzen eines Tages aus seinem Gefängnis im Gletscher befreien würde. Als ich älter wurde, wollte ich es genau wissen. Aber meine Mutter hielt an der Geschichte fest. Sie habe die Umstände lediglich ins Märchenhafte übersetzt.»
Sie senkte den Blick. «Während eines Streits, ich war da ungefähr siebzehn, nannte ich sie eine Lügnerin. Da sah ich meine Mutter zum ersten Mal in meinem Leben weinen. Danach habe ich sie nicht mehr damit behelligt.»
Als wir ein wenig später das Lokal verliessen, hielt die Stadt unter dem Getöse des Feierabendverkehrs den Atem an. Der Himmel hatte sich bedeckt und war nur noch eine vage Erinnerung an den vergangenen Tag. Schnee lag in der Luft, Schnee, der vielleicht in diesem Augenblick auf die erstarrten Wogen der Alpen fiel, dort in der Ferne, wo der Vierwaldstättersee sich in der Dämmerung verlor.
Ein Schrei hallte durch den gotischen Treppenturm, offenbar ausgestossen von mir. In der Tür stand die Person, deren sterbliche Hülle ich vor zwei Wochen durch eben diesen Eingang getragen hatte, stolz, streng und quicklebendig. Über letzteres konnte des Umstandes wegen, dass sie ebenfalls schrie, nicht der leiseste Zweifel bestehen.
«Ja … aber …», stammelte ich.
«Was erschrecken Sie mich derart!», schimpfte die Leiche aus ser Atem.
«Sie sind … sind Sie nicht gestorben?!»
Aus dem Innern der Wohnung waren eilige Schritte zu vernehmen. Kurz darauf erschien Salesia Pfyffer. Ihre Hände begannen zu sprechen, und ihr Mund synchronisierte: «Herr Arnold! Das ist die Schwester meiner Mutter! Eineiige Zwillinge, wissen Sie!»
«Verdammt», ich zitterte am ganzen Leib, «warum haben Sie mir das nicht gesagt?»
«Beruhigen Sie sich.»
«Schon gut, ich versuchs ja.»
Ich wandte mich an ihre Tante: «Entschuldigen Sie. Sie sehen Ihrer Schwester verflucht ähnlich, wirklich …»
Die vornehme Dame war noch ganz bleich vor Schreck und trat einen Schritt zurück.
«Also, kommen Sie herein», sagte Salesia Pfyffer, und an ihre Tante gewandt: «Wollt ihr euch im Salon unterhalten? Ich mache euch Tee – oder möchten Sie lieber Kaffee?»
Tee war wohl im Augenblick nicht das Schlechteste.
«Folgen Sie mir …», sagte die Tante mit schwacher Stimme und trippelte auf ihren hohen Absätzen durch den Flur voran. Das blonde, silberdurchwirkte Haar hatte sie zu einem Knoten aufgesteckt, sie trug eine weisse Bluse und ein blau-rot karriertes Kostüm mit neckischem Seitenschlitz am Rock.
Als wir ungefähr in der Mitte des Flurs anlangten, trat aus einem der reusswärts gelegenen Zimmer ein gutaussehender Mann Mitte dreissig. Salesia Pfyffers Tante lächelte ihm zu, er aber hielt den Blick unverwandt auf mich gerichtet. Er überragte mich um einen Kopf, war in einen flanellgrauen Mantel gehüllt und wog einen Zündschlüssel in der rechten Hand. Der passte wohl zum blauen Sportwagen, den ich unten in der Münzgasse gesehen hatte. Als ich dem jungen Mann zur Begrüssung zunickte, liess er den Schlüssel in der Hand verschwinden, indem er sie langsam zur Faust ballte. Die Geste wollte im Zusammenspiel mit dem fast ein wenig zu hübschen Männergesicht nicht recht gelingen. Im Vorübergehen streifte mich die Duftwolke seines nach irgendeinem klebrigen Cocktail riechenden Aftershaves.
Salesia Pfyffers Tante öffnete die Tür zu einem der Münzgasse zugewandten Zimmer.
«Nehmen Sie Platz – ich komme gleich nach.»
Der weite Raum, den ich betrat, war vom warmen Glanz des Tafelparketts und der Paneele erfüllt, deren goldbraune Farbe mich an Salesia Pfyffers Augen erinnerte. Von der stuckierten Decke hing ein Kronleuchter, zwischen zwei Fenstern stand eine hohe marineblaue Vase, gegenüber ein barocker Kachelofen. Um einen niedrigen Holztisch waren ein antikes Sofa und vier samtene Sessel angeordnet. Hier hätte sich wohl auch der päpstliche Gesandte zum Tee bitten lassen.
Ich steuerte auf das einzige Bild im Raum zu. Augenfällig, wie sich der hier Porträtierte – im Gegensatz zu seinen Kollegen im Schlafzimmer – nicht als finsterer Bauernschlächter dargestellt haben wollte. Er begrüsste einen mit offenem Blick, die linke Augenbrauen ein wenig gehoben, um den Mund ein gelassener Zug, als halte er einen Grashalm zwischen den Lippen oder wolle zu einem Lächeln oder einigen Pfeiftönen ansetzen.
«Eduard Pfyffer», vernahm ich Salesia Pfyffers Stimme in meinem Rücken. Sie hatte mit einem Tablett den Raum betreten, stellte es ab und trat zu mir.
«Der ältere Bruder von Kasimir Pfyffer. Er war ein grosser Reformer, insbesondere der Volksschule und der Höheren Lehranstalt. Einer, der die Zeichen der Zeit erkannt hatte. Wäre es nach ihm gegangen, Luzern hätte nach dem Ende des Ancien Régime wieder eine bedeutende Stellung eingenommen, wäre vielleicht sogar die Landeshauptstadt – und wir hätten eine richtige Universität.»
Sie liess die Arme sinken und sah mir in die Augen. «Also. Viel Glück mit meiner Tante. Vielleicht bringen Sie sie ja zum Reden. Versuchen Sie einfach nicht, witzig zu sein …»
Sie schenkte mir ein Lächeln und verliess den Raum.
Ich stand noch eine Weile Aug in Aug mit Eduard Pfyffer, bis Salesia Pfyffers Tante zurückkam und mich aufforderte, Platz zu nehmen.
Wortlos begann sie, uns Tee in altmodische Porzellantassen zu giessen. Sie hatte eine ruhige Hand, und jede ihrer Bewegungen schien einem vorgegebenen Muster zu folgen.
«Zucker?»
«Danke, ja.»
«Rahm?»
«Wieso eigentlich nicht.»
Nachdem sie mit der Zubereitung fertig war, sah sie auf und musterte mich, indem sie die linke Augenbraue hob.
«Also», versuchte ich einen Anfang, «zuerst möchte ich Ihnen mein Beileid aussprechen …»
«Ersparen Sie mir das.» Sie machte mit der Rechten Flatterbewegungen. «Was wollen Sie von mir?»
«Was ich will? Sie wurden doch von Ihrer Nichte bestimmt in Kenntnis gesetzt?»
Verflucht, es war nicht angenehm, unter ihrem starren Blick zu improvisieren.
«Ich möchte erfahren, was Sie mir über den Vater Ihrer Nichte erzählen können … Sie glauben doch, unter uns gesagt, nicht allen Ernstes an das Märchen vom Engländer im ewigen Eis?»
Sie starrte noch eine Weile weiter, bis ich schliesslich zu einem weiteren Satz ansetzte. «Ich will ja …»
«Schweigen Sie!», sagte sie mit schneidender Stimme. «Sie haben doch keine Ahnung! Sie platzen hier rein wie der letzte Marktschreier! Man sieht Ihnen aus hundert Meter Entfernung an, dass Sie keinen Schimmer haben. Mir ist schleierhaft, warum meine Nichte aussgerechnet Sie mit der Suche nach ihrem Vater beauftragt hat.»
Mich durchlief es heiss und kalt.
«Ich habe Ihr Bild in der Zeitung gesehen», sagte sie und lehnte sich in ihrem Sessel zurück. «Sie sind doch dieser Schreiberling aus der Agglomeration; Sie haben einen Krimi geschrieben – für diesen pseudomarxistischen Verlag in Zürich.»
Ich versuchte mich zu erinnern, wann mich das letzte Mal jemand derart in die Enge getrieben hatte.
«Wie kommen Sie nur auf die stümperhafte Idee, sich als Privatdetektiv auszugeben?»
Mein Mund war trocken, und der Tee wohl noch zu heiss. «Bis jetzt hats ganz gut funktioniert …»
«Wissen Sie, was Sie sind? Soll ich es Ihnen sagen?» Sie hob den Kopf und führte mir ihren noch jugendlichen Hals vor. «Sie sind ein Betrüger. Sie dringen schamlos in unsere Familie ein und setzen meiner Nichte Flausen in den Kopf.»
Ich räusperte mich: «Jetzt mal halblang …» Ich kramte in meiner Brusttasche und zog eine Zigarette hervor. «Darf ich?»
«Nein.»
«Nein? Dann …» Ich warf einen Blick auf die Zigarette. «Dann weiss ich nicht, was ich hier noch soll. Sie haben mich enttarnt, na schön. Richten Sie es Ihrer Nichte aus. Ich werde das Honorar zurückerstatten.»
Ich stand auf, zündete mir die Zigarette an. «Aber von meinem Verlag haben Sie keine Ahnung, wenn Sie ihn …»
«Machen Sie die Zigarette aus!»
«Bin schon gegangen.»
Sie bekam mich mit der Linken am Jackensaum zu fassen. «Dann gehen Sie gefälligst in die Küche.» Sie stellte die Tasse auf den Tisch und erhob sich. «Wir sind noch nicht fertig miteinander.»
Sie hielt mich am Arm, führte mich in die Küche und schaltete den Dampfabzug ein.
«Also, was gibts noch zu bereinigen?», sagte ich, nachdem wir uns gesetzt hatten.
Ihr Gesicht nahm wieder den Ausdruck strengen Hochmuts an. «Sie wollten doch von mir wissen, ob ich die Geschichte vom Engländer für wahr halte …»
«Genau.»
Sie lehnte sich ein wenig vor: «Natürlich – nicht.»
«Ja dann … Was können Sie …»
«Verschonen Sie mich mit Ihren Fragen. Was ich Ihnen zu sagen habe, werden Sie erfahren – nicht mehr und nicht weniger.» Sie griff mit spitzen Fingern nach ihrem Haarknoten. «Selbstverständlich weiss ich, wer der Vater meiner Nichte ist. Aber ich habe meiner Schwester selig versprochen, dass ich die Wahrheit unter keinen Umständen preisgebe. Niemand soll je seinen Namen erfahren, das war ihr Wunsch – und somit ist es auch der meine.» Sie deutete ein spöttisches Lächeln an. «Eigentlich kommt es mir gar nicht so ungelegen, dass jemand wie Sie mit der Suche beauftragt wurde. Sie werden die Wahrheit bis zum Sankt Nimmerleinstag nicht herausbekommen.»
Sie sah mich herausfordernd an.
«Rührend, wie Sie den Willen Ihrer Schwester respektieren. Aber haben Sie sich schon mal überlegt, was Sie damit Ihrer Nichte antun? Hat nicht jeder Mensch das Recht zu wissen, wer seine Eltern sind?»
Mit einem ekelhaften Pfeifgeräusch begann sie an den Speiseresten zwischen ihren Zähen zu saugen.
Ich legte meine Hände auf den Tisch. «Ist das demzufolge alles, was Sie mir zu sagen haben?»
Sie nickte. «Jawohl.»
Ich stand auf. «Ihre Nichte wird sich nicht freuen, das zu hören … »
«Das werden Sie nicht tun», sagte sie bestimmt.
«Und ob ich das tun werde.»
«Somit sehe ich mich gezwungen, Ihre Identität aufzudecken.»
«Tun Sie das.»
Sie sah mich mit grossen Augen an: «Dann verlieren Sie Ihren Auftrag, sind Sie sich dessen bewusst?»
«Natürlich.» Ich griff mit der Rechten nach der Stuhllehne. «In Zukunft muss ich halt meine Geschichten wieder frei erfinden. Solche Figuren wie Sie werd ich mir zwar niemals ausdenken können; aber das macht die Welt der Literatur auch nicht ärmer.»
Ich ersparte mir den Anblick ihres empörten Gesichts und stellte den Stuhl unter den Tisch. «Bleiben Sie ruhig sitzen, ich finde den Ausgang auch allein.»
«Warten Sie!»
Ich war bereits bei der Tür.
«Ich mache Ihnen ein Angebot.»
«Angebot?» Ich blieb stehen.
«Sie dürfen mir ein paar Fragen stellen, die ich Ihnen – soweit mich mein Versprechen nicht bindet – beantworten werde.»
Ich sass im «Central», Emmenbrücke, genauer gesagt im Zigarrenrauch des pensionierten Stahlarbeiters am anderen Ende des Tisches. Die letzten berufstätigen Mittagsgäste hatten das Lokal verlassen, und ausser mir, meinem Tischnachbarn und einem einsamen Säufer am Stammtisch war da nur noch Stjepan, der Wirt der altgedienten Arbeiterbeiz. Seit ich mein Zeitungsabonnement der stiefmütterlichen Besprechung meines letzten Buches wegen aufgekündigt hatte – sie hatten meinen Kriminalroman für nicht feuilletonwürdig erachtet –, und ich trotzdem nicht so tun konnte, als sei die Zentralschweiz publizistisch inexistent, kam ich regelmässig hier vorbei, trank meinen Kaffee oder auch mal ein Bier und raschelte ein wenig mit den Zeitungsblättern.
Die Welt bewegte sich in überschaubaren Dimensionen – etwas Aufruhr in Mazedonien, ein wenig Rinderwahnsinn in England, ein frisches Präsidentengesicht mit vertrautem Namen im Westen und im Nahen Osten nichts Neues. Im Sonderfall selbst sorgte man sich um die roten Zahlen der Swissair und die urangehärtete Munition der Nato, mit der auch unsere Soldaten in Berührung gekommen sein konnten. «Der Fluch des Balkan», hatte Stjepan düster verkündet, als vor einigen Tagen die Leukämiefälle bei ehemals in Serbien stationierten Nato-Soldaten die Runde gemacht hatten.
Ich wickelte das Blatt um den Zeitungshalter und unternahm den aussichtslosen Versuch, meine «Camel» gegen das «Rössli» meines Nachbarn ins Rennen zu schicken. Stjepan war seit geraumer Zeit in der Küche verschwunden, und der Mann am Stammtisch starrte Löcher in die Luft. Draussen vor dem Fenster staute sich der Verkehr auf beiden Seiten der Industriegeleise, weil die Stahlwerke gerade einen Güterzug voller riesiger Drahtrollen auf den Bahnhof verfrachteten, zur Entsendung in alle Welt.
Seit meinem letzten Besuch in der Münzgasse waren einige Tage vergangen. Salesia Pfyffer hatte sich noch am selben Abend telefonisch erkundigt, wie mein Gespräch mit ihrer Tante verlaufen sei. Ich sagte, sie habe an der Engländergeschichte festgehalten, aber ich hätte ebenfalls den Eindruck, dass sie mehr wisse.
Immerhin hatte ich nach ihrem Einlenken einiges über Charlotte Pfyffer in Erfahrung bringen können: Seit den späten Sechzigern bis zur Geburt ihrer Tochter hatte sie auf dem Sekretariat der Erziehungsdirektion gearbeitet. Diese Zeit war für das Luzerner Bildungswesen von grosser Bedeutung: Nach den gescheiterten Anläufen im vorigen Jahrhundert und einem weiteren in der Zwischenkriegszeit sollte nun auch die Zentralschweiz eine eigene Universität erhalten. Dank ihrer Tätigkeit bei der Erziehungsdirektion hatte sie diese Bemühungen, die unter dem Namen «Projekt 73» in die Geschichte eingehen und zu einer konkreten politischen Vorlage führen sollten, aus nächster Nähe miterlebt. So konnte sie im Spätherbst Zweiundsiebzig zusammen mit einer siebenköpfigen Delegation die Reformuniversität Konstanz besuchen, die in mancher Hinsicht als Vorbild für das eigene Vorhaben diente. In unserem Gespräch hatte mich Salesia Pfyffers Tante darauf aufmerksam gemacht, dass ihre Schwester, die sich bis dahin für Politik kaum interessiert hatte, am Unternehmen regen Anteil genommen hatte.
Ich hatte im Archiv der Zentral- und Hochschulbibliothek einige Tageszeitungen aus der fraglichen Zeit durchgesehen. Am Ende hatte ich eine Liste mit den Namen der Leute, die am «Projekt 73» mitgewirkt hatten. Vielleicht, so hoffte ich, befand sich darunter der Name des Mannes, der zu jener Zeit noch an einem anderen, eher privaten Projekt beteiligt gewesen war.
Eugen Roth, damals Prorektor an der Kantonsschule Alpenquai, hatte zur besagten Konstanzer Delegation gehört und war seit einigen Jahren in Pension. Seine Frau hatte mir am Telefon geraten, ihn im «Vögeligärtli» aufzusuchen, dort halte er sich nachmittags oft auf und spiele Schach.
Als Stjepan aus der Küche kam, bezahlte ich und verliess das Restaurant, nicht ohne meinem Tischnachbarn zum Abschied zuzunicken. Ich fuhr entlang den alten Wasserstrassen Richtung Innenstadt. Beim «Vögeligärtli» stieg ich ab und hielt auf die Stelle zu, wo unter einer kahlen Rosskastanie Schach gespielt wurde. Auf Anhieb erkannte ich Eugen Roth an seinem kurzgeschnittenen weissen Haarkranz. Er spielte mit dem Rücken zum Park und trug eine fleckige beige Lammfelljacke.
Ich blieb seitlich vom Spielfeld stehen und vertiefte mich ins Spiel, das sich in seiner Endphase befand. Roths Gegenspieler hatte derart viele Figuren verloren, dass ihm nicht einmal die Hoffnung auf ein Patt blieb. Als es zu Ende war, sah er auf seine Armbanduhr, murmelte ein paar Worte und verliess den Park in Richtung Bahnhof.
Plötzlich waren die spiegelnden Flächen von Roths Brille auf mich gerichtet. Er trug ein messingfarbenes Gestell in der Form eines umgedrehten Büstenhalters, wie es Anfang der Achtzigerjahre in Mode gekommen war.
«Haben Sie Lust, eine Partie zu spielen?»
Ich schüttelte den Kopf: «Das wäre keine Herausforderung für Sie.»
Einen Moment lang rührte er sich nicht, sagte dann: «Es geht nicht ums Gewinnen.»
Ich versuchte zu seinen Augen hinter den Brillengläsern vorzudringen. «Das glaube ich Ihnen nicht.»
Er ignorierte mein Lächeln. «So?»
Ich machte einen Schritt in seine Richtung. «Mag sein, dass Sie ein guter Verlierer sind. Aber wenn man für etwas kämpft, will man gewinnen. Im Spiel nicht anders als im Leben.»
Er schien in Gedanken zu versinken. Womöglich lag es auch nur daran, dass seine Brillengläser reflektierten.
«In Ihrem Alter ist der Glaube an die eigenen Möglichkeiten ungebrochen. Das war bei mir nicht anders.»
Ich wackelte mit dem Kopf. «Sie haben immerhin miterlebt, wie diese Stadt doch noch zu ihrer Universität kam.»
«Sie wissen, wer ich bin?»
Ich nickte: «Eugen Roth. Sie waren einer der Männer aus der Konstanzer Delegation.»
«Hm. Lange her.»Er steckte seine Hände in die Taschen seiner Lammfelljacke. «Interessieren Sie sich dafür?»
«Ich schreibe meine Dissertation darüber.»
«Über die Entstehung der Universität Luzern?»
«Im weitesten Sinn, ja, mit Schwerpunkt auf der 1978 abgeschmetterten Vorlage.»
Nach einer Weile sagte er: «Das war schmerzhaft …»
«Und aus heutiger Sicht kaum nachvollziehbar», warf ich ein.
«Das war es schon damals nicht. Es war ein Entscheid gegen alle Vernunft. Stellen Sie sich vor, selbst die Konservativen hatten die Vorlage befürwortet. Zwei Jahrzehnte Planungsarbeit für die Schublade.»
«Woran, glauben Sie, lag es?»
«Hmm. Vieles spielte da mit. Der Konjunktureinbruch, die Studentenunruhen – vielleicht eine in der Region weit verbreitete Intellektuellenfeindlichkeit.»
«Der Bauernkrieg?»
«Der wurde immer wieder heraufbeschworen. Aber es zeigte sich ja nicht dieses typische Stadt-Land-Gefälle – die Stadt und die Agglomeration hatten ebenso abgelehnt wie die ländlichen Gemeinden. Zudem gab es Ausnahmen: Hildisrieden, Wolhusen, Hitzkirch etwa hatten die Vorlage angenommen. Nein, ich glaube, das Projekt war einfach zu ehrgeizig für eine Region, die mentalitätsmässig noch nicht vollends im Zeitalter der Aufklärung angekommen war.»
Ich sah mich um und fragte: «Wären Sie bereit, mir bei einem Kaffee einige Fragen zu beantworten?»
Die Kellnerin kam mit zwei Tassen Kaffee auf unseren Tisch im «Bellini» zu.
«Studieren Sie in Luzern?», fragte Roth, während er Rahm in die Tasse goss.
Ich nickte, rührte Zucker in den Kaffee.
«Welche Richtung?»
«Neuere Allgemeine und Schweizer Geschichte», log ich.
«Richten Sie Ruedi Bischof einen Gruss aus. Er war einer meiner Schüler.»
«Stört es Sie?»
Roth schüttelte den Kopf.
Also brannte ich mir eine Zigarette an und fragte: «Können Sie sich noch an die Namen der Leute erinnern, die bei der Delegation nach Konstanz dabei waren?»
Roth zählte die meisten der Namen auf, die sich auf meiner Liste befanden. Bei manchen musste ich nachhelfen.
«Waren keine Frauen darunter?»
«Frauen?»
«Ich hab gedacht, die Sekretärin der Erziehungsdirektion …»
«Ah ja, Charlotte Pfyffer – die rechte Hand von Stalder.»
«Haben Sie sie gut gekannt?»
«Wir hatten beruflich miteinander zu tun.»
Eigentlich wollte ich testen, wie lange er meinem Blick standhalten würde, versetzte jedoch nach einer Weile: «Sie ist vor etwas mehr als zwei Wochen gestorben.»
Er machte ein erstauntes Gesicht. «Ah, das habe ich gar nicht mitbekommen …»
Nach einer längeren Pause meinte er: «Ich komme langsam in ein Alter, da einem die Todesanzeigen mit lauter bekannten Namen aufwarten.»
Roth begann die Eigenschaften einer sogenannten Reformuniversität zu erläutern. Das Luzerner Modell sollte sowohl einem Bedürfnis der Region wie auch einem gesamtschweizerischen nachkommen, da die bestehenden Hochschulen zusehends an ihre Grenzen stiessen. Charlotte Pfyffer erwähnte er mit keinem Wort mehr.
Ob unter den Teilnehmern auch persönliche Beziehungen entstanden seien, wollte ich wissen.
Die Frage schien ihn zu irritieren, er runzelte die Stirn, kam aus dem Nachdenken gar nicht mehr heraus.
Ich ging aufs Ganze und erklärte, ich sei mit Charlotte Pfyffers Tochter befreundet. Sie versuche herauszufinden, ob aus der Zeit noch Leute lebten, die sie hätte benachrichtigen müssen. Leute, die mit ihrer Mutter über das Berufliche hinaus zu tun gehabt hatten.
«Davon wüsste ich nichts. Ich glaube, Kaplan und Schorno spielten zusammen Tennis … und Richard Müller, wenn ich mich recht entsinne, veranstaltete einen Fasnachtsball – aber sonst?»
Das war auch schon alles, was ich an Indiskretion aus ihm herausbringen konnte. Nachdem ich bezahlt hatte, verliessen wir das Restaurant. Beim Abschied meinte Roth, vielleicht hätte ich ja ein andermal Lust auf eine Partie Schach.
Salesia Pfyffer bestand auf einem Treffen, um sich von mir «über den Stand der Ermittlungen» unterrichten zu lassen. Ich hatte am Telefon vergeblich erklärt, dass es da nicht viel zu berichten gäbe, ich stehe noch ganz am Anfang meiner Nachforschungen. Sie schlug als Treffpunkt die Terrasse des Hotels «Des Balances» vor – sie habe von ihrer Wohnung aus gesehen, dass sie wegen der milden Temperatur bereits geöffnet war.
Die Stadt war vorübergehend aus ihrem Winterschlaf erwacht. Ich stellte mein Velo auf dem Mühlenplatz ab und schlängelte mich durch die bummelnde Menschenmenge zum Hotel «Des Balances». Die Terrasse, ein langgezogener Balkon unmittelbar über der Reuss, war bis auf den letzten Tisch besetzt. Ich trat zur Seite, um einer Kellnerin Platz zu machen, als mich jemand bei meinem Decknamen rief. Salesia Pfyffer sass bereits an einem Zweiertisch und winkte mir zu. Ich begrüsste sie und entschuldigte mich für die Verspätung.
«Keine Ursache, ich bin auch erst gerade gekommen.»
Der Gespritzte, der vor ihr auf dem Tisch stand, liess mich daran zweifeln, aber kaum hatte ich mich gesetzt, trat eine Kellnerin heran und erkundigte sich nach meinen Wünschen. Da ich mir vorgenommen hatte, vor Einbruch der Dunkelheit und in weiblicher Begleitung nicht mehr zu trinken, bestellte ich ein Mineralwasser.