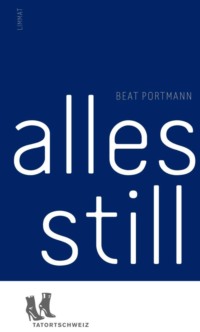Kitabı oku: «Alles still», sayfa 3
Ich warf einen Blick über die grüne Reuss zur Jesuitenkirche, deren Fassade scheinbar unmittelbar aus dem Wasser ragte.
«Mein ehemaliger Geschichtslehrer», sagte Salesia Pfyffer, die offenbar meinem Blick gefolgt war, «hat sie einmal als steingewordenen Albtraum Zwinglis bezeichnet, als Manifest mediterraner Lebensfreude und Provokation der reformierten Orte, die gerade erst eine verheerende Niederlage erlitten hatten.»
Sie wandte sich mir zu und fragte: «Erzählen Sie, wie weit sind Sie?»
Dass wir uns – beide um die dreissig – siezten, kam mir plötzlich ein wenig merkwürdig vor. Aber im nächsten Moment wieder fand ich, dass es unserer geschäftlichen Beziehung nur angemessen war.
«Sie müssen sich das wie bei einem Puzzle vorstellen …», begann ich und steckte mir eine Zigarette an. «Da schaut man auch zuerst: Über welche Teile verfüge ich, welche Formen, welche Farben haben sie; man trifft eine erste Auslese, sucht die Randteile heraus und steckt so nach und nach den Rahmen ab. Nur geschieht das alles ohne Vorlage – Sie wissen, was ich meine …»
Sie hielt den Blick unverwandt auf mich gerichtet.
«Ich hab Gespräche geführt, in Zeitungsarchiven gewühlt, mir die Briefe angeschaut», versuchte ich mir Mut zu machen. «Wissen Sie, zu Beginn ist es immer ein intuitives Vorantasten, das sich über längere Zeit hinziehen kann, bis man irgendwann auf die entscheidende Spur stösst.»
Ihr Blick war ein ganz anderer als der ihrer Tante, dennoch war eine gewisse Ähnlichkeit nicht von der Hand zu weisen. Warum bloss war ich nicht Lyriker geworden? Oder bildender Künstler. Oder halt Magaziner wie mein Vater.
«Fahren Sie fort, ich finde es interessant, wie Sie das beschreiben», munterte sie mich auf.
Die schmeichelhafte Tatsache ihrer Aufmerksamkeit verfehlte ihre Wirkung nicht.
«Im Augenblick bin ich daran, mich systematisch der Persönlichkeit Ihrer Mutter anzunähern. Ich versuche die Leute ausfindig zu machen, mit denen sie zu tun gehabt hatte. Führe Gespräche mit ihnen, halte die Augen offen, spitze die Ohren. Wenn Ihre Mutter eine – Liaison – hatte, dann wird es Personen geben, die das bemerkt haben. Glauben Sie mir, so was entgeht den Leuten nicht.»
Ich wollte einen kräftigen Schluck nehmen, hielt aber im letzten Moment inne und stellte das Glas unverrichteter Dinge wieder ab.
«Ich werde Ihren Vater finden, das verspreche ich Ihnen!»
Ich konnte ihr ja nicht gut sagen, dass das eine Frage der persönlichen Ehre war; dass ich das Duell, zu dem mich ihre Tante herausgefordert hatte, um jeden Preis gewinnen wollte.
«Das will ich auch hoffen», sagte sie mit einem hübschen Kräuseln der Nase.
«Ach übrigens», sie griff in ihre Handtasche. «Ich habe den Briefumschlag mitgebracht. Gut, dass Sie mich daran erinnert haben.»
Sie reichte mir ein weisses Couvert der Grösse C5. Darauf stand in rundlicher Schrift geschrieben: Frau Salesia Pfyffer. Sonst nichts, keine Adresse, keine Frankierung, kein Absender.
Ich drehte das Couvert wieder um. «Kennen Sie diese Schrift?»
Sie verneinte.
«Sieht nach einer Frauenhandschrift aus …»
Ich nahm einen letzten Zug, drückte die Zigarette aus und bemerkte, dass Salesia Pfyffer den Vorgang beobachtete.
«Vielleicht jemand aus Ihrem Umfeld, der möchte, dass Sie endlich die Wahrheit erfahren …»
«Ich wüsste nicht, wer.»
Während ich mich in meinem Stuhl zurücklehnte, fiel mein Blick auf den Brillantring, der an ihrem Ringfinger steckte.
Sie sah mich fragend an.
«Hübscher Ring, den Sie da tragen.»
Sie wurde ein wenig verlegen. «Hat mir Adrian zu unserem Jubiläum geschenkt … Gestern auf den Tag genau ein Jahr.»
«Gratuliere … Wie heisst eigentlich Ihr Freund mit ganzem Namen?»
Sie lächelte stolz. «Haben Sie ihn erkannt?»
Sollte ich das?
«Er ist mir irgendwie bekannt vorgekommen.»
Ihre Finger hatten seit längerem mit dem Glasuntersatz gespielt, aber nun machten sie sich daran, ihn systematisch zu zerlegen. «Maissen, Adrian. Er hat eine der ersten TV-Stationen im Internet gegründet – er leitet dort eine Talksendung. Aber seine wahre Passion gehört dem Film. Er führt Regie und hat eine eigene Produktionsfirma. Mit ‹Salz im Getriebe›, den er ohne Fördergelder produzierte, wurde er für den Schweizer Filmpreis nominiert …»
«Das macht Sie ein wenig stolz, nicht wahr?»
Ihre Finger liessen vom Glasuntersatz ab, da sie nun zum Sprechen gebraucht wurden. «Ich finde die Arbeit gut, die er macht, ja. Aber ich wusste nichts davon, als ich ihn kennenlernte – nicht wie all die anderen Frauen, die sich sonst so um ihn scharten.»
Ich schluckte. Gewissen Männern schien einfach alles zu gelingen: schöne Frauen, teure Autos, Erfolg. Oder in der anderen Reihenfolge? Jemandem wie Salesia Pfyffers Freund würde wohl niemand so leicht dreinreden – «mach doch wieder einen Krimi» –, der war sein eigener Herr und Meister.
«Ihr Freund, der Fabian …»
«Adrian …»
«Genau … Der Adrian, der scheint mich nicht besonders zu mögen …»
Sie spielte freundliches Erstaunen, aber ich schilderte ihr, wie er mich gemustert hatte, als ich ihm in ihrer Wohnung begegnet war.
Sie tat amüsiert. «Das ist seine Art – Sie dürfen das nicht überinterpretieren …»
«Da gibts nichts zu interpretieren – er war deutlich genug.»
Sie wurde nachdenklich. «Möglich, dass … Er ist zuweilen ein wenig eifersüchtig …»
Ich runzelte die Stirn. «Eifersüchtig?»
«Es braucht dazu nicht viel …» Sie biss sich auf die Unterlippe. «Ich habe ihm von unserer ersten Begegnung erzählt … Es ging um den ‹Freitod› – dass Sie diesen Ausdruck verwendet haben.»
In dem Moment schwangen sich zwei Schwäne mit kräftigen Flügelschlägen knapp über Wasser, überflogen in spektakulärer Steigung den Rathaussteg und wasserten kurz vor der Kapellbrücke wieder. Dass Salesia Pfyffer ihnen nachsah, nahmen zwei Männer vom Nebentisch zum Anlass, um mit ihr ein wenig zu plaudern.
«Kennen Sie die?», raunte ich, als sie sich wieder zu mir wandte.
Sie lächelte unbefangen: «Bis vor einigen Minuten nicht, nein.»
Ich bemerkte, wie die beiden gut situierten Mittvierziger anerkennend über Salesia Pfyffer sprachen. Und das alles nur wegen ein bisschen Frühling.
Plötzlich tippte ihr der eine auf die rechte Schulter. «Entschuldigen Sie – Frau Pfyffer?»
Sie nickte, immer noch lächelnd.
«Hab ichs nicht gesagt?», sagte er zu seinem Kollegen, und wieder zu ihr: «Ich habe den Zeitungsartikel gelesen … Über Ihr Hotel; und den Unternehmerpreis, den Sie dafür erhalten haben. Gratuliere!»
Sie bedankte sich höflich.
«Schade nur, dass Sie uns dort nicht empfangen …», warf der andere ein.
Offenbar begriff sie nun die Absicht, zog ihre schmalen Schultern hoch und sagte: «Es gibt sicherlich genügend andere Orte, wo man dies tut.»
Sie drehte ihnen den Rücken zu und sah mir in die Augen.
«Sie …»
«Ja?»
«Führen ein Hotel?»
Sie nickte. «Ein Hotel nur für Frauen; in erster Linie Geschäftsfrauen.»
«Interessant …» Ich sah, dass sich der Mann wieder seinem Tischpartner zuwandte. «Hier in Luzern?»
«An der Sempacherstrasse. Meine Mutter hat mir die Liegenschaft vor zwei Jahren überlassen. Ich wollte endlich einmal etwas eigenes auf die Beine stellen.»
«Darf ich fragen, was Sie zuvor gemacht haben?»
«Ach», sie winkte ab. «Nach der Matura fing ich mit Kunstgeschichte an. Aber ich vermisste das Praktische. Ich habe dann eine Zeit lang im Gastgewerbe gearbeitet und gemerkt, dass mich die Materie interessiert. So bin ich schliesslich an die Hotelfachschule gegangen.»
Ich steckte mir eine Zigarette an. Wieder irritierte mich der Blick, mit dem sie mich beobachtete.
«Was ist?» Sie lächelte arglos.
Ich stiess den Rauch zur Seite. «Sie haben mich so seltsam an geschaut.»
«Habe ich?»
Plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen. «Sie haben damit aufgehört!»
«Mein Vorsatz fürs neue Jahr. Ich habe ihn nur ein wenig aufgeschoben … Seit vier Tagen nun schon.»
«Nicht schlecht …»
«Vielleicht schaffen Sie es ja auch … Sagen wir, wenn Sie Ihre Ermittlungen abgeschlossen haben.»
«Ich will aber gar nicht. Und verwenden Sie nicht immer dieses Wort ‹Ermittlungen›. Das hat in meinen Ohren einen kriminalistischen Beiklang – und so viel ich weiss, handelt es sich in unserem Fall ja nicht um ein Verbrechen.»
«Bedeutet das, dass Sie mich inzwischen nicht mehr des Mordes verdächtigen?»
Ich räusperte mich. «Ich weiss, dass das nicht sehr pietätvoll war …»
«Das hat schon weh getan …» Sie wurde nachdenklich. «Manchmal wünschte ich, ich hätte diesen Vertrag in den Papierkorb geworfen … Aber jetzt ist es zu spät – was bleibt mir denn anderes übrig, als den Willen meiner Mutter zu respektieren?»
Sie sah mich mit ihren grossen Augen an.
«Ich hab mich einfach gefragt, wie Sie es schaffen, so gefasst zu sein», sagte ich, obwohl ich nicht vorhatte, mich zu rechtfertigen.
Salesia Pfyffer erwiderte nichts. Sie hatte die Lider gesenkt. Vielleicht sah sie ihren Fingern zu, die mit dem hohen Stiel des Glases spielten.
«Sie wollen eine Antwort?» Sie sah auf. «Ja? Die kann ich Ihnen geben.»
Viel Volk auch am Rathausquai und bei den Markthallen unter den Arkaden direkt an der Reuss. Wir bahnten uns einen Weg durch die flanierende Menge, an Gartentischen vorbei zum Rathaussteg. Es war eine Frage von Minuten, bis sich dieser Erdteil von der Sonne abwenden und sich die Plätze der Stadt nach und nach entvölkern würden.
Wir gingen über den gepflästerten Vorplatz der Jesuiten kirche und blieben bei der Eingangspforte des Ritter’schen Palastes stehen. Nachdem ich Salesia Pfyffer geholfen hatte, die massive Holztür aufzustossen, stöckelte sie durch die Vorhalle voran zum Innenhof.
Obwohl das Gebäude unter der Woche frei zugänglich war, konnte ich mich nicht erinnern, es je zuvor betreten zu haben. Ich blieb stehen und blickte an der dreigeschossigen Säulenhalle empor.
«Da staunen Sie, nicht wahr? Achten Sie auf die Sorgfalt und die Fertigkeit, mit der die Säulen und Baluster aus dem Stein gehauen sind.» Mit einer auffordernden Geste wandte sie sich dem östlichen Aufgang zu. «Schultheiss Lux Ritter, der diesen Wohnpalast baute, liess die Baumeister und Steinmetze eigens aus Italien kommen. Soviel ich weiss, gab es damals nördlich der Alpen nichts Vergleichbares.»
Wir stiegen auf den körnigen, weichen Sandsteinstufen ins dritte Geschoss.
«Sehen Sie», flüsterte Salesia Pfyffer und wies auf die grossen farbenprächtigen Gemälde, die an den Wänden des quadratischen Säulengangs hingen. Sie ging geradewegs auf ein Bild zu, das sich am Anfang der nördlichen Loggia befand.
Auf dem querformatigen Gemälde waren verschiedene Figuren dargestellt: In der linken oberen Ecke ein Engel mit erhobenem Feuerschwert – die drohende Geste galt einem spärlich bekleideten Paar, das von einem mumienhaften Wesen weggeführt wurde. Die Bildmitte wurde von einem Sarg und einer Gruppe musizierender Toter eingenommen. Am rechten Rand schliesslich sass auf einem Armlehnstuhl der Papst, nach dessen Tiara eine weitere Verkörperung des Todes griff.
«Ein Totentanz …»
«Adam und Eva bei der Vertreibung aus dem Paradies», präzisierte Salesia Pfyffer. «Mit ihnen kommt der Tod in die Welt.»
Sie sprach von der ungeheuren Dynamik der angedeuteten Bewegungen – hob insbesondere jene des Pauke spielenden Gerippes hervor, das mit den Armen weit über den Kopf zum Schlag ausholte. Daneben machte sie mich auf unzählige Details aufmerksam: «Hier zum Beispiel: der Apfel in Evas Hand – er ist wurmstichig.»
Ich trat etwas näher heran.
«Und der Tod, der das Paar aus dem Paradies führt – er ist der einzige im ganzen Reigen, der Augen hat.»
Ich nickte und vertiefte mich in die Szene, bis Salesia Pfyffer weiterging zum nächsten Bild.
«Kaiser, Kardinal, König», erläuterte sie, als ich hinzutrat. «Wie lebendig das alles wirkt, nicht wahr? Der Glanz der Metalle und der Stoffe, der Faltenwurf der Kleider, der individuelle Ausdruck in den Gesichtern.»
Sie begann zu referieren, indem sie den gestreckten Zeigefinger zu Hilfe nahm: «Der Kaiser ist mit allen Attributen seiner Würde ausgestattet: goldene Rüstung, Krone, Hermelinmantel, in der Rechten das Reichsschwert, in der Linken der Reichsapfel. Der Tod übrigens kommt als Türke mit Turban und grüner Schleife daher und hält dem Kaiser die Todesurkunde hin. Raffiniert, nicht? Und die unverschämte Art, wie er seinem Opfer ins Gesicht grinst!»
Weiter gings im Zyklus zur Kaiserin, zur Königin, zum Bischof und so fort, vom Benediktinerabt über den Kaufmann durch alle Stände hindurch bis hin zum Bauern, zum Krüppel und zum Kind.
«Eindrücklich auch, wie unterschiedlich die Reaktionen der Todgeweihten ausfallen», sagte Salesia Pfyffer mit leichtem Beben in der Stimme. «Die einen reagieren auf das Herantreten des Todes mit Furcht und Entsetzen, andere lassen sich bereitwillig an der Hand nehmen; oder sie bemerken ihn gar nicht, wie zum Beispiel das patrizische Hochzeitspaar.»
Seltsam berührt blieb ich vor der Darstellung des Malers stehen, eines eleganten jungen Mannes, der vor einer Staffelei sass und mit ahnungsvollem Ausdruck seitlich zu Boden blickte. Während die beiden benachbarten Figuren regelrecht aus ihrem irdischen Tun gerissen wurden, genügte hier ein sanfter Schlag auf dem Triangel, damit der Maler mit seiner Arbeit innehielt.
Wir hatten fast den gesamten Zyklus abgeschritten und kamen zum Schlussbild, dem einzigen Gemälde, das im Hochformat gehalten war. Vor einem Beinhaus, das bis zur Hälfte mit Knochen und Schädeln angefüllt war, spielten drei Tote zum Tanz auf.
«Man glaubt förmlich, die Töne der Pfeifen, das Kesseln und Dröhnen der Schlaginstrumente zu vernehmen!», flüsterte Salesia Pfyffer.
Aus der Tiefe des Innenhofs hallten Schritte und laute Stimmen, klangen noch lange in den Gewölben der Loggien nach.
«Als meine Mutter zum ersten Mal mit mir hierher kam, war ich ungefähr sieben Jahre alt.»
Ich sah sie von der Seite her an.
«Sie können sich vielleicht vorstellen, wie beeindruckt ich war.»
Ihre Hände begannen zu gestikulieren. «Ich war verängstigt. Aber auch fasziniert: die Würde der Todgeweihten, die Schönheit ihrer Haltung, ihrer Kleider; das leuchtende Licht, das sie von Westen her bescheint! Dieser Totentanz wird zurecht als Meisterwerk des Manierismus bezeichnet.»
Sie verstummte und wandte sich mir zu. Ihre Augen waren riesig. «Wissen Sie, ich habe es immer vorgezogen, den Tod als Bestandteil des Lebens zu betrachten. Er ist das Mass aller Dinge – erst er macht das Leben so einzigartig und wertvoll …»
Sie sah mich erwartungsvoll an, aber mir fiel gerade nichts Geistreiches ein. Ich war viel zu sehr vom Leuchten ihrer Augen in Anspruch genommen, als dass ich mich an irgendein adäquates Versatzstück aus dem Philosophieunterricht hätte erinnern können.
Sie begann unmerklich zu lächeln, blickte zu Boden und meinte mit unwiderstehlichem Augenaufschlag: «Ich hoffe, Ihnen genügt dies als Antwort …»
Als ich an diesem Tag nach Hause kam, war es schon ziemlich spät. Genau genommen war es bereits der nächste Tag, und zwar früh. Aber so fühlte es sich nicht an. Es fühlte sich an, wie es sich eben anfühlt, wenn man nach einem langen erlebnisreichen Tag nach Hause kommt. Ich schob mein Velo auf dem Trottoir die Gerliswilstrasse hinauf, eine menschenleere, vom Wind durchwehte Schlucht unter einem wolkenlosen Nachthimmel, an dem Linienflugzeuge ein wenig Dynamik in die starren Sternbilder der alten Griechen brachten.
Ich hatte, um das nicht länger zu verschweigen, gehörig einen sitzen. Das war in letzter Zeit nicht sehr oft vorgekommen. Seit mein Freund und Zechbruder Adnan nämlich Vater geworden war, hatte die Häufigkeit unserer gemeinsamen Unternehmungen spürbar abgenommen. Wenn er sich dann doch einmal seinen väterlichen oder partnerschaftlichen Pflichten entziehen konnte, wollte das entsprechend gefeiert werden.
Nach der Besichtigung des Totentanzes hatte ich Salesia Pfyffer nach Hause begleitet. Sie hatte die Fotografien, die sie auf mein Verlangen von ihrer Mutter aus der fraglichen Zeit herausgesucht hatte, auf ihrem Schreibtisch liegen gelassen. Ich war eben im Begriff zu gehen, als aus einem der Zimmer ihre Tante trat. Sie war ausgesprochen freundlich und meinte, da sei noch etwas, was sie mir neulich zu sagen vergessen habe. Ihr sei nämlich eingefallen, dass bei ihrer Schwester in jenen Tagen nebst dem Interesse für Politik auch ihre Leidenschaft für klassische Musik erwacht sei. Sie führte mich ins «Musikzimmer» und wies auf ein Phonomöbel mit altertümlicher Stereoanlage und einem Fach für die Langspielplatten. Ob es sich dabei um ein Geschenk gehandelt habe, könne sie nicht sagen, aber mit Sicherheit sei diese Anschaffung nicht ohne Anstoss von aussen getätigt worden. Sie habe gedacht, dass diese Information womöglich von Nutzen sein könne, schloss sie und lächelte mir und ihrer Nichte zuckersüss zu.
Da Adnan also entschieden hatte, ein nützliches Mitglied der Gesellschaft zu werden und auf Drängen seiner Freundin nach Luzern gezogen war, starteten wir unsere Touren jeweils in der «Freien Schweiz», die uns an die gemütlichen Kneipen Emmenbrückes erinnerte: dunkles Holz, von Rauchschwaden gedämpftes Licht, abenteuerliche Gestalten. Ich war von der Münzgasse direkt dorthin gegangen. Als Adnan eintraf, war ich bereits bei der zweiten Flasche.
Wie immer war er guter Laune, auch wenn man ihm die Spuren der halb durchwachten Nächte ansah. Er zeigte grosses Interesse an meinem neuen Fall und war beruhigt, dass er nicht mit seiner elterlichen Heimat Bosnien zusammenhing und deshalb «bestimmt eine unkomplizierte Sache» sein würde. Ungefähr so sah ich das auch.
Dann berichtete Adnan, dass er, wie von mir aufgetragen, letzte Woche den Luzerner Buchhandlungen einen Besuch abgestattet hatte.
«Und?», fragte ich beklommen.
«Bist überall noch da.»
«Hirschmatt?»
«Sogar noch drei Exemplare.»
Ich lehnte mich zurück und nahm einen kräftigen Schluck.
«Mein Vater hat es übrigens auch gelesen. Er liest ja sonst keine Krimis, überhaupt Romane – du weisst ja, nur Zeitungen und Sachbücher.»
Er machte eine Pause, und ich versuchte gleichgültig dreinzuschauen.
«Er fand es gut. Ich meine, richtig gut. Es sei wichtig, dass es viele Leute lesen. Nach dieser Leküre hätten sie eine andere Sicht auf die Dinge, etwas mehr Verständnis, würden die Zusammenhänge besser verstehen.»
Adnan sah mich erwartungsvoll an.
Ich zuckte mit den Achseln. «Weiss nicht. Da macht er sich womöglich zu viel Hoffnung. Ein Rezensent, zum Beispiel, hat dich kurzerhand zum Serben gemacht.»
«Zum Serben?!» Adnan bekreuzigte sich auf orthodoxe Art und prustete los: «Pičku Materinu, zum Serben!»
Unsere Tour dann führte uns so ziemlich in jedes Lokal, das auf dem Weg zu Adnans trendigem neuen Wohnort bei der Tribschen lag. Am Ende waren wir in der «Boa» gestrandet, wo wir mit einer Gruppe Autonomer darüber debattierten, ob sich Che-Guevara-T-Shirts auch so gut verkaufen würden, wenn der tropische Revolutionär beispielsweise wie Roger Köppel ausgesehen hätte.
Ich lehnte mein Velo an die Hausmauer und grub in meiner Hosentasche nach dem Schlüsselbund. Plötzlich trat mir wieder vor Augen, wie wir im «Werkhof» zu Britpop und anderem maniriertem Gitarrenrock unsere irren Punkerbewegungen gemacht hatten. Ich hatte uns dabei in einem Moment der Klarheit zugeschaut und erleichtert festgestellt, dass unsere Verrenkungen immer noch pubertär genug waren, um damit an jeder Ü-30-Party Angst und Schrecken zu verbreiten.
Ich trug mein Velo in den Keller und gelangte mit Hilfe der Wand und des Handlaufs in den dritten Stock. Als ich die Wohnungstür aufstossen wollte, legte mir jemand eine Hand auf die Schulter. Überflüssig zu erwähnen, dass ich zu Tode erschrak.
«Psst, ich bins, Petar.»
«Was …» Meine Artikulation liess zu wünschen übrig. «Was machst hier?»
«Lass mich rein, ich erzähls dir drin.»
Er quetschte meine Hand, mit der ich mich an der Türfalle festhielt, öffnete und schob mich in die Wohnung. Ich liess mich an der Wand zu Boden gleiten. Petar machte Licht.
«Mann, hast du eine Fahne!» Er stand breitbeinig über mir und sah sich im Gang um. «Bist du allein hier?»
Ich hob mühsam den Kopf und versuchte sein Gesicht anzuhalten. «Was denkst denn du?»
«Vielleicht eine Frau, eine Freundin oder so.»
Ich musste das Aufstossen der vielen Biere unterdrücken.
«Gut. Sehr gut.»
Er begann die Wohnung zu inspizieren. Ich hörte, wie er Türen aufstiess, und stellte mir vor, wie er die intime Landschaft meiner Zimmer begaffte. Dann kam er zurück und sah mit blödem Ausdruck auf mich herunter. «Kann ich bei dir pennen?»
Ich lallte Unverständliches, was er als Zustimmung deutete.
«Hab gesehen, dass man dein Sofa ausziehen kann.» Er ordnete sein Gehänge und meinte: «Wenn du nichts dagegen hast, stell ich mich rasch unter die Dusche.»
Ich sah seinen Beinen nach, die im Badezimmer verschwanden.
Mein Wecker zeigte halb zwölf. Draussen schien die Sonne. Vom Stahlwerk her stieg eine Rauchsäule in den eisblauen Himmel. Ich stützte mich auf meine Ellbogen und drehte vorsichtig den Kopf hin und her. Ich war immer noch betrunken, aber mein Magen war in Ordnung und mein Kopf auch, und so beschloss ich aufzustehen. Als ich ins Wohnzimmer trat, entdeckte ich Petar, der umgekehrt auf einem Stuhl sass und aus dem Fenster sah. Allmählich kam mir alles wieder in den Sinn.
Nachdem ich geduscht und frische Kleider angezogen hatte, verspürte ich einen leichten Hunger.
«Schon gegessen?», fragte ich Petar, der immer noch aus dem Fenster sah.
«Hab die vergammelte Pizza weggeputzt. War gar nicht mal so übel.»
«Danke. Hab ich selber noch ein wenig verfeinert, mit Ketchup und Tabasco und so.»
Petar hatte mir noch immer den Rücken zugewandt.
«Ich koch uns Ravioli. Und Kaffee, genau, Kaffee, starken Kaffee.»
Ich rief ihn in die Küche, als ich soweit war, und schaufelte die schwabbelige Masse in unsere Teller. Dann schenkte ich Kaffee ein und setzte mich zu Petar an den Küchentisch.
Ich wollte ihm gerade guten Appetit wünschen, als ich vor Schreck beinahe die Gabel fallen liess: Petars Gesicht war durch üble Kratzer und Schürfwunden verunstaltet. An manchen Stellen hatten sich Blutkrusten gebildet.
«Halb so wild, Mann», wimmelte er meine Fragen ab.
Ich liess mich nicht beirren.
Petar schob sich eine gehäufte Gabel in den Mund, würgte und murmelte: «Bin fucking tief in die Scheisse geraten …»
Eine seltsame Empfindung ergriff mich, eine Mischung aus Mitleid und ethnologischem Interesse; noch nie hatte ich Petar in so niedergeschlagenem Zustand gesehen. Ich war im Gegenteil davon ausgegangen, einer Frohnatur wie ihm müsse etwas Vergleichbares ganz und gar fremd sein.
Er warf mir über den Teller hinweg einen Blick zu und meinte: «Lass uns zuerst essen, dann erzähl ich dir alles.»
Mein Hunger war geringer, als ich gedacht hatte, und so wandte ich mich schon bald meinem Kaffee und einer Zigarette zu.
«Hast mir auch eine?», fragte Petar, nachdem er auch meinen Teller leergegessen hatte.
Ich schob ihm die Packung zu. «Also.»
«Ganz einfach …», er stiess Rauch aus, «ich bin aufgeflogen.»
Er trank Kaffee und fing meinen ungeduldigen Blick auf. «Die Bullen sind mir auf die Schliche gekommen! Sie haben meine Leute verhaftet und die Zentrale gestürmt. Ich bin ihnen haarscharf entkommen, und jetzt muss ich mich verstecken.»
«Aufgeflogen? Verhaftet? Entkommen?»
«Ja Mann, in dieser Reihenfolge.»
Ich machte mit der Rechten ungeduldige Bewegungen. «Etwas detaillierter, wenn ich bitten darf. Mir wird zwar eine rege Fantasie nachgesagt, aber deine kriminellen Abenteuer übersteigen meine Vorstellungskraft bei weitem.»
Petar zog an seiner Zigarette, die er prahlerisch zwischen Daumen und Zeigefinger hielt. «Was willst du wissen?»
«Was ich …? Ja zum Beispiel – wie du entkommen bist!»
«Hab Schwein gehabt, Mann. Ich war in der Zentrale, wo ich auf Ruedi – einen meiner Männer – wartete. Er war schon seit über einer Stunde fällig. Ich wurde ein wenig nervös. Hatte in letzter Zeit eine Menge Ärger, weisst du. Hab ein Geschäft ausgeschlagen, weil es mir zu riskant war. Darauf versuchten mich die Typen unter Druck zu setzen, drohten, mich bei den Bullen zu verpfeifen …»
Er zog Rotz hoch und fuhr fort: «Ich war also alarmiert, als Ruedi nicht auftauchte. Er ist sonst der zuverlässige Typ. Vorsichtshalber schloss ich die Tür ab. Etwa gegen sieben, draussen war es dunkel und Ruedi schon seit zwei Stunden fällig, klopfte es an der Tür.»
Er streifte Asche ab, wobei die Hälfte danebenging. «Die übliche Show halt: Polizei, aufmachen, wir haben das Gebäude umstellt! Ich fackelte nicht lang, ging in die Wohnung, nahm meine Sachen und stieg in den Fluchtkanal.»
« Fluchtkanal?»
«Ja Mann. Hab ich niemandem gezeigt. Unter der Spüle befindet sich eine Falltür, durch die bin ich in den Fluchtkanal gestiegen. Hab vor ein paar Jahren auf einer alten Karte entdeckt, dass unter meinem Grundstück ein unterirdischer Bach verläuft, der direkt in die Emme geht. Hab dann einen Zugang gebaut, für solche Fälle.»
Ich war beeindruckt. «Und dann bist du also durch diesen unterirdischen Bach gegangen?»
«Gekrochen! Diese Scheissröhren haben höchstens sechzig Zentimeter Durchmesser. An manchen Stellen sind sie eingebrochen. Hatte schon lange keinen Kontrollgang mehr gemacht und eine verfluchte Angst gehabt, sie könnten inzwischen verschüttet sein.»
Er zerknautschte die Zigarette im Aschenbecher.
«Und dann?»
«Zum Glück hat es schon länger nicht mehr geregnet. Bin dann im Flussbett bis zur Stelle gegangen, wo sie den Kanal hineinleiten, und von dort weiter zum Schosswald. Dort hab ich mich im Gestrüpp versteckt. Irgendwann dachte ich, ich könnte bei dir vorbeischauen. Hab im Estrich auf dich gewartet, sicher fünf Stunden.»
Ich verteilte den restlichen Kaffee in unsere Tassen.
«Und jetzt, was hast du vor?»
Petar zuckte mit den Schultern. «Muss mich wohl eine Zeit lang bei dir verstecken. Bis mir was Besseres einfällt.»
Ich hatte Petar vor etwas mehr als zwei Jahren kennengelernt. Seine «Firma», die offiziell mit Gebrauchtwagen handelte, erledigte für dubiose Auftraggeber kleinere Gefälligkeiten wie vorgetäuschte Einbrüche zwecks Versicherungsbetrugs, Transport heikler Ware, Einschüchterungen und dergleichen mehr. Seine Hilfe war mir bei den Recherchen für meinen letzten Roman von unschätzbarem Wert gewesen. Zudem hatte er mir damals Asyl gewährt, als ich für einige Zeit untertauchen musste. Ich konnte also nicht Nein sagen.
«Also gut, du kannst bleiben. Aber bei mir pisst man im Sitzen!»
«Hey Mann, voll schwuchtelmässig!»
«Mir egal, wie du deine Männlichkeit definierst. Und noch was: vor Mittag keinen Lärm – und keine kriminellen Machenschaften von meiner Wohnung aus!»
«Schon klar, Mann, bin ja nicht blöd.»
Das Ehepaar Müller residierte in Sichtweite des Kapuzinerklosters Wesemlin in einer Villa, die wohl einst als Sommersitz einer in fremden Kriegsdiensten reich gewordenen Patrizierfamilie gedient hatte. Ich hatte meinen Besuch am Telefon mit fadenscheinigen Verweisen auf Eugen Roth und meine angebliche Dissertation angekündigt – und zu meiner Überraschung damit Erfolg gehabt. Frau Müller hatte mich im Namen ihres Mannes zum Nachmittagstee eingeladen.
Ein uraltes quirliges Weiblein – offenbar Frau Müller – öffnete mir die Tür. «Herr Arnold?! Wir haben Sie bereits erwartet!»
In aller Freundlichkeit bat sie mich herein und führte mich in den Salon, wo sie mich aufforderte, ihrem Mann gegenüber Platz zu nehmen.
So fand ich mich einmal mehr in feudaler Umgebung wieder. Ich liess den Blick über die goldenen Ornamente der weiss bemalten Paneele gleiten. Allmählich hätte ich mich daran gewöhnen können. Ich stellte meine Ledermappe neben das Sofa und war froh, mein bestes Hemd angezogen zu haben.
Richard Müller, der in seinem Sessel hing und mich – oder was immer er dort sah – mürrisch anstarrte, war entweder schwerhörig oder debil oder beides zusammen. Seine Frau hatte mich mit lauter Stimme vorgestellt, worauf er nur ein wenig mit den Mundwinkeln gezuckt und mir eine knochige schlaffe Hand gereicht hatte. Mit der Erklärung, sie gehe Tee kochen, hatte Frau Müller den Raum verlassen.
In der Zwischenzeit, so sagte ich mir, könnte ich mit dem alten Herrn ein wenig Konversation treiben.
«Schön haben Sies hier!», schrie ich so freundlich wie möglich.
Er zuckte heftig zusammen. Seine Hände hoben zitternd von den Armlehnen ab, die Augen weiteten sich, der Mund sprang auf und entliess röchelnde Laute. Ich wollte gerade vom Sofa aufspringen und Frau Müller um Hilfe rufen, als er sich urplötzlich beruhigte und exakt den gleichen Gesichtsausdruck aufsetzte wie vor meinem Gesprächsversuch.
Ich hielt eine Weile seinem grämlichen Blick stand, griff dann zu meiner Ledermappe, zog ein Couvert hervor und entnahm ihm einige Fotografien. Sie zeigten Charlotte Pfyffer in verschiedenen Umgebungen: vor der Basilika in Rom, das Gesicht der Sonne zugewandt, in einem orangen Sommerkleid; mit zwei Schweizergardisten, lächelnd, im gleichen blumengemusterten Kleid; zusammen mit ihrer Schwester auf einem Segelschiff, womöglich auf dem Vierwaldstättersee; und zuletzt eine Porträtaufnahme von den Schlüsselbeinen an bis zum toupierten Frisurhorizont. Die Frau war von ergreifender Schönheit: helle, durchschimmernde Haut, ausgeprägte Wangenknochen, die grünbraunen Augen immer ein wenig wässrig. Ihr Lächeln, wenn es auch ein verhaltenes war, strahlte Herzlichkeit aus. Dagegen wirkte ihre Schwester – in den meisten Äusserlichkeiten ihr Ebenbild – wie eine Nachbildung aus Wachs.
Ich stand auf und ging auf Herrn Müller zu. Er war mir mit den Augen gefolgt und blickte nun ebenso folgsam auf die Fotografie, die ich ihm hinhielt.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.