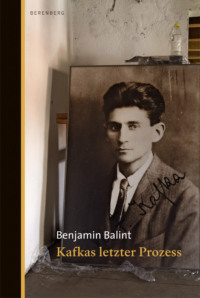Kitabı oku: «Kafkas letzter Prozess», sayfa 4
Von Anfang an stellten die beiden Anwälte die Position der Nationalbibliothek als Versuch dar, Privateigentum zu verstaatlichen. Das Urteil von Richter Schilo aus dem Jahr 1974, mit dem der Vorstoß des Staates, sich die Kafka-Manuskripte anzueignen, abgewehrt wurde, solle Bestand haben, argumentierten sie und riefen Richterin Kopelman Pardo in Erinnerung, dass Schilo im damaligen Verfahren, anders als im gegenwärtigen, Ester Hoffes Aussage selbst hatte hören können. »Die Ansprüche der Bibliothek waren bereits Gegenstand eines Verfahrens […] und wurden in einer Weise entschieden, die für eine erneute Verhandlung keinen Raum lässt.«
Ohnehin dürfe man die Kafka-Papiere nicht als Teil von Brods Nachlass betrachten, so Uri Zfat. Da Brod in seinem Testament Kafkas Papiere nicht gesondert erwähnt habe, sei er sich durchaus bewusst gewesen, dass sie nicht mehr zu seinem Nachlass gehörten; er hatte sie Ester Hoffe ja bereits geschenkt. Und schließlich habe die Nationalbibliothek in den Jahren, in denen sie mit Ester Hoffe über die Kafka-Schriften verhandelt habe, nie auch nur angedeutet, dass sie sich selbst als rechtmäßige Erbin verstanden hätte.
Schmulik Cassouto, Ester Hoffes Nachlassverwalter, fügte hinzu, der Vorstoß des Staates, die Manuskripte an sich zu reißen, komme »offener Bevormundung« gleich und sei »eines demokratischen Staates, als der sich Israel präsentiert, unwürdig«. Cassouto fuhr fort: »Es ist nicht an uns zu entscheiden, ob Brod seinen Nachlass der Person hinterlassen hat, die dafür am besten ›geeignet‹ war. Auch steht es uns nicht zu, in Zweifel zu ziehen, was ihm am meisten am Herzen lag. Der Staat mag Recht haben mit der Behauptung, dass es für Brod besser gewesen wäre, wenn er Frau Hoffe nicht so nahe gestanden hätte, oder dass er seinen ›Schatz‹ besser einem passenderen Erben vermacht hätte – und einen passenderen Erben als den Staat Israel gibt es nicht. Aber Brod hat Frau Hoffe eben nahegestanden. Für ihn war sie die einzige verbleibende Familie, und ihr wollte er alles geben, was er besaß. Dieser Wille muss respektiert werden.«
Da Brod die Kafka-Manuskripte zu Lebzeiten als Schenkung an Ester Hoffe gegeben habe, so Cassouto, seien diese Manuskripte de facto und de jure nicht Teil des Brod-Nachlasses und somit nicht Gegenstand der Testamentsauslegung. Was Brods eigenen Nachlass angehe, habe er Ester Hoffe testamentarisch eindeutig das Recht übertragen, zu entscheiden, wo sie ihn hingebe und unter welchen Bedingungen. Wenn die Nationalbibliothek Anstand beweisen wolle, fuhr er fort, würde sie mit Eva Hoffe über den Erwerb der Manuskripte verhandeln, statt sie dermaßen unter Druck zu setzen. Dass die Nationalbibliothek die Manuskripte erhalten könnte, ohne Eva Hoffe dafür zu entschädigen, bezeichnete er als »absurd«.
Abgesehen von solchen juristischen Feinheiten waren die Sitzungen vor dem Familiengericht von Tel Aviv jedoch von allgemeineren Überlegungen darüber beherrscht, wo Kafkas und Brods Erbe nun eigentlich hingehöre. »Wie bei vielen anderen Juden, die ihren Beitrag zur westlichen Zivilisation geleistet haben«, sagte Meir Heller über Kafka, »sollten sein Erbe [und] seine Manuskripte unserer Ansicht nach hier im jüdischen Staat verbleiben.« Auch Ehud Sol (von der angesehenen israelischen Anwaltskanzlei Herzog, Fox und Neeman), gerichtlich bestellter Verwalter des Brod-Nachlasses, argumentierte, das Gericht müsse, wenn es zwischen Marbach und der Nationalbibliothek entscheide, auch Kafkas und Brods Haltung »zur jüdischen Welt und zum Land Israel« berücksichtigen, ebenso wie Brods Haltung zu Deutschland nach der Schoah. Die Frage, wie wichtig Brod und Kafka das jüdische Volk und seine politischen Ziele waren, sollte sich für den Prozess – und für die Urteile der Richter – als entscheidend erweisen.
4
Flirt mit dem Gelobten Land
Festsaal im Hotel Central, Prag, 20. Januar 1909
[Ich wäre], wenn schon nicht nach Palästina übersiedelt, doch mit dem Finger auf der Landkarte hingefahren.
FRANZ KAFKA, 19181
Der Theologe Martin Buber, Apostel eines neuen, geistig dynamischen Judentums, hielt einen Vortrag im Prager Hotel Central. Eingeladen hatte der zionistische Studentenverein Bar Kochba, der von Hugo Bergmann geleitet wurde. Bergmann hatte, ebenso wie Felix Weltsch und Hans Kohn, mit Kafka die erste bis zwölfte Klasse besucht.2 Für Buber, Herausgeber von beliebten Anthologien traditioneller chassidischer Erzählungen aus dem 18. Jahrhundert, war es der erste von drei Vorträgen (im Januar 1909 und im April und Dezember 1910) über die Wiederbelebung des Judentums.3 Es war nicht die erste Begegnung zwischen den Prager Zionisten und Buber, der Prag bereits 1903 anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Bar-Kochba-Vereins besucht hatte, wohl aber der bedeutsamste.
Max Brod, damals 25, hatte in dem vollbesetzten Festsaal bereits dem Vorprogramm beigewohnt: Die sechzehnjährige Schauspielerin Lia Rosen rezitierte mit verführerischer Stimme Gedichte Hugo von Hofmannsthals (mit dem Rainer Maria Rilke sie im November 1907 in Wien bekannt gemacht hatte).4 Auch sang sie Richard Beer-Hofmanns »Schlaflied für Mirjam« mit den Zeilen:
Was ich gewonnen, gräbt man mit mir ein.
Keiner kann keinem ein Erbe hier sein.
Als Buber die Bühne betrat, war Brod beeindruckt von der wachen Intelligenz, die in seinen Augen loderte. Ihn begeisterten die ausgefeilten Sätze zur jüdischen Selbstbestimmung, die wortgewaltigen Ausführungen über die geistige Erneuerung. »Warum nennen wir uns Juden?«, fragte Buber. »Weil wir es sind? Was bedeutet das, daß wir es sind?« Er frage nicht nach den »Formationen des äußeren Lebens, sondern nach der inneren Wirklichkeit«.5
In seiner Autobiografie schrieb Brod, er habe bis dahin dem jüdischen Studentenverein als »Gast und Opponent« angehört, sei jedoch als Zionist aus Bubers Vorträgen herausgekommen. Zuvor habe er keinerlei jüdischen Selbsthass in sich gespürt, aber auch keinen besonderen jüdischen Stolz. Die Begegnung mit Buber veränderte Brods Haltung zum jüdischen Leben und in der Folge auch seine Haltung zu Kafka und zu Kafkas Literatur. Hier habe sein Kampf für, ja sein »Kampf um das Judentum« begonnen, wie der Titel eines seiner Bücher lautete. Bubers Vorträge spornten Brod an, etwas zu artikulieren, das er und viele andere deutschsprachigen Juden bis dahin nur vage gespürt hatten: Der Versuch, sich mit dem »deutschen Geist« zu identifizieren, war gescheitert. Diesem Scheitern folgte eine intensive Auseinandersetzung mit der »persönlichen Judenfrage«, wie Robert Weltsch es später formulierte. Brod sei von der fast ausschließlichen und bewussten Beschäftigung mit ästhetischen Aspekten zu einer vollständigen Identifizierung mit dem jüdischen Volk gelangt, so Weltsch.6
Ausgangspunkt für diese Auseinandersetzung war das Gefühl der Fremde. »Der deutsche Jude im tschechischen Prag verkörperte sozusagen das Fremde und das bewusste Fremdsein«, schreibt Pavel Eisner. »Er war ein Volksfeind ohne eigenes Volk.«7 Einige Prager Juden entkamen dieser Fremdheit durch Flucht in die Ferne, weil sie hofften, dort ihren Schwebezustand zu überwinden: nach Wien (Franz Werfel), Berlin (Willy Haas) oder nach Amerika (wie die Eltern von Louis D. Brandeis). Manche wandten sich dem radikalen Sozialismus zu (so Egon Erwin Kisch) oder ließen sich christlich taufen. Einige Prager Juden – Gershom Scholem verspottete sie als Hatschi-Zionisten – betrieben eine Art Mode-Zionismus. Wieder andere, wie Max Brod, wandten sich dem Zionismus mit großer Ernsthaftigkeit zu.8
Prags bekanntermaßen winzige zionistische Zirkel kreisten um den Studentenverein Bar Kochba, der nach dem Anführer des letzten Judenaufstands gegen die Römer benannt war. Wenn in einem bestimmten Café die Decke einbräche, so erzählte man sich scherzhaft, wäre die gesamte zionistische Bewegung Prags mit einem Schlag ausgelöscht. So klein die Bewegung zahlenmäßig auch gewesen sein mag, hatte sie mit ihrer Mischung aus Zionismus und Sozialismus dennoch eine solche Sogwirkung, dass die Zionisten nach 1918 sogar zwei Sitze im Prager Stadtrat eroberten. Brod erklärt das so:
Dazu kam aber als fester Tatbestand etwas sehr Eigentümliches, Seltenes: das Faktum, daß sich als Anreger und Hauptorganisatoren der zionistischen Strömung junge Männer von einzigartiger Reinheit des Charakters und von intensivster Geistigkeit zusammengefunden hatten, eine Gruppe von leuchtender Vorbildlichkeit, wie ich sie in meinem weiteren Leben nie wieder angetroffen habe – nur eben im Prag jener stürmischen und erwartungsvollen Jahre. Der Studentenverein Bar-Kochba war die Kristallisationsmitte. […] Viele unter uns waren Sozialisten. Andere übten Buße und Umkehr in einsamen Zonen. Doch was uns alle einte, war die Überzeugung, daß unsere Arbeit durch persönliche Opfer und Taten, durch ein von Grund auf verändertes Leben jedes einzelnen geschehen müsse. Nicht durch Leitartikel, nicht durch Agitationsreden, sondern in stillem Bemühen, im engsten Kreise des Volkes. Also in erster Linie auf eine Versittlichung der erniedrigten, gelästerten, durch die Diaspora auch in der Tat vielfach verderbten jüdischen Gemeinschaft hinzielend – und daher auch universal-sittlich in der Tendenz, der ganzen Menschheit zum Heile gereichend, eine echte Brüderschaft, die zwischen den entsühnten Völkern zu stiften war. – Der jüdische Staat, den wir »drüben«, in Palästina, vorbereiteten, sollte auf Gerechtigkeit und selbstloser Liebe jedes einzelnen zu jedem einzelnen begründet sein und selbstverständlich unseren nächsten Nachbarn, den Arabern, Freundschaft und Hilfe bringen, Rettung aus ihrer demütigenden materiellen Not.9
Vor 1909 hatte sich Brod nicht weiter für die zionistische Begeisterung des Bar-Kochba-Vereins interessiert. Bis 1905 hatte er nach eigener Aussage noch nie von Theodor Herzl gehört, dem Gründervater des politischen Zionismus; als er Herzls Porträt an der Wand von Hugo Bergmanns Wohnzimmer im Prager Vorort Podbaba zum ersten Mal sah, fragte er: »Wer ist denn das?«10
Doch im Jahr 1909 begann er, der Bedeutung der jüdischen Identität und den damit einhergehenden moralischen Verpflichtungen auf den Grund zu gehen. Nach dem Zerfall der österreichisch-ungarischen Monarchie und der Gründung der Tschechoslowakei im Jahr 1918 wurde Brod Ehrenmitglied (»Alter Herr«) des Bar-Kochba-Vereins und Zweiter Vorsitzender des Jüdischen Nationalrats. In der neu ausgerufenen Republik entwickelte er sich zu einem wichtigen Sprachrohr der tschechischen Juden und trug in Verhandlungen entscheidend zu den beträchtlichen Autonomiezugeständnissen Präsident Masaryks bei. Befeuert habe seinen selbstlosen Einsatz für den Zionismus, so Brod, ein Satz aus Kafkas Kurzgeschichte »Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse«:
[A]ber das Volk, ruhig, ohne sichtbare Enttäuschung, herrisch, eine in sich ruhende Masse, die förmlich, auch wenn der Anschein dagegen spricht, Geschenke nur geben, niemals empfangen kann, auch von Josefine nicht, dieses Volk zieht weiter seines Weges.11
Kafkas Erzähler zufolge ist Josefine »eine kleine Episode in der ewigen Geschichte unseres Volkes«. Und er fügt hinzu, dass das Volk der Mäuse »sich noch immer irgendwie selbst gerettet hat, sei es auch unter Opfern, über die der Geschichtsforscher […] vor Schrecken erstarrt«.
Mit seiner Hinwendung zum Kulturzionismus wollte Brod nicht nur ein neues Verhältnis zum jüdischen Volk entwickeln. Er kritisierte auch, dass die neuen Nationalstaaten die kollektive Identität von Minderheiten aushöhlten. »Für mich«, schrieb er in der zionistischen Wochenzeitung Selbstwehr, »unterliegt es keinem Zweifel, dass ein ›Jüdisch-Nationaler‹ kein ›Nationaler‹ im heute üblichen Sinne des Wortes sein darf. Es ist die Sendung der jüdischen Nationalbewegung, des Zionismus, dem Worte ›Nation‹ einen neuen Sinn zu geben.«12 Die Erneuerung des Judentums – und die Wiederbelebung der hebräischen Sprache – könne nur gelingen, wenn sie im Land Israel verwurzelt sei. 1924 schrieb Brod an die in Prag geborene Schriftstellerin Auguste Hauschner: »Vor allem das eine: Der jüdische Nationalismus darf nicht eine neue chauvinistische Nation schaffen, sondern soll nur der versöhnenden, allmenschlichen, heute degenerierten Genialität des Juden eine Gesundung, der messianischen Richtung eine reale Unterlage schaffen.«13
Der mit dem Zerfall der Habsburger Dynastie aufkommende Nationalismus gab Brods Mission eine neue Dringlichkeit. »Der Jude, der es mit dem nationalen Problem ernst meint, bewegt sich heute in folgendem Paradox«, so Brod. »Er muß den Nationalismus bekämpfen zu Gunsten einer allmenschlichen Verbrüderung […] und er muß zugleich mitten in der jungen jüdischen Nationalbewegung stehen.«14
Während des Ersten Weltkriegs gab Brod Kurse zur Weltliteratur für junge Jüdinnen, die vor dem Krieg aus Osteuropa geflohen waren. Die Tätigkeit sei sein »einziger Trost in dieser entgeistigten Zeit«, schreibt er 1916 in der ersten Ausgabe der Zeitschrift Der Jude. »Eine bezaubernde Frische und Naivität geht von den Mädchen aus. Und dennoch sind sie durchaus geistig«, urteilte er. Einen Monat später verglich er in einem weiteren Aufsatz seine Studentinnen mit den oberflächlicheren »Westjüdinnen« und kam zu dem Schluss, »daß die galizischen Mädchen in ihrer Gesamtheit um so viel frischer und im Geiste wesenhafter, gesünder sind als unsere Mädchen«.15
Die wachsende Bedeutung des Judentums in seinem Leben rechtfertigte Brod 1921 in seiner Abhandlung Heidentum, Christentum, Judentum. In seinem Opus – ob nun magnum oder nicht – unterscheidet er zwischen drei Haltungen zum Diesseits: die Diesseitsbejahung (Heidentum), die Ablehnung der sündigen Welt zugunsten des »Jenseits« (das Christentum mit dem Grundsatz »Mein Reich ist nicht von dieser Welt«) und schließlich die Überzeugung, dass diese unvollkommene Welt Erlösung finden kann (Judentum). Diese dritte Haltung bezeichnet Brod als »Diesseitswunder«. Robert Weltsch resümiert später, für Max Brod sei »das Heidentum die Religion des Diesseits, des menschlichen Lebens in dieser Welt, das alles ignoriert, was die sinnliche Erfahrung übersteigt. Das Christentum ist die Religion des Jenseits. Das Judentum […] ist die Religion, die beide Welten berücksichtigt und an die Gleichzeitigkeit von Gnade und Freiheit glaubt.«16
Brod, den Sinnlichkeit und Spiritualität gleichermaßen anzogen, wählte das Judentum. Und diese Wahl umfasste auch den Zionismus. »Der Zionismus baut der jüdischen Religiosität ihren Körper, den sie verloren hatte«, schrieb Brod auf den letzten Seiten von Heidentum, Christentum, Judentum. Der Zionismus bot ihm einen Rückzugsort vor dem Neuheidentum, das Europa zu verschlingen drohte – »der Triumph der heidnischen Bestie« –, und sollte ihm später das Leben retten.17
Am 13. August 1912 kam Kafka eine Stunde später als verabredet in Brods Wohnung in der Skořepka-Straße. Brod wollte für seine erste Veröffentlichung Betrachtungen die endgültige Reihenfolge der Texte mit ihm besprechen. Kaum hatte Kafka die Wohnung betreten, fiel sein Blick auf eine Vierundzwanzigjährige, eine entfernte Verwandte Brods, die bei ihm am Tisch saß. »Freier Hals. Übergeworfene Bluse«, notierte er in sein Tagebuch. »Sah ganz häuslich angezogen aus, trotzdem sie es, wie sich später zeigte, gar nicht war. (Ich entfremde ihr ein wenig dadurch, daß ich ihr so nahe an den Leib gehe. […]) Fast zerbrochene Nase. Blondes, etwas steifes reizloses Haar, starkes Kinn. Während ich mich setzte, sah ich sie zum erstenmal genauer an, als ich saß, hatte ich schon ein unerschütterliches Urteil.«18
Die beiden kamen ins Gespräch, und die junge Frau erzählte, sie arbeite in der Berliner Firma Carl Lindström AG, deren neuartiges Diktiergerät sie vermarktete. Außerdem erwähnte sie, dass sie Hebräisch lerne. »Nun hatte sich also auch herausgestellt, daß Sie Zionistin wären und das war mir sehr recht«, schrieb ihr Kafka später.19 Er war so frei, für den folgenden Sommer eine gemeinsame Palästinareise vorzuschlagen. Sie willigte ein und gab ihm die Hand darauf. In der Jackentasche hatte Kafka an jenem Abend die August-Ausgabe der Zeitschrift Palästina, die in deutscher Übersetzung einen Aufsatz des Kulturzionisten Achad Ha’am über seinen jüngsten Besuch in Palästina enthielt. Kafka notierte die Berliner Adresse der jungen Frau auf der Titelseite, ehe er sie in ihr Hotel Zum blauen Stern begleitete (dasselbe, in dem Bismarck 1866 den Friedensvertrag zwischen dem Königreich Preußen und dem Kaisertum Österreich unterzeichnet hatte).
Felice Bauer ist die Frau, die Kafka nie heiraten wird. In Hunderten von stürmischen Briefen (Kafka zitierte in Briefen an Brod manchmal aus seiner Korrespondenz mit Felice und umgekehrt) wirbt Kafka in den folgenden fünf Jahren um Felices Liebe, die ihn dann aber dermaßen erdrückt, dass er sich zurückzieht. Er liebt sie und er flieht sie. Getrennt durch eine sechsstündige Zugfahrt zwischen Prag und Berlin, verloben sich die beiden zweimal und trennen sich zweimal.
Kafkas ambivalente Haltung zum Zionismus lässt sich als Subtext seiner Ambivalenz gegenüber Felice – und anderen Frauen, die er aus der Distanz liebt – lesen; als seien Zionismus und Ehe für ihn, der an einer lähmenden »Wir-Schwäche« litt, zwei Aspekte eines Gedankens, zwei Ausdrucksformen des »Wir«. Als hätte er diesen Subtext gespürt, schenkte Brod Kafka und Felice Bauer anlässlich ihrer ersten Verlobung Richard Lichtheims Buch Das Programm des Zionismus (1911).20 Doch Kafkas Ambivalenz verstärkte sich mit der Zeit nur. In einem Brief an Felices gute Freundin Grete Bloch gestand er 1914, »ich bewundere den Zionismus und ekle mich vor ihm«.21
Kafka setzte nie einen Fuß auf palästinensischen Boden, doch in seinem ersten Brief an Felice, drei Wochen nach ihrer ersten Begegnung in Brods Wohnung, griff er für seinen Annäherungsversuch auf die Palästina-Fantasie zurück:
Für den leicht möglichen Fall, daß Sie sich meiner auch im geringsten nicht mehr erinnern können, stelle ich mich noch einmal vor: Ich heiße Franz Kafka und bin der Mensch, der Sie zum erstenmal am Abend beim Herrn Direktor Brod in Prag begrüßte, Ihnen dann über den Tisch Photographien von einer Thaliareise, eine nach der andern, reichte und der schließlich in dieser Hand, mit der er jetzt die Tasten schlägt, Ihre Hand hielt, mit der Sie das Versprechen bekräftigten, im nächsten Jahr eine Palästinareise mit ihm machen zu wollen.22
Dieses Versprechen setzte in Kafka etwas frei. In der Nacht zum Jom-Kippur-Fest, zwei Tage nach dem Brief an Felice, schrieb er in einem ekstatischen Lauf von zehn Uhr abends bis sechs Uhr morgens die Erzählung »Das Urteil«, die den eigentlichen Beginn seines Schriftstellerdaseins markiert. Er widmete die Erzählung Felice.
Für Kafka sei Palästina »das bildliche Anderswo, wo Liebende hingehen, eine offene Zukunft, der Name für ein unbekanntes Ziel«, so Judith Butler, Professorin an der University of California in Berkeley. In ihrer Korrespondenz setzte Kafka Felice innerlich mit diesem Anderswo gleich. Im Februar 1913 schrieb er ihr, er habe zufällig einen Bekannten getroffen, einen jungen Zionisten, der ihn zu einer wichtigen zionistischen Zusammenkunft einlud. »[M]eine Gleichgültigkeit hinsichtlich seiner Person und jeden Zionismus war in dem Augenblick grenzenlos und unausdrückbar, aber ich fand […] keine gesellschaftlich durchführbare Möglichkeit des Abschieds […] und bot mich nur aus diesem Grunde an, ihn zu begleiten und begleitete ihn tatsächlich bis zur Tür jenes Kaffeehauses«, schrieb er. »Hineinziehen ließ ich mich aber nicht mehr«. Es war, als verharre Kafka in seinem Verhältnis zu Felice wie auch zum jüdischen Nationalbestreben – und zu seinem eigenen Schreiben – auf der Schwelle zur Vollendung.23
Besonders drastisch kommt dies in Kafkas später, nicht abgeschlossener Erzählung »Der Bau« zum Ausdruck (der Titel stammt von Brod), die er im Winter 1923 verfasste. Darin widmet ein einsames dachsähnliches Tier sein Leben dem Bau einer ausgeklügelten unterirdischen Festung, mit der es sich vollständig identifiziert: »[D]ie Empfindlichkeit des Baues hat mich empfindlich gemacht«, erklärt das Tier.24 Doch es bewohnt sein gut geschütztes Refugium gar nicht, sondern hält draußen vor dem Bau Wache:
Es ging so weit, daß ich manchmal den kindischen Wunsch bekam überhaupt nicht mehr in den Bau zurückzukehren sondern hier in der Nähe des Eingangs mich einzurichten, mein Leben in der Beobachtung des Eingangs zu verbringen und immerfort mir vor Augen zu halten und darin mein Glück zu finden, wie fest mich der Bau, wäre ich darin, zu sichern imstande wäre.25
Nachdem er seine Verlobung mit Felice zum zweiten Mal gelöst hatte, verknüpfte Kafka dieses Bild – »in der Nähe des Eingangs« zum Zionismus – auch mit späteren Geliebten. Im Jahr 1919 lernte er Julie Wohryzek kennen, mit der er sich kurz darauf verlobte. Julie war die einfache Tochter eines verarmten Schusters und Synagogendieners. In einem Brief an Brod bezeichnete Kafka sie als »Besitzerin einer unerschöpflichen und unaufhaltbaren Menge der frechsten Jargonausdrücke«. (Weder ihre Herkunft noch ihr Jiddisch sagten Kafkas Vater zu, der sie als déclassé ablehnte.) Julie, deren erster Verlobter, ein junger Zionist, in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs gefallen war, hatte Brods Vorträge über den Zionismus besucht. Kurz nachdem Kafka Julie kennengelernt hatte, bat er Brod, ihr seinen Aufsatz »Die dritte Phase des Zionismus« aus dem Jahr 1917 zuzuschicken.26
Dank Brod war Kafka, schon bevor er Felice kennenlernte, zumindest flüchtig mit zionistischen Kreisen in Berührung gekommen. Im Jahr 1910 besuchte er mit Brod zum ersten Mal Zusammenkünfte und Vorträge im Studentenverein Bar Kochba. Anders als Theodor Herzl interessierte man sich bei Bar Kochba mehr für eine Wiederbelebung der jüdischen Kultur als für die politische Verwirklichung eines jüdischen Staates. Die Mitglieder verstanden den Zionismus nicht als Selbstzweck, sondern als Mittel für eine geistige Erneuerung. Darauf bezieht sich Kafka im August 1916, als er auf einer Postkarte an Felice vermerkt: »Der Zionismus, wenigstens in einem äußern Zipfel, den meisten lebenden Juden erreichbar, ist nur der Eingang zu dem Wichtigern.«27
Kafkas Auseinandersetzung mit dem Thema hatte jedoch schon Jahre zuvor mit seinem Freund Hugo Bergmann begonnen, der 1899 sechzehnjährig dem Bar-Kochba-Verein beigetreten und mit achtzehn zu dessen Vorsitzendem gewählt worden war. Im Jahr 1902 brachte der neunzehnjährige Kafka sein Befremden über das Engagement seines Freundes für den Zionismus zum Ausdruck. Bergmann erwiderte:
In deinem Brief fehlt natürlich wieder nicht der obligate Spott über meinen Zionismus. Fast sollte ich schon aufhören, mich darüber zu wundern. Und doch immer und immer wieder muß ich mich darüber wundern, warum Du, der Du, wenn nicht mehr, doch solange mein Schulkamerad warst, meinen Zionismus nicht verstehst. Wenn ich einen Irren vor mir sähe, und er hätte eine fixe Idee, ich würde nicht lachen über ihn, denn ihm ist seine Idee ein Stück Leben. Mein Zionismus ist für dich auch nur eine »fixe Idee« von mir. [A]llein wie Du zu stehen, dazu hatte ich die Kraft nicht.28
Bergmann siedelte 1920 nach Palästina über, wo er die Leitung der Hebräischen Nationalbibliothek in Jerusalem übernahm. Unter seiner Ägide wurde aus der Institution laut Brod »die größte und reichhaltigste, modernste Bibliothek des Mittelostens«. Später wurde Bergmann Rektor der Hebräischen Universität in Jerusalem. Kafka verfolgte seine Karriere mit großem Interesse. Als Bergmann 1923 nach Prag zurückkehrte, um im zionistischen Club Keren Hajessod einen Vortrag zu halten, sagte Kafka, wie Brod später berichtete, nach der Veranstaltung zu Bergmann: »Diesen Vortrag hast du nur für mich gehalten.«29
Wir können davon ausgehen, dass Bergmann Kafka von den Ursprüngen der Jerusalemer Bibliothek erzählte. Im Jahr 1872 hatte ein gewisser Rabbi Joshua Heschel Lewin aus Waloschyn in der ersten hebräischen Wochenzeitung Jerusalems Ha-Chawazelet gefordert, »eine Bibliothek zu gründen, die ein Zentrum werden soll und in der die Bücher unseres Volkes gesammelt werden – nicht eines darf fehlen«. Mit Unterstützung des britischen Mäzens und Philanthropen Sir Moses Montefiore wurden Spenden gesammelt und Vorstandsmitglieder verpflichtet, unter ihnen Elieser Ben-Jehuda, Vater der modernen hebräischen Sprache. Im Jahr 1905 kam die Bibliothek unter die Schirmherrschaft des Zionistischen Kongresses in Basel. Doch die Zeit war noch nicht reif: Eine Nationalbibliothek braucht per definitionem eine Nation mit einem Land und einer Sprache.
Im Studentenverein Bar Kochba hörte Kafka im Januar 1912 auch einen Vortrag Nathan Birnbaums über jiddische Volkslieder; der Wiener Schriftsteller, damals 47 Jahre alt, hatte den Begriff »Zionismus« zwanzig Jahre zuvor geprägt. Kafka lauschte »Birnbaums Vortrag mit größter Spannung«, so Reiner Stach.30 Unter den Zionisten, deren Vorträge er beim Bar-Kochba-Verein besuchte, waren Felix Salten (der später das Kinderbuch Bambi verfasste), der Generalsekretär des zionistischen Weltverbandes Kurt Blumenfeld und der einflussreiche Kulturzionist Davis Trietsch, Mitbegründer des Jüdischen Verlags und Herausgeber der Zeitschrift Palästina, der über jüdische Kolonien im Land referierte.
Im September 1913 befand sich Kafka unter den rund zehntausend Besuchern des elften Zionistischen Weltkongresses in Wien, an dem auch sein späterer Verleger Salman Schocken und der erste Ministerpräsident des späteren Staates Israel David Ben-Gurion teilnahmen. (Anlass für die Wien-Reise war allerdings Kafkas Arbeit gewesen, nämlich der zweite Internationale Kongress für Rettungswesen und Unfallverhütung). Auf dem Zionistenkongress hörte er Reden von Nahum Sokolow, Menachem Ussischkin, Arthur Ruppin und anderen einflussreichen Zionisten. Die Delegierten erlebten zudem die Premiere eines 78 Minuten langen Stummfilms des Regisseurs Noah Sokolowsky, der Panoramaansichten der neuen Stadt Tel Aviv, die Wahrzeichen von Jerusalem und die jüdischen Agrarsiedlungen in Judäa, am Karmel und in Galiläa zeigte.31
Der Trubel ließ Kafka kalt. »Im Zionistischen Kongreß bin ich wie bei einer gänzlich fremden Veranstaltung dagesessen, allerdings war ich durch manches beengt und zerstreut gewesen«, bemerkte er in einem Brief an Brod. »[E]twas Nutzloseres als ein solcher Kongreß lässt sich schwer ausdenken«. Und in seinem Tagebuch mokierte er sich über »Palästinafahrer«, die »immerfort die Makkabäer im Munde haben und ihnen nachgeraten wollen«.32
Inmitten der gegensätzlichen kulturellen Strömungen Prags war Kafka wie Brod und seine zionistischen Freunde ständig auf der Hut vor dem allgegenwärtigen Antisemitismus. Sie alle wussten nur zu gut, dass Juden von den Tschechen als Deutsche und von den Deutschen als Juden betrachtet wurden. »Was hatten sie denn getan«, so Theodor Herzl schon 1897, »die kleinen Juden von Prag, die braven Kaufleute des Mittelstandes, die Friedlichen aller friedlichen Bürger? […] Es gab welche, die sich tschechisch zu sein bemühten; da bekamen sie es von den Deutschen. Es gab welche, die deutsch sein wollten, da fielen die Tschechen über sie her – und Deutsche auch.«33
Brod und Kafka lasen die hasserfüllten judenfeindlichen Artikel in der tschechischen Zeitung Venkov und waren mit den alltäglichen Beleidigungen gegenüber Juden nur allzu vertraut. Als Kafka einmal im Salon Emilie Marschners zu Gast war, der Ehefrau seines Vorgesetzten, bemerkte eine der Damen abschätzig: »Da haben Sie ja auch einen Herrn Juden eingeladen.«34
Die beiden Prager Schriftsteller unterschieden sich in Temperament und Schicksal, teilten aber die lästige Erfahrung, einer jüdischen Minderheit innerhalb einer deutschsprachigen Minderheit innerhalb einer tschechischen Minderheit innerhalb eines heterogenen österreichisch-ungarischen Kaiserreichs anzugehören, an dem bereits die Zentrifugalkräfte rivalisierender Nationalismen zerrten. Beide bekamen den wachsenden völkischen Antisemitismus, der mit dem Zerfall der Habsburgermonarchie einherging, am eigenen Leib zu spüren.
Ende 1897 erlebten Kafka und Brod im Alter von vierzehn Jahren den sogenannten Dezembersturm. Drei Tage lang verwüsteten marodierende Banden Synagogen, plünderten jüdische Geschäfte und überfielen Juden in ihren Häusern. »Auch in meinem Elternhaus splitterten nachts die Scheiben«, schrieb Brod später, »bebend flüchteten wir aus dem gassenwärts gelegenen Kinderzimmer ins Schlafzimmer der Eltern. Ich sehe noch, wie mein Vater die kleine Schwester aus dem Bett hebt – und am Morgen lag wirklich im Bett ein großer Pflasterstein.«35
Zwei Jahre später, 1899, verfolgte Kafka in der Presse den Fall Leopold Hilsners, eines jungen Juden aus einer böhmischen Kleinstadt, dem der Ritualmord an einem tschechischen Mädchen katholischen Glaubens vorgeworfen wurde. Er las den Augenzeugenbericht seines Freundes Abraham Grünberg von einem Pogrom im Jahr 1906. Und er las in der zionistischen Wochenzeitung Selbstwehr Berichte über die Beilis-Affäre in Kiew und schrieb, so berichtet Brod, auch eine Erzählung über den berühmt-berüchtigten Blutmordprozess (Kafkas letzte Geliebte Dora Diamant verbrannte den Text auf sein Geheiß). Er war ergriffen von Arnold Zweigs Theaterstück Ritualmord in Ungarn (1914) über die Blutanklage, die als Affäre von Tiszaeszlár bekannt wurde. »Bei einer Stelle mußte ich zu lesen aufhören und mich auf das Kanapee setzen und laut weinen«, schrieb Kafka an Felice Bauer. »Ich habe schon seit Jahren nicht geweint.«36
In Kafkas unmittelbarer Umgebung probten 1922 Studenten der Deutschen Universität in Prag den Aufstand, als sie ihre Diplome von einem jüdischen Rektor entgegennehmen sollten. Im gleichen Jahr scheiterte Kafka an dem Versuch, eine Rezension der antisemitischen Schrift Secessio Judaica zu verfassen, deren Autor Hans Blüher die »jüdische Mimikry« verurteilte und empfahl, Juden von Deutschen abzusondern.37 Kafka beobachtete den fanatischen Hass und gab sich keinen Illusionen hin. Als etwa der deutsche Außenminister Walther Rathenau, ein Jude, 1922 ermordet wurde, kommentierte Kafka in einem Brief an Brod: »Unbegreiflich, daß man ihn so lange leben ließ«.38