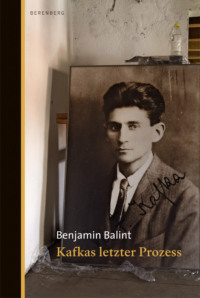Kitabı oku: «Kafkas letzter Prozess», sayfa 5
Während Kafka also den aufwallenden Antisemitismus wachsam beobachtete, führte er mit Bergmann und Brod einen ständigen Dialog über die prekäre Stellung der Juden in Europa. Im Jahr 1920 las er Brods Studie Sozialismus im Zionismus. Anders als seine beiden Freunde suchte Kafka die Lösung dieser Problematik allerdings nicht in der zionistischen Ideologie. »Die ganzen Nachmittage bin ich jetzt auf den Gassen und bade im Judenhaß«, schrieb der sechsunddreißigjährige Kafka während eines Pogroms im April 1920 in Prag. »›Prašivé plemeno‹ [räudige Brut] habe ich jetzt einmal die Juden nennen hören. Ist es nicht das Selbstverständliche, daß man von dort weggeht, wo man so gehaßt wird (Zionismus oder Volksgefühl ist dafür gar nicht nötig)? Das Heldentum, das darin besteht doch zu bleiben, ist jenes der Schaben, die auch nicht aus dem Badezimmer auszurotten sind.«39
Im September 1916 schrieb Kafka auf einer Postkarte an Felice vom »dunklen Komplex des allgemeinen Judentums, der so vielerlei Undurchdringliches enthält«. Um dieses Undurchdringliche doch zu durchdringen und die Grammatik zu verstehen, in der es formuliert wird, begann Kafka im Jahr 1917 ernsthaft, Hebräisch zu lernen. Wer das jüdische Volk kennenlernen wolle, so hatte auch Hugo Bergmann schon 1904 erklärt, müsse zuallererst seine Sprache lernen.40
Für seine Hebräischstudien verwendete Kafka ein damals beliebtes Lehrbuch von Moses Rath; außerdem nahm er Konversationsstunden bei seinen Freunden Friedrich Thieberger und Georg (Jiří) Mordechai Langer.41 Langer hatte Kafka 1915 über den gemeinsamen Freund Max Brod kennengelernt. Der homosexuelle Langer hatte im Alter von 19 Jahren seine Familie und damit die Bourgeoisie verlassen und sich einem chassidischen Rebbe angeschlossen. Er verfasste das Buch Die Erotik der Kabbala (1923), das Brod herausgab (und begeistert rezensierte). 1929 schrieb er auf Hebräisch eine Elegie für Kafka. 1941, zwei Jahre vor seinem frühzeitigen Tod, beschrieb Langer, der in der Nähe Brods in Tel Aviv wohnte, die Freude seines Schülers Kafka an der hebräischen Sprache:
Ja. Kafka sprach Ivrith. In seinen letzten Jahren haben wir die ganze Zeit Ivrith gesprochen. Er, der immer wieder beteuerte, er sei kein Zionist, hat unsere Sprache in erwachsenem Alter und mit großem Fleiß gelernt. Und anders als die Prager Zionisten, sprach er fließend Hebräisch, was ihm eine besondere Befriedigung bereitete, und ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, daß er insgeheim stolz darauf war.
Zum Beispiel einmal, als wir in der Straßenbahn fuhren und uns über die Flugzeuge unterhielten, die in diesem Moment über uns am Himmel Prags kreisten, da fragten uns die Tschechen, die mit uns fuhren, als sie die Klänge unserer Sprache hörten, die sie wohl als wohlklingend empfanden, was für eine Sprache wir denn sprechen würden. Und als wir ihnen antworteten, welche Sprache das sei und worüber wir gerade geredet hätten, staunten sie sehr, daß man auf Ivrith sogar über Flugzeuge sprechen könne. […] Wie sehr leuchtete da Kafkas Gesicht vor Freude und Stolz!
»Kafka war kein Zionist«, fügte Langer hinzu, »aber er beneidete zutiefst jene, die den großen Grundsatz des Zionismus selbst verwirklichten, was schlicht bedeutet, nach Erez Israel einzuwandern. Er war kein Zionist, aber alles, was in unserem Land passierte, bewegte ihn sehr.«42
Im Jahr 1918 schlug Kafka Brod vor, auf Hebräisch zu korrespondieren. Auch Brod hatte sporadisch versucht, die Sprache zu erlernen. In seiner Autobiografie schreibt er später: »Als braver Zionist habe ich im Ausland immer wieder angefangen, Hebräisch zu lernen. Jahr für Jahr. Immer von vorn. Ich bin aber immer wieder steckengeblieben, bin nur bis zum Hifil gekommen.«43 (Der »Hifil« ist die kausative Verbform im Hebräischen.) Sein Lyrikband Das gelobte Land aus dem Jahr 1917 enthält auch ein Gedicht mit dem Titel »Hebräische Lektion«. Es beginnt mit den Versen:
Dreißig Jahre alt bin ich geworden,
Eh ich begann, die Sprache meines Volks zu lernen.
Da war es mir, als sei ich dreißig Jahre taub gewesen.44
Kafka habe die Sprache mit »besonderem Eifer« gelernt, so Brod, und »schließlich hat er mich durch Vertiefung in die hebräische Sprache auch auf diesem Gebiet weit überholt«.45
Trotz seines schlechten Gesundheitszustands nahm Kafka im Herbst 1922 zweimal wöchentlich Hebräischunterricht bei einer neunzehnjährigen Studentin aus Jerusalem. Puah Ben-Tovim – »die kleine Palästinenserin«, wie er sie nannte – wohnte in Prag bei Hugo Bergmanns Mutter zur Untermiete.46 Puahs Eltern waren in den 1880er Jahren mit der Immigrantenwelle aus Russland nach Palästina gekommen. Zehn Jahre lang hatte sie ihrem Vater, einem renommierten Hebraisten, geholfen, den Schülern der ersten Blindenschule Jerusalems vorzulesen. Nach dem Ersten Weltkrieg besuchte sie die erste Abschlussklasse des Hebräischen Gymnasiums in Jerusalem. Noch als Schülerin half sie in ihrer Freizeit Hugo Bergmann in der Nationalbibliothek bei der Katalogisierung der deutschen Bücher.
»Manchmal hatte er während einer Stunde einen schmerzhaften Hustenanfall, so daß ich den Unterricht abbrechen wollte«, erzählte Puah Ben-Tovim später. »Dann schaute er mich an, er konnte nicht sprechen, flehte mich aber mit seinen großen dunklen Augen an, zu bleiben und ihm noch ein Wort zu sagen, und dann noch eins und noch eins. Es war beinahe so, als ob er sich von dem Unterricht eine Art Wunderheilung erwartete.«47
Mit Puahs Hilfe füllte Kafka in einer geschwungenen kindlichen Schrift Vokabelhefte mit hebräischen Wörtern und ihren deutschen Entsprechungen: faschistische Bewegung, Tuberkulose, Heiligkeit, Sieg, Genie. Er hielt auch hebräische Redewendungen fest. (Ich konnte mir in der Nationalbibliothek in Jerusalem ein 18 Seiten starkes Heft ansehen, dem früheren Direktor des Handschriften- und Archivabteilung Raphael Weiser zufolge ein Geschenk der Familie Schocken.)
»Er fühlte sich unstreitig von mir angezogen, aber eher von einem Ideal als von dem realen Mädchen, das ich war, und zwar von dem Bild des fernen Jerusalem, über das er mich unentwegt ausfragte und wohin er mich bei meiner Rückkehr begleiten wollte. Er hing an mir, weil ich der erste ›hebräisch sprechende Vogel‹ war, der aus Palästina kam, weil ich eine Vertreterin jener Juden war, die nicht in Angst vor Pogromen und Demütigungen leben mußten. […] Der Wunsch, mit mir nach Jerusalem zurückzukehren, bestand trotz der Schwere seines Leidens noch immer«, so Puah Ben-Tovim. »Mir wurde schnell klar, daß er sich emotionell in der Lage eines Ertrinkenden befand, der wild um sich schlägt und sich an alles festklammert, was in seine Nähe kommt.«48
Doch Kafka, für den das Fremdsein an der Wurzel seines Schaffens stand, entzog sich allen Angeboten einer kollektiven Zugehörigkeit. »Zum Zionismus hingezogen fühlte er sich wegen seiner Sehnsucht nach Zugehörigkeit und nach Selbstsicherheit, die mit einer solchen Zugehörigkeit einhergeht«, so Vivian Liska, Professorin für deutsche Literatur und Direktorin des Instituts für Jüdische Studien an der Universität Antwerpen. »Doch seine Angst vor der Auflösung des Ich in der Gruppe verhinderte, dass er sich vollständig an sie band.« Der Kafka-Experte Hans Dieter Zimmermann formuliert knapp und deutlich, Kafka sei jedenfalls »nicht Zionist« gewesen, sondern »›zügelloser‹ Individualist, wie er einmal schreibt.«49
Im Jahr 1922 schlug Brod Kafka vor, als Redakteur der zionistischen Monatszeitschrift Der Jude anzufangen, die Martin Buber herausgab und Salman Schocken finanzierte und in der Kafka fünf Jahre zuvor die Erzählungen »Ein Bericht für eine Akademie« und »Schakale und Araber« veröffentlicht hatte. (Im Juni 1916 hatte Brod an Buber geschrieben, Kafka sei aufgrund seiner tiefen Sehnsucht nach Gemeinschaft, seinem Wunsch, der tiefen Einsamkeit zu entfliehen, der »jüdischeste« Dichter von allen.50)
Kafka lehnte das Angebot ab, allerdings nicht, wie zu erwarten gewesen wäre, aus gesundheitlichen Gründen. »Wie dürfte ich bei meiner grenzenlosen Unkenntnis der Dinge, völligen Beziehungslosigkeit zu Menschen, bei dem Mangel jedes festen jüdischen Bodens unter den Füßen an etwas derartiges denken?«, schrieb er zurück. »Nein, nein.«51
Das Gelobte Land und die gelobte Gemeinschaft lagen in gleichermaßen unerreichbarer Ferne. Was sei das Hebräische anderes, schrieb Kafka seinem tuberkulosekranken Mitpatienten Robert Klopstock 1923, als »Nachrichten aus der Ferne«?52
In seinem letzten Lebensjahr zog Kafka endlich aus der Wohnung seiner Eltern aus und entfloh ihrem Einfluss. Von September 1923 bis März 1924 wohnte er »halb ländlich«, wie er an Brod schrieb, in Steglitz am Stadtrand von Berlin. Er lebte mit Dora Diamant zusammen, die fünfzehn Jahre jünger war als er und mit der orthodoxen Religion ihrer streng chassidischen Familie gebrochen hatte. »Der reiche Schatz ostjüdischer religiöser Tradition, über den Dora verfügte, war für Franz eine stete Quelle des Entzückens«, schreibt Brod in seiner Kafka-Biografie. Bis zum Januar 1924, als sich Kafkas Gesundheitszustand verschlechterte, besuchten Dora und Kafka Talmudkurse an der Hochschule für jüdische Wissenschaft in der Artilleriestraße (heute Leo-Baeck-Haus); Kafka nannte die Hochschule einen »Friedensort in dem wilden Berlin und in den wilden Gegenden des Innern«.53
Dora las mit Kafka auch die ersten drei Kapitel von Josef Chaim Brenners düsterem letzten, nicht auf Deutsch erschienenen Roman Zerfall und Verlust im hebräischen Original, immer eine Seite am Tag. Das war eine bemerkenswerte Lektüreentscheidung, immerhin wurde dieser Roman einmal als »brutalste Selbstkasteiung der hebräischen Literatur« bezeichnet. Brenner, dem tragischen Rationalisten der hebräischen Literatur zufolge war das Exil (Galut) überall und auch das Land Israel nur wieder eine Diaspora. »Als Roman freut mich übrigens das Buch nicht sehr«, kommentierte Kafka in einem Brief an Brod.54
Dora Diamant habe ihm von Kafkas Absicht erzählt, »nach Palästina zu übersiedeln, wenn er gesund würde«, schreibt Brod in seiner Kafka-Biografie.55 Das Paar malte sich aus, in Tel Aviv ein Restaurant zu eröffnen. Dora sollte kochen, Kafka bedienen; so konnte er Menschen beobachten, ohne selbst beobachtet zu werden. (In dem achtzehnseitigen handschriftlichen Vokabelheft führt er auch das hebräische Wort für Ober auf, meltzar.) Doch der Traum von Zion blieb unerfüllt. Den Gedanken an eine Übersiedelung nach Palästina ließ Kafka erst zu, als seine fortgeschrittene Krankheit sie unmöglich machte.
Im Juli 1923 appellierten Hugo Bergmann und seine Frau Else ein letztes Mal an Kafka, mit ihnen nach Jerusalem zu kommen. »Und wieder fängt die Lockung an und wieder antwortet die absolute Unmöglichkeit«, schrieb Kafka an Else Bergmann.56 So verließen die Bergmanns Prag lediglich mit einem Porträt Kafkas, das sie nach ihrer Rückkehr nach Jerusalem in ihrem Salon aufs Klavier stellten.
Als sich die Tuberkulose verschlimmerte und Kafkas Kräfte schwanden, grübelte er über die vielen Anfänge in seinem Leben nach, die nun unvollendet bleiben sollten. »Es war nicht die geringste sich irgendwie bewährende Lebensführung von meiner Seite da«, notierte er in seinem Tagebuch. »Statt dessen habe ich immerfort einen Anlauf zum Radius genommen, aber immer wieder gleich ihn abbrechen müssen (Beispiel: Klavier, Violine, Sprachen, Germanistik, Antizionismus, Zionismus, Hebräisch, Gärtnerei, Tischlerei, Litteratur, Heiratsversuche, eigene Wohnung.«)Felice, Julie, Milena und in gewisser Weise selbst Dora hatte Kafka aus Furcht vor dem Ehestand aus der Ferne geliebt. In einem Brief an Brod räumte er 1921 ein: »Ich kann offenbar […] nur das lieben, was ich so hoch über mich stellen kann, daß es mir unerreichbar wird.« Auch Palästina und die hebräische Sprache, die dort wiederbelebt wurde, blieben für ihn in unerreichbarer Ferne. Die Ehe und das Gelobte Land: zwei Formen des Glücks, verschoben, ersehnt, aber nie erlangt.57
Eva Hoffe meinte, es sei so vielleicht am besten gewesen. In der drückenden Schwüle eines Sommernachmittags in Tel Aviv spazierten wir durch die Dubnow-Straße. Sie trug ein T-Shirt, das mit einem bunten Porträt Marilyn Monroes bedruckt war, und einen weiten Rock. In drei Plastiktüten hatte sie Fotos und Dokumente bei sich, die sie mir zeigen wollte, unter anderem ihre Geburtsurkunde und ihren tschechischen Pass. »Ich bin zwar Israeli und Jüdin«, sagte sie, »aber ich kann nicht behaupten, dass ich dieses Land liebe.«
Ich erwähnte, was Brod in einem Interview mit der israelischen Zeitung Ma’ariv im Oktober 1960 gesagt hatte: »Wäre Kafka in das Land Israel gelangt, so hätte er geniale Werke auf Hebräisch geschaffen!« Die jüdisch-amerikanische Schriftstellerin Nicole Krauss, fügte ich hinzu, habe in ihrem Roman Waldes Dunkel eine Art Gegenleben für Franz Kafka entworfen, ein »Was wäre, wenn«: Sie lässt einen greisen Literaturwissenschaftler behaupten, Kafka sei zwischen den Weltkriegen nach Palästina ausgewandert und habe dort unbemerkt unter dem hebräischen Vornamen Amschel gelebt (so hieß Kafkas Großvater mütterlicherseits).58
Obwohl Eva Hoffe Kafka nie kennengelernt hatte, reagierte sie mit bissiger Skepsis. »Kafka würde es hier keinen Tag aushalten«, sagte sie. Sie schritt energisch aus, und der Saum ihres fadenscheinigen Rocks schlug ihr gegen das Schienbein.
5
Erstes und zweites Urteil
Familiengericht Tel Aviv, Ben-Gurion-Boulevard 38, Ramat Gan, Oktober 2012
Kafka ist für die jüdische Literatur, was Dante für den Katholizismus oder John Milton für den Protestantismus ist: der Archetypus des Dichters.
HAROLD BLOOM, 20141
Im Verlauf des langwierigen Prozesses vor dem Familiengericht von Tel Aviv wurden weiter munter Kafka-Manuskripte aus Israel verkauft. Zum Entsetzen der israelischen Behörden kamen 2009 zwei Handschriften Kafkas in der Schweiz zur Versteigerung. Beide hatten sich zeitweise in Ester Hoffes Besitz befunden. Eine war ein achtseitiger Brief Kafkas an Brod aus dem September 1922 (verkauft für 125.000 Schweizer Franken): »Und ich kenne andeutungsweise die Schrecken der Einsamkeit«, schreibt Kafka dort, »nicht so sehr der einsamen Einsamkeit, als der Einsamkeit unter Menschen«.2 In den zehn Jahren ab 1978, in denen Ester Hoffe Kafka-Handschriften verkauft hatte, war von der Nationalbibliothek nie Einspruch erhoben worden. Nun versuchte sie vergeblich, den Verkauf zu verhindern.
Nicht einmal im Prozess konnte geklärt werden, welche Schriftstücke Eva Hoffe in ihrer Wohnung in der Spinoza-Straße und welche sie in Bankschließfächern aufbewahrte. In einer eidesstattlichen Erklärung versicherte sie, dass sich in ihrer Wohnung keine Kafka-Papiere mehr befanden. Die Sorge um das Schicksal dieser Schriftstücke schürte sie selbst, als sie während des Prozesses behauptete, Einbrecher hätte sich Zugang zu ihrer Wohnung in Tel Aviv verschafft. Bis heute ist nicht geklärt, ob etwas entwendet wurde und wenn ja, was.
Dabei hatte es durchaus den Versuch einer Katalogisierung gegeben. In den 1980er Jahren beauftragte Ester Hoffe den Schweizer Philologen Bernhard Echte, damals Direktor des Robert-Walser-Archivs in Zürich, die Schriftstücke, die sich in ihrem Besitz befanden, zu inventarisieren. Die mehr als 140 Seiten lange Liste verzeichnet 20.000 Seiten Material. Bis heute jedoch ist Echtes Inventarliste ein streng gehütetes Geheimnis und wurde auch dem Gericht nicht vorgelegt.
Richterin Kopelman Pardo ordnete 2010 an, die Bankschließfächer der Familie Hoffe zu öffnen, vier in einer Zürcher Bank und sechs weitere in Tel Aviv (in der Leumi-Bank in der Jehuda-Halewi-Straße). Eva Hoffe durfte weder in Zürich noch in Tel Aviv zugegen sein. In Tel Aviv versuchte sie, rasend vor Wut, in den Tresorraum vorzudringen. »Das sind meine, das sind meine!«, schrie sie. »Ich habe getobt wie ein wildes Tier«, erzählte sie mir später.
Die Hoffe-Schließfächer der Zürcher UBS-Bank in der Bahnhofstraße wurden am 19. Juli 2010 geöffnet. Jemima Rosenthal vom Israelischen Staatsarchiv hatte Professorin Itta Schedletzky gebeten, mit einer gerichtlich bestellten Arbeitsgruppe das Material in den Schweizer Schließfächern zu sichten und bei der Inventarisierung des Inhalts zu helfen. Das Honorar für die Arbeiten sollte das Justizministerium übernehmen. Schedletzky, renommierte Germanistin an der Hebräischen Universität, hat unter anderem Gershom Scholems Briefe herausgegeben und ist Mitherausgeberin der Kritischen Ausgabe von Else Lasker-Schülers Werken und Briefen. Mir erzählte sie, als junges Mädchen habe sie Brods Armer Cicero (1955) als Fortsetzungsroman in der Neuen Zürcher Zeitung gelesen. Für die 1943 in Zürich geborene Schedletzky war die Aktion in Zürich mit einer merkwürdigen Heimkehr verbunden, fand sie sich doch in der Stadt ihrer Kindheit in eben der Straße wieder, in der sie als Kind mit ihrer Mutter oft einen Schaufensterbummel gemacht hatte.
Auch hier tauchte Eva Hoffe ungebeten auf und versuchte, sich Zugang zum Tresorraum zu verschaffen. Sie mutmaßte, dass die Anwälte nach einem »versteckten« Testament Brods suchten (das zeitlich nach der Version von 1961 entstanden war), und fürchtete, einer der Anwälte könnte Manuskripte mitgehen lassen. Der Filialleiter drohte, die Polizei zu rufen, wenn sie die Bank nicht freiwillig verlasse. Sie weigerte sich hartnäckig. »Ich zitterte innerlich«, berichtete mir Eva Hoffe später, »aber ich ließ mir meine Angst nicht anmerken.« Schedletzky nahm sie zur Seite und konnte sie beruhigen. »Ehud Sol sah mich an, als hätte ich eine Löwin gezähmt«, erzählte die Professorin.
Ehud Sol, Verwalter des Brod-Nachlasses, konnte sich später noch gut an den Vorfall erinnern. »In der Schweiz führte man uns in riesige Tresorräume, wo der Filialleiter und mehrere Bankangestellte schon auf uns warteten, weil sie um die historische Bedeutung des Ereignisses wussten. Als wir die Schließfächer öffneten, hatten wir – und das geziemt sich für einen Anwalt eigentlich nicht – Tränen in den Augen«, wird er in der israelischen Tageszeitung Ha’aretz zitiert. Angesichts Sols Ruf als erbarmungsloser Prozessanwalt belegt diese Aussage eindrücklich, wie denkwürdig das Ereignis war. (Schedletzky bezeichnet seine Darstellung allerdings als »Unsinn«.)
Vier Schließfächer enthielten Manuskripte, die Brod in den 1950er Jahren in der Bank deponiert hatte. Schon auf den ersten Blick waren sie verführerisch: In Schließfach S6588 hatte Brod in einem braunen Umschlag eine Notiz mit Datum 1947 deponiert, in der er erklärte, dass die drei Hefte mit Kafkas Pariser Reisetagebüchern Ester Hoffe gehörten.
In Schließfach S6577 fand man unter anderem eine braune Mappe, auf der Brod mit schwarzer Tinte vermerkt hatte: »Kafkas Brief an den Vater, Original (Eigentum von Frau Esther Hoffe.)« Darunter stand in blauer Tinte: »Mein Eigentum Ilse Esther Hoffe, 1952«.
Schließfach S6222 enthielt zwei Mappen. Auf die erste hatte Brod geschrieben: »Kafkas Briefe an mich, die veröffentlicht wurden, mein Eigentum – gehört Esther Hoffe.« Auf der zweiten stand: »Kafka meine Briefe an Franz – gehört Esther Hoffe – 2. April 1952, Tel Aviv Dr. Max Brod«3.
Brods Notizen auf den Kuverts und Mappen wurden fotografiert, und Ilan Harati vom Israelischen Staatsarchiv prüfte den Erhaltungszustand des Inhalts. Die Entdeckungen schienen zu bestätigen, dass Brod Ester Hoffe die Kafka-Handschriften zu Lebzeiten geschenkt hatte. Und sie bestätigten Brods Sammelleidenschaft, insbesondere für alles von Kafkas Hand (bis hin zu Skizzen und Kritzeleien).4
Bei der Anfertigung der Inventarliste für das Material in den Schließfächern fühlte sich Schedletzky von den israelischen Anwälten im Tresorraum ungebührlich zur Eile getrieben. Doch trotz der knapp bemessenen Zeit konnte sie einen Briefwechsel zwischen Ester Hoffe und den deutschen Herausgebern der Kritischen Ausgabe von Kafkas Werken vermerken. Diese Briefe bewiesen, dass Hoffe ungeachtet gegenteiliger Behauptungen »systematisch und regelmäßig« Einsicht in die Kafka-Papiere ermöglicht hatte. Kaum zu glauben, aber Schedletzky wurde nie vorgeladen, um ihre Erkenntnisse dem Gericht vorzutragen.
Auch in anderer Hinsicht blieb die Inventarliste unvollkommen. Eva Hoffe wurde, wie sie mir erzählte, eine Geldstrafe von 15.000 Schekel (heute etwa 3500 Euro) auferlegt, weil sie sich einer gerichtlichen Anordnung zur Durchsuchung ihrer Wohnung, die eine Inventarisierung der Manuskripte ermöglicht hätte, widersetzt habe. Solch eine Durchsuchung erinnere sie an »Gestapo-Methoden«, so Eva Hoffe.
Die 170 Seiten lange, aber unvollständige Inventarliste für die Schließfächer in Tel Aviv und in Zürich verzeichnete etwa 20.000 Briefe (darunter vermutlich etwa siebzig Briefe von Kafkas letzter Geliebten Dora Diamant an Brod), Brods unveröffentlichte Tagebücher,5 zwei Dutzend unbekannte Zeichnungen Kafkas und Originalhandschriften von Kurzgeschichten (unter anderem »Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande«).6 Ende Februar 2011 ging diese Inventarliste an Richterin Kopelman Pardo.
Eva Hoffe beklagte unterdessen, sie müsse sich mit Almosen über Wasser halten. Zwar hatte sie wie ihre Mutter Wiedergutmachungszahlungen der Bundesrepublik Deutschland erhalten, doch den Großteil ihrer Ersparnisse musste sie nach eigener Aussage nach Ester Hoffes Schlaganfall für die Reha-Maßnahmen im Ichilov-Krankenhaus ausgeben. Auch Anwaltskosten sammelten sich an. Eva Hoffe machte Bedürftigkeit geltend und beantragte über ihren Anwalt Uri Zfat, wenigstens den finanziellen Teil des Nachlasses ihrer Mutter freizugeben (darunter Wiedergutmachungszahlungen, die Ester Hoffe aus Deutschland erhalten hatte und die sich Eva Hoffe zufolge auf etwa vier Millionen Schekel, knapp 950.000 Euro, beliefen). Im August 2011 gab Richterin Judith Stoffman vom Tel Aviver Bezirksgericht dem Antrag statt und erlaubte Eva Hoffe und ihrer älteren Schwester Ruth Wiesler, das Erbe über jeweils eine Million Schekel anzutreten.
Für Wiesler, Schneiderin und Aromatherapeutin im Ruhestand, war das zu wenig und kam zu spät. Der Prozess verstörte sie dermaßen, dass sie sich nicht überwinden konnte, die Verhandlungen zu besuchen oder auch nur die Gerichtsprotokolle zu lesen. 2012 starb sie im Alter von achtzig Jahren an Krebs und ließ Eva mit dem Kampf allein. »Ich mache die Vertreter der Nationalbibliothek für den Tod meiner Klientin verantwortlich«, erklärte Ruth Wieslers Anwalt Harel Aschwall gegenüber der Sunday Times. »Sie waren aggressiv und unanständig. Meiner Ansicht nach haben sie versucht, Ruth und Eva zu ermüden, damit sie aufgeben.« Wiesler hatte zwei Töchter, Anat und Jael. Auch Anat schob das Ableben ihrer Mutter auf die Mühsal des Prozesses. »Eine Frau, die ihr Leben lang gesund war, bekommt plötzlich Krebs und stirbt – das alles hat sie einfach kaputt gemacht«, sagte sie gegenüber der Zeitung Ha’aretz.
Im Oktober 2012, ein halbes Jahr nach Ruth Wieslers und fünf Jahre nach Ester Hoffes Tod, veröffentlichte Richterin Talia Kopelman Pardo vom Tel Aviver Familiengericht auf 59 Seiten ihr Urteil, das mit einer poetischen Note begann: »Es ist nicht alltäglich und ganz sicher nicht selbstverständlich, wenn eine Richterin die Tiefen der Geschichte auslotet, die sich ihr Bruchstück für Bruchstück, Scherbe für Scherbe offenbart, eher rätselumwoben als einsichtig. Ein schlichter Antrag auf Bestätigung eines Testaments, eingereicht von den Töchtern der verstorbenen Frau Ester Hoffe, hat ein Tor zum Leben, zu den Wünschen und Enttäuschungen – ja zu den Seelen – zweier großer Geister des 20. Jahrhunderts geöffnet.«
Die Richterin rechtfertigte die Wiederaufnahme des Verfahrens gegen Ester Hoffe, das Richter Schilo vierzig Jahre zuvor eigentlich schon entschieden hatte, durchaus ungewöhnlich, mit einem Romanzitat aus Kafkas Der Prozess:
Bei einer wirklichen Freisprechung sollen die Proceßakten vollständig abgelegt werden, sie verschwinden gänzlich aus dem Verfahren, nicht nur die Anklage, auch der Proceß und sogar der Freispruch sind vernichtet, alles ist vernichtet. Anders beim scheinbaren Freispruch. Mit dem Akten ist keine weitere Veränderung vor sich gegangen, als daß er um die Bestätigung der Unschuld, um den Freispruch und um die Begründung des Freispruchs bereichert worden ist. Im übrigen aber bleibt er im Verfahren, er wird wie es der ununterbrochene Verkehr der Gerichtskanzleien erfordert, zu den höhern Gerichten weitergeleitet, kommt zu den niedrigern zurück und pendelt so mit größern und kleinern Schwingungen, mit größern und kleinern Stockungen auf und ab. Diese Wege sind unberechenbar. Von außen gesehn kann es manchmal den Anschein bekommen, daß alles längst vergessen, der Akt verloren und der Freispruch ein vollkommener ist. Ein Eingeweihter wird das nicht glauben. Es geht kein Akt verloren, es gibt bei Gericht kein Vergessen.7
Das Urteil aus dem Jahr 1974 zugunsten Ester Hoffes habe man nicht vergessen, schrieb Richterin Kopelman Pardo, doch die Schwingungen hätten, unberechenbar, eine andere Richtung genommen. Kopelman Pardo lehnte Eva Hoffes Antrag auf Bestätigung des Testaments ihrer Mutter ab. Sie entschied nicht darüber, ob Kafkas Manuskripte Brod gehört hatten, folgte aber dem Argument des israelischen Staates, Brod habe seinen Nachlass – einschließlich Kafkas Papieren – Ester Hoffe nicht als Schenkung, sondern zu treuen Händen überlassen. Sofern bestimmte Bedingungen nicht erfüllt würden, könne eine Schenkung ungeachtet der Absicht des Schenkenden oder Erblassers rechtlich unwirksam werden.
Zwar habe Brod beabsichtigt, Ester Hoffe die Manuskripte als Schenkung zu überlassen, doch de facto waren sie auch weiterhin unter seiner Verfügung, und er habe allein über sie bestimmt. Auch nachdem er schriftlich bestätigt habe, dass Hoffe die Kafka-Papiere erhalten sollte (siehe Kapitel 13), habe sich Brod verhalten, als gehörten sie noch ihm. Im April 1952 habe er beispielsweise Marianne Steiner in London eine Liste zugeschickt, die verzeichnete, welche Kafka-Schriften ihm und welche den noch lebenden Kafka-Erben gehörten. Mit keinem Wort habe er erwähnt, dass er etwas an Hoffe übergeben hatte. Im August 1956 unterzeichnete Brod ein Dokument, in dem die Bedingungen spezifiziert wurden, unter denen er dem deutschen Kafka-Experten Klaus Wagenbach Einsicht in diese Papiere gewährte: nur in Brods Wohnung, nur für Forschungszwecke, nicht zur Veröffentlichung und so weiter. Brod, nicht Ester Hoffe, gab die Erlaubnis und legte die Konditionen fest. Und schließlich sagte Brod in einem Interview mit der israelischen Zeitung Ma’ariv im Oktober 1961: »Ich überlege noch, was ich [mit den Kafka-Schriften] tun soll.« Als sein Gegenüber fragte, ob er sie sehen könne, erwiderte er: »Nein! Ich habe sie in einem Bankschließfach.« Er sagt Ich, nicht Ester und ich. (Richterin Kopelman Pardo ging allerdings nicht auf die Aussage Ester Hoffes im Prozess 1973/1974 ein, Kafkas Handschriften von »Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande« und »Beschreibung eines Kampfes« hätten sich »seit 1947 in meinem Safe« befunden, und sie habe sie Brod gebracht, wenn er sie für seine Arbeit brauchte. Über die Handschrift von Der Prozess hatte Ester Hoffe am 11. Januar 1974 vor Richter Jitzchak Schilo ausgesagt: »Ich habe sie, glaube ich, 1952 erhalten und in meinen Safe gelegt. Er [Brod] schenkte sie mir. Ich nahm sie aus seiner Wohnung mit. Nur, wenn er damit arbeitete, brachte ich sie ihm vorbei.«) Ester Hoffe wagte es jedenfalls nicht, zu Brods Lebzeiten eins von Kafkas Manuskripten zu verkaufen. (Eva Hoffe zufolge hatte das den einfachen Grund, dass Brod die Schriftstücke für seine Arbeit als Lektor und Herausgeber von Kafkas Werk brauchte.)
Die Richterin berief sich auf Artikel 873 der Mecelle; das Zivilgesetzbuch des Osmanischen Reichs hatte im Staat Israel gegolten, bis man es 1968 durch ein eigenes Schenkungsrecht ersetzte. Danach wurde, so die Richterin, Brods Schenkung an Hoffe nicht vollendet oder vollzogen.8 (Die Behauptung, dass die Schenkung, die das Leben ihrer Mutter so sehr bestimmt hatte, gar nicht vollzogen worden war, empfand Eva Hoffe als besonders tiefe Kränkung.) Die Kafka-Schriftstücke seien nie aus Brods literarischem Nachlass entfernt worden, so Kopelman Pardo. Brods Wille unterliege »dem Erbfolgeprinzip«: Da Ester Hoffe zu Lebzeiten nichts anderes verfügt habe, müsse Brods literarischer Nachlass, wie in seinem Testament festgelegt, einer öffentlichen Bibliothek oder einem Archiv ausgehändigt werden. Ester Hoffe habe das Recht gehabt, über die Unterbringung des literarischen Nachlasses zu entscheiden, doch nachdem sie dieses Recht nicht ausgeübt hatte, hätte sie diese Entscheidung nicht an ihre Töchter weitergeben dürfen.
Es war der letzte Prozess, dem Richterin Kopelman Pardo vorsaß. Nach zwölf Jahren auf dem Richterstuhl und nachdem Kafka ihr auf den Gipfel ihrer Richterkarriere verholfen hatte, kehrte sie in die private Anwaltstätigkeit zurück und eröffnete eine Kanzlei für Erb- und Familienrecht. Eva Hoffe meinte, die Richterin habe sich nicht aus Altersgründen zurückgezogen, sondern habe nur verhindern wollen, dass die Fehler in diesem Prozess sie im Richteramt noch einholten. Dieser Verdacht entsprang allerdings wohl eher Eva Hoffes Unzufriedenheit mit dem Urteil als fachlichen Fehlern Kopelman Pardos.
Awiad Stollman, in der Israelischen Nationalbibliothek verantwortlich für die Akte Kafka, begrüßte das Urteil: »Da die Bibliothek die Aufgabe hat, die Kulturschätze des Staates Israel und des jüdischen Volkes zu sammeln, zu bewahren und zugänglich zu machen, ist das in unseren Augen ein großer Erfolg.« Mark Gelber sprach von einer »sehr mutigen Entscheidung«.
Brods literarischer Nachlass hat, wie Eva Hoffe im Prozess stets betonte, für sie mehr als nur kommerziellen Wert. Die Papiere seien »wie Gliedmaßen meines Körpers«, sagte sie und lehnte Schmulik Cassoutos Angebot ab, einen Vergleich auszuhandeln. »Sie verfolgte lieber das Prinzip ›Alles oder Nichts‹«, sagte Cassouto. Eva Hoffe erzählte mir eine andere Version: Nach Kopelman Pardos Urteil habe sie vorgeschlagen, die Handschriften dem Marbacher Literaturarchiv zu verkaufen und den Gewinn der Nationalbibliothek zu geben. Die Nationalbibliothek habe das Angebot abgelehnt. »Und mir werfen sie Profitgier vor!«, sagte sie. Auch eine Mediation unter Leitung Gabriela Schalevs (Juristin und ehemalige UN-Botschafterin für Israel) erbrachte keinen Kompromiss.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.