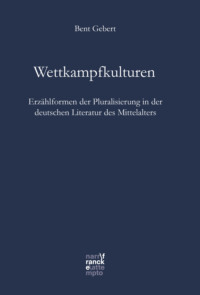Kitabı oku: «Wettkampfkulturen», sayfa 16
(3.) Paradigmatisch ist der Gerichtskampf zwischen Iwein und Gawein schließlich für ein Wettkampferzählen, dessen untergründige Paradoxien über sich hinaus wuchern.27 Im Widerstreit von Verbergen und Enthüllung entwickelt der Zweikampf zwei Schleifen von je drei Wendungen, bevor Artus eingreift. Gleichzeitig ist die gesamte Episode Teil einer Erzählstruktur, die ebenfalls mehrfach aus- und einlagert. In zwei Gerichtskämpfe – um Lunete und sodann im Erbstreit der Schwarzdorntöchter – werden Aventiuren mit Wettkämpfen gegen Riesen eingelagert. Zweimal taucht Iwein damit in Binnenerzählungen hinein und wieder auf, um sich dem Gerichtskampf abschließend zu stellen. In zeitlicher Hinsicht werden dadurch Handlungsaufschub und Erwartung gedehnt,28 in formaler Hinsicht werden Wettkämpfe in die Kontexte übergeordneter Wettkämpfe komplex eingeordnet.29 Für die ältere Forschung erwuchsen daraus Fragen an die Schemavariationen des Doppelwegs. Entscheidender für die Fragestellung dieser Arbeit ist jedoch die Beobachtung, dass der Iwein-Roman auch in seiner Makrostruktur ähnlich mit Ein- und Auslagerungsbeziehungen experimentiert, wie sich offener Streit der Schwestern zum paradoxen Wettstreit im Herzen der Gerichtskämpfer verpuppt, von wo er wieder zur öffentlichen Konkurrenz um Ehre hervorbricht, die schon zu Romanbeginn die Erzählrunde der Artusritter bestimmte.
Iweins Wettkampf mit Gawein markiert somit Ausgangs- und Schlusspunkt des Aventiurewegs zugleich. Traditionell hatte ihm die Forschung daher ein hohes symbol- und erzählstrukturelles Gewicht beigemessen, ohne seine Entwicklungsrichtung grundlegend infrage zu stellen. Könnte die paradoxe Form des latenten Kampfes, auf die Hartmanns Bearbeitung besonders hinweist, damit den Roman ebenfalls grundlegender prägen, als thematisch orientierte Lektüren zu zeigen vermochten? Mehrfach unternimmt der Iwein-Roman schließlich Versuche, die Unterscheidungskraft von Kämpfen in komplexem Nebeneinander einzulagern und wiederum Differenzen auseinander zu stellen, also koordinativ und subordinativ zu ordnen. Dadurch entsteht eine Reihe experimenteller Relationen, die je nach Zugriff übereinander und nebeneinander erscheinen können: Im Blick auf die Identität des Protagonisten, die sich als ritterlicher Habitus phasenweise über die schmutzige Haut der Wildheit schichtet, Iwein aber ebenso in metonymischer Gestalt seines Löwen zur Seite steht; in den Sphären männlicher bzw. weiblicher Landesherrschaften des Artus- bzw. Laudine-Hofs, die sich nebeneinander behaupten, Iwein jedoch in Priorisierungsprobleme verwickeln; aber auch auf Ebene übergeordneter Erzählschemata, die Iweins Fristversäumnis, Flucht und Rückkehr in die höfische Welt nebeneinander als Rechtsbrecherroman (Volker Mertens), Erlösergeschichte und Feenmärchen lesbar machen (Ralf Simon), die zugleich von der Desintegration und Reintegration der ritterlichen Person in die höfische Kultur handeln (Bruno Quast). Hartmanns zweiter Artusroman scheint an solchen Kombinationen von horizontalen bzw. vertikalen Strukturen zu arbeiten, die ineinandergreifen können, sich aber ebenso nebeneinander stellen lassen. Wie weit trägt es für die Erforschung des Romans, eine dieser Lektürehypothesen zu bevorzugen?
Die folgende Analyse sucht stattdessen zu erweisen, dass Hartmanns Iwein eine spezielle »Komplexitätstoleranz« gegenüber solchen Strukturfragen auslotet:30 im Erzählen von Wettkämpfen, die zwar nacheinander dargeboten, auch gelegentlich verschachtelt werden, unter formalen und funktionalen Gesichtspunkten jedoch weder auf Linearität noch auf Fixzustände zielen. Vielmehr erlaubt der agonale Erzählmodus der Latenz, zwischen geringeren oder größeren Komplexitätsgraden hin- und herzuwechseln, Vielfalt aufzudecken oder zu verbergen. Für biographisch fundierte Erzählkonzepte wie für Konfliktlösungserwartungen des Artusromans liegt darin zum einen die Zumutung, Identitäten weniger als Fortschritte von Krisenbewältigung, Lernwegen und Einsicht zu betrachten, sondern als komplexe Inkorporierungsdynamiken des Ein- und Ausschließens (von Beginn an verbirgt Iwein seine Pläne und Verpflichtungen in sich, V. 2962, die er nach dem rhetorischen Muster des Selbstgesprächs ausführlich mit dem Rezipienten teilt);31 zum anderen konfrontiert Hartmanns Iwein mit ritterlichen Kämpfen, die soziale Ordnung nicht schärfen und disambiguieren, sondern bis zuletzt verunsichern. Die Form der Latenz macht derartige Komplexität skalierbar: Sie wird erträglich, indem sie Unterscheidungen aufdeckt und vervielfältigt, aber ebenso zu kondensieren, zu verdecken und scheinbar zurückzunehmen vermag. Weil diese Vervielfältigung von Identität auf einer Erzählkunst der Dosierung beruht, bezeichne ich sie im Folgenden als ›höfische Latenz‹.
Ich rekonstruiere dieses Experiment in drei Schritten, indem ich zunächst einen Blick auf Vervielfältigungsstrategien des Romans werfe. Sie prägen verschiedene Motive, Handlungen und Erzählerkommentare, die verborgene Differenzen aufdecken: Sie enthüllen die Schichten von Iweins Körper, öffnen sich geradezu bodenlos in der Frage nach der Identität des Löwenritters; sie werden in öffentlichen Anklageszenen artikuliert und in Gerichtskämpfen inszeniert, aber auch im strît des Erzählers mit frou minne auf Diskursebene verdoppelt, der Iweins latente Doppelverpflichtung als Artus- und Laudineritter offenlegt. In einem zweiten Schritt ist anschließend zu fragen, welche Gegenbewegungen diese Kämpfe und Differenzen wiederum verbergen. Drittens prägen Aufdecken und Verbergen nicht nur die Ebene der Wahrnehmung, sie erschöpfen sich weder in rhetorischer Imaginationssteuerung noch in der Problematisierung von Erkennensvorgängen, wie sie die Forschung registrierte.32 Ihr Zusammenspiel, so die Synthese, etabliert vielmehr Transformationsbeziehungen der Latenz, die in umfassendem Sinne Figuren und ihre Relationen, erzählte Entwicklungen wie auch den Erzählprozess selbst zwischen Einfachheit und Komplexität changieren lassen.
3.2 Aufdecken
3.2.1 bistûz Îwein, ode wer? Identität ohne Boden
Das ›komplizierte Herz‹ verbindet die Zweikämpfer Iwein und Gawein nicht erst am Ende des Romans. Schon von Beginn treiben Iwein Inferioritätsgefühle gegenüber dem Vorzeigeritter Gawein an, die Brunnenaventiure vor Artus und allen Rittern auf eigene Faust zu suchen. Nur mit dem Rezipienten teilt Iwein im Soliloquium diese Furcht vor dem Konkurrenten, der gewiss bei der Vergabe der Herausforderung bevorzugt würde:
er gedâhte »ichn mac daz niht bewarn,
und wil der kunech selbe varn,
mirn werde mîn rîterschaft benomen.
mir sol des strîtes fur chomen
mîn her Gâwein.
wan des ist zwîfel dehein,
alsô schiere so er des strîtes gert,
ern werdes fur mich gewert.[«]
(V. 911–918)
Der Bericht von Kalogreants Scheitern wandert so in Iweins Herz, wo er insgeheim den rivalisierenden Wunsch entzündet, dem öffentlich regulierten Wettkampf der Artusritter zuvorzukommen. Den Roman eröffnet somit gleich zu Beginn eine Potenzierungsstruktur unterlaufener Wettkämpfe. Und ganz wie im Schlusskampf treibt auch die Initialaventiure voran, dass Iwein seinen Konkurrenten nicht bloß zu übertreffen sucht, sondern seinen Verwandten und Mentor zugleich anerkennt (min her Gâwein). Während die öffentliche Aventiureerzählung gleichermaßen Aufmerksamkeit und Spott über einen Kampf anzieht, die nicht aus der Welt zu schaffen sind, eröffnet der geheime Wettkampf alle Optionen, das Resultat zu verbergen oder aufzudecken (V. 941–944). Mit diesem Latenzkalkül bricht Iwein auf.
Was Iwein nach dem Wettkampf an der Gewitterquelle erlebt, häuft verdeckende Schichten über dieses geheime Kalkül der êre. Denn keine einzelne Zäsur einschneidender Schuld stürzt Iwein in die Krise, sondern eine dichte Folge – vom heimlich vollzogenen Bruch mit der königlichen Heeresfolge und Landfriedensbruch in der Zeit des Gottesfriedens über die Tötung des fliehenden Askalon bis zu Pflichtversäumnissen als neuer Landesherr des Brunnenreichs und zur Übertretung ehelicher Terminzusagen. Volker Mertens bilanziert:
Iwein hat Frau und Land durch schwere und leichtere Rechtsverstöße gewonnen. Daher erscheint es als übergeordnete Gerechtigkeit, daß er im zweiten Teil wegen des Versäumnisses seiner Pflichten von Laudine verstoßen wird, den Verstand verliert und erst einen mühsamen Lernprozeß absolvieren muß, bevor er wieder zurückkehren kann.1
Genau genommen begeht Iwein keine singuläre Verletzung, sondern akkumuliert zahlreiche »Rechtsverstöße«. Weder sind alle auf ein übergreifendes Entwicklungsschema bezogen, wie die Rede von Krise, »Lernprozeß« und Rückkehr insinuiert; noch lassen sich alle auf Laudine als Zentrum eines ›Feenmärchens‹ um Tabu und Transgression hinordnen.2 Vielmehr verzweigt sich Iweins latenter Wettkampf mit Gawein rasch zu komplexen Differenzen, die ihn gegenüber dem Artushof und seinen Rittern, gegenüber dem Quellenreich und den Disziplinierungsansprüchen ritterlicher Gewaltausübung problematisch verstricken. Der Iwein-Roman überhäuft damit seinen Protagonisten mit Relationen, ohne dass dieser sich je enthüllt hätte.
Eine solche Entblößung geschieht erst, nachdem Iwein zum Landesherrn an der Seite Laudines erhoben wurde und auf ritterlicher Turnierfahrt an der Seite Gaweins öffentlichen Ruhm eingefahren hat.3 Lunetes öffentliche Anklage4 am Artushof ebenso wie seine Selbstvorwürfe treiben Iwein aus der höfischen Gesellschaft fort und in ein unbestimmtes Irgendwohin (ettewâ), wo sich Iwein ganz dem betäubenden herceleide (V. 3197) hingeben kann und niemer gehôrte maere / war er bechomen waere (3219f.). Dieser Latenzraum der wilde (V. 3238) ist der Wald, wo Iweins tobesuht5 (V. 3233) Schicht um Schicht seiner Identität abträgt. Und dies ganz konkret: er brach sîne site und sîne zuht / und zart abe sîn gewant, / daz er wart blôz sam ein hant. (V. 3234–3236) Iwein reißt sich die Kleider vom Leib und damit jene Schichten, welche die religiöse Anthropologie des Mittelalters als Habitus der Seele deutet.6
Hartmanns handgreiflicher Vergleich (›nackt wie eine Hand‹) akzentuiert die Entblößung als rasende Reduktion, die alle höfischen Einzeichnungen und Formen zurücknimmt.7 Umso erstaunlicher ist daher, dass die Damen von Narison in dem verwilderten, schmutzigen Körper trotzdem Iwein wiedererkennen:8
nû iach ein iegelîch man
wie er verlorn wære:
daz was ein gengez mære
in allem dem lande,
unz daz si in erchande
von einer schult und doch niht gar.
si nam an im war
einer der wunden
diu ze manigen stunden
an im was wol erchant
und si nande in zehant.
(V. 3372–3382)
Obwohl Iwein komplett verschwinden wollte, kursieren gerade über sein Verschwinden Geschichten; obwohl er sich von allen Hüllen entblößt, die seine ritterliche Identität manifestieren, gibt gerade dies den Blick auf seine Wunde frei, das heroische Erkennungszeichen des Kampfes schlechthin. Iweins Körper scheint damit eine unhintergehbare Identitätsgrundlage zu bilden, verlässlicher als das narrative Gedächtnis und unauslöschlich eingekerbt, um Wiederkennen zu ermöglichen. Wenn ihm die lindernde Zaubersalbe wieder zu tastendem Selbstbezug verhilft – bistûz Îwein, ode wer? (V. 3509) –, so artikuliert »das Ich des Sprechenden das Ich des nackten, sichtbaren und präsenten Körpers«, wie Mireille Schnyder pointiert.9
Doch Hartmann ist wenig an der Integrität dieses reduzierten Körper-Ichs gelegen. Als die Wohltäterinnen prächtige Kleider bereitlegen (vgl. V. 3453–3456; 3584–3596), schichtet Iwein über seine geschwärzte Haut rasch eine höfische Haut: Als er bedacte die swarzen lîch, / dô wart er einem rîter gelîch (V. 3595f.). Iweins Identität wird dadurch komplexer ›re-investiert‹ (Andreas Kraß), als sie zuvor erschien, indem nun latente und manifeste Oberflächen sich mehrfach schichten. Erscheinung, die soziale Zugehörigkeit verbürgen könnte, wird dadurch zu unsicherem Schein, der höchstens Ähnlichkeit gewährt (einem rîter gelîch). Iwein wird zum Schichtwesen.10
Doch auch in umgekehrter Richtung unterhöhlt Hartmann das vermeintliche Fundament des Körpers. Dies verdeutlicht, nach langen Aventiureketten, der Gerichtskampf mit Gawein, der das Herz der Zweikämpfer als Ort untergründiger Konkurrenz ausleuchtet. Lange zuvor produziert schon Iweins tobesuht unverfügbare Schichten nach innen, die Herz und Körper diskrepant scheiden:
mîn herze ist dem lîbe ungelîch:
mîn lîp ist arm, daz herce rîch.
wie stet ez sus umbe mîn lebn?
ode wer hât mir gegebn
einen lîp sus ungetânen?
(V. 3575–3579)
Diese Inkongruenz wird sich mit dem Aventiureweg Iweins zwar verwandeln, aber niemals schließen. Der vermeintliche Kern seiner Person vervielfältigt sich zu sichtbaren und unsichtbaren Schichtungen.
Wer also ist Iwein? Die Antwort, die aus dieser Spannung heraus entsteht und in sechs Wettkämpfen entfaltet wird, lautet in der Romanwelt einfach: der rîter mit dem leun (V. 5263; vgl. V. 5079, 5502 u.ö.). Das ist nur scheinbar und nicht für alle Figuren als »Preisgabe der alten Identität« zu verstehen,11 denn Lunete gegenüber gibt sich Iwein durchaus zu erkennen.
Der Löwenritter wird vielmehr zum Undercover, das seine paradoxe Konkurrenzbeziehung zu Gawein durch eine Reihe von Verschiebungen verdeckt. Zuerst werden die mehrfachen Schichten auf Iweins Haut im konkreten Sinne abgewaschen. Auf der Burg Narison reinigt man den Ritter unz in diu wilde farwe verlie (V. 3696), Iwein wird sauber: ›wilde‹ Aspekte überträgt und verstärkt die folgende Aventiure dafür auf den Löwen, der als beständiger Begleiter Iweins die vormals vertikale Schichtung von Ordnung und Wildheit in das horizontale Nebeneinander von Herr und Tier überführt (vgl. V. 3696f., 3883, 3921, 4002).12 Wenn Iwein mehrfach den Löwen als Visitenkarte ausgibt, betont selbst die grammatische Form ihr koordinatives Verhältnis (der Ritter mit, bî dem Löwen): daz ein leu mit mir sî: / dâ erchennet er mich bî (V. 5125f.; 5293, 5496f., 7762). Gegenüber der Differenz von Interiorität (herze) und Exteriorität (lîp) von Identität symbolisiert der Löwe ein Drittes.13
Nur oberflächlich kann die horizontale Relation jedoch darüber hinwegtäuschen, dass auch der Löwe weiterhin auf Latenz bezogen bleibt. So deutet es Iwein selbst bei der ersten Begegnung mit dem Tier: Wie Lunetes Anklage ihn in herceleid stürzt (und das Leitwort verfolgt Iwein weiter: V. 5478), so wolle sich der Löwe ebenfalls vor herceleide (V. 4003) über den vermeintlichen Tod seines Herrn selbst töten. Für Iwein figuriert der Löwe somit von Anfang als Selbstzuschreibung emotionaler Latenz, die Inneres veräußerlicht. Und auch der Handlungsgang prägt für diese Latenz ein eindrückliches Bild, das den latenten Zweikampf von Iwein und Gawein besiegelt. Als beide ihre Rüstungen ablegen – alle Aggression scheint verraucht, man will zur Erholung schreiten –, bricht plötzlich der Löwe aus:
[N]û was der leu ûz chomen,
als ir ê habt vernomen,
dâ er in geslozzen wart,
und iagte ûf sîns herren vart,
dô sî in zuo in sâhen
dort uber velt gâhen.
dô flôch man unde wîp
durch behalten den lîp,
unz daz der her Îwein sprach
»ern tuot iu dehein ungemach;
er ist mîn friunt und suochet mich.«
(V. 7727–7739)
Der Ausbruch des Löwen führt nicht nur zusammen, was zusammengehört – er führt nochmals in einer Ausbruchsszene ein wildes Aggressionspotential herauf, das eingeschlossen war. Befremdlich wirkt allerdings der Kommentar des Erzählers: Von einem Einschluss war ja gar nicht die Rede gewesen, sondern nur davon, dass Iwein seinen Begleiter zurückließ, um ihn nicht beim Kampf dabei zu haben (V. 6902–6904). Was beiläufig ausgeblendet schien, bricht nun als Eingeschlossenes hervor. Noch nach dem Ende des Waffengangs zielt der Erzähler auf Effekte der Latenz, die verborgen werden und hervorbrechen kann.
Sie bleiben erhalten – und in strukturellem Sinne unverfügbar. Dies spiegelt die handschriftliche Varianz der Überlieferung, die über die Grenzen der menschlich-animalischen Partnerschaft uneins ist.14 In seiner Analyse war Bruno Quast zu dem Schluss gelangt, dem Löwen als Träger mehrschichtiger Identität sei bei der »Schlußeinkehr bei Laudine […] ein für allemal ein Ende bereitet«.15 Tatsächlich geben die verschiedenen Redaktionen des Romans selbst darauf unterschiedliche Antworten: Während der Iwein der Handschrift A (UB Heidelberg, cpg 397) gleich bei der ersten Begegnung betont, Herr und Tier seien niemals voneinander gewichen unze sie beide sciet der dôt (V. 3881f.), verzichtet Handschrift B (UB Gießen, Nr. 97) auf diese Verse zugunsten eines ›fading out‹:16 Zusammen mit seinem Löwen begibt sich Iwein ein letztes Mal zur Gewitterquelle (V. 7805), doch bleibt offen, was mit diesem geschieht – nur Iweins Eponym bleibt von ihm zurück (V. 7927). Im Kontext der Befreiungsepisode fiel es der Forschung leicht, den Löwen als ethisches Symboltier einer ›Treue bis zum Tod‹ zu deuten. Für die Identität des Helden wirft die Variante von A jedoch das Problem auf, dass die latente Spannung von Aggression und Zuneigung, die der Löwe metonymisch verkörpert, nicht bloß auf eine Entwicklungsetappe begrenzt wird. Unendliche Kontinuität oder unscharfe Begrenzung – in beiden Fällen sperrt sich das Latenzsymbol des Löwen, nicht unähnlich den latenten Wettkampfschleifen zwischen Iwein und Gawein selbst, gegen ein prozessuales Ende.
3.2.2 Anklagen
Gleichwohl: Die Romanhandlung erzählt von vielen konkreten Versuchen, Iweins Latenz aufzudecken. Im fensterlosen Raum zwischen den Burgtoren beslozzen und gevangen (V. 1129), wohin er dem tödlich verwundeten Gegner gefolgt war, beginnen die Burgbewohner nach dem Mörder ihres Herrn zu suchen. Iwein richtet sich auf Widerstand bis zum Letzten ein – michn vindet niemen âne wer (V. 1171) –, da öffnet sich eine Geheimtür in diesem Zwischen- und Innenraum. Lunete, Dienerin Laudines, eilt dem Eingeschlossenen zur Hilfe, indem sie ihm einen Zauberring schenkt:
swer in hât in blôzzer hant,
den mac niemen al die frist,
unz er in blôzzer hant ist,
gesehn noch vinden.
sam daz holz under der rinden
sît ir zwâre verborgen.
irn durfet niht mêr sorgen.
(V. 1204–1210)
Hartmanns Gebrauchsanweisung ist eigenwillig gerahmt: Wer den Ring in ›nackter‹ Hand halte,1 den verberge er wie die Rinde das Holz. Der Vergleich betont dadurch einen Umschlag:2 Der Ring macht nicht einfach unsichtbar, sondern bedeckt und verdeckt, was zuvor offen und bloß lag – ein Latenzzauber verhüllender Schichtung.3
Lunetes Unsichtbarkeitsgeschenk verdankt sich einer früheren Begegnung, die ebenfalls im Zeichen von sozialer Unsichtbarkeit stand. Bei einem früheren Botengang zum Artushof wurde die Dienerin ignoriert (V. 1186f.: daz mir dâ nie dehein man / ein wort zuo gesprach), wegen ihrer Unvertrautheit oder Unzugehörigkeit zum Hof (unhofscheit) schlichtweg übersehen. Mit Ausnahme Iweins:
herre, dô gruozt ir mich
und ouch dâ niemen mêre.
do erbuot ir mir die êre,
der ich iu hie lônen sol.
(V. 1194–1197)
Nicht ohne Grund bringt Lunete die Frage der êre zur Sprache, war doch Iweins Kampf um Distinktion am Artushof von Anfang an als ein Anerkennungsproblem höfischer Öffentlichkeit verhandelt worden,4 die Iweins geheimer Aufbruch und vorgezogener Wettkampf mit dem Brunnenherrn unterläuft. Lunete bietet Iwein somit nicht bloß Hilfe, sondern ihren Teil zum Handel: Verbergen (des Mörders im Burgtor) für früheres Aufdecken (Lunetes in der Hofgesellschaft).
Dass genau dieser Zusammenhang im Zentrum steht, wird szenisch ausgekostet, wenn daraufhin die Burgbewohner den Innenraum durchstöbern, rasend vor Wut über den vermuteten Zauber: Iwein ist da, aber nicht zu finden, obwohl er doch rehte under in ist (V. 1245, vgl. auch 1274–1276, 1371–1380). Dafür decken nun Iweins Blicke die trauernde Witwe auf, die sich dem aufgebahrten Askalon nähert. Laudines Klagegebärden manifestieren nicht bloß ir hercen beswærde (V. 1321–1323), sondern entblößen gleichzeitig einen begehrenswerten Körper: swâ ir der lîp blôzzer schein, / dâ ersach si der herre Îwein (V. 1331f.) Gerade in vollkommener gesellschaftlicher Entblößung al eine bî dem grabe trauernd (V. 1598) erscheint sie dem verborgenen Iwein besonders anziehend.
Den Beobachter Iwein zieht dies machtvoll in den Raum der Sichtbarkeit zurück. Doch spalten sich dabei seine Motive: Ebenso stark wie die erotische Attraktion bannt ihn das ritterliche Kalkül der Ehre, das handgreiflich-sichtbare Beweise des Wettkampfsieges verlangt (V. 1519–1532, 1726–1730).5 Iwein entdeckt sich daher nur über einen komplizierten Stufengang. Partiell verborgen begleitet er die Aufbahrung Askalons, die zumindest seine Gegenwart aufdeckt (auch Laudine vermutet die Latenz eines ›unsichtbaren Geistes‹, V. 1391, 1397); partiell entzogen, nämlich sinnlich eingeschränkt verfolgt Iwein das Begräbnis, während er Laudine nur hören, nicht aber sehen kann (V. 1447), bevor Lunete ihm ein Fenster öffnet; partiell nur eröffnet Iwein dieser gegenüber seine widerstreitenden Ambitionen um Ritterehre und Liebe, die ihn paradox zur herceminne gegenüber seiner Feindin zwingt (V. 1541f.; 1731–1736). Vorerst aber sitzt Iwein räumlich verborgen (V. 1691) und gevangen (V. 1706), bevor ihn Lunete unerkannt in einen komfortableren Nebenraum bringt. Erst ein langes Vermittlungsgespräch zwischen Herrin und Confidente ebnet die Bahn, die völlige Entdeckung sichert.6 Doch so rasch sich Laudine durch die strategischen Vorzüge Iweins trösten lässt, so sehr Iwein von Liebe überwunden, sich Laudine gevangen gibt (V. 1737; Körper und Herz: V. 2239–2244) – betretenes Schweigen trennt beide bei der ersten Begegnung. Wieder ist es Lunete, die verborgen gehegte Gefühle und Absichten hervorlockt, indem sie provozierend an Iweins Schuld erinnert (V. 2256–2281) und so die Kaskade löst. Verbergen und Entbergen bestimmen damit die Figurendynamik von Laudine, Lunete und Iwein von Anfang an. Die Profile von Hartmanns Figuren sind oft diskutiert worden.7 Für die hier verfolgten Fragen ist jedoch entscheidend, dass Latenzoperationen des Verbergens und Aufdeckens die Figuren zu einer triangulären Wettkampfrelation verbinden, die »mit Iweins Unsichtbarkeit die Problematik von Wahrnehmung und Erkennen entfaltet«.8
Ihre dynamischen Umschläge begünstigen paradoxe Effekte. So betont Hartmann schon an dieser Stelle, dass dabei Zuneigung und Aggression aufeinanderprallen – zwischen Iwein und Lunete, die ihre Absichten voreinander verbergen, aber auch zwischen Iwein und Laudine, die dadurch in jenen Widerstreit von Liebe und Feindschaft zueinander treten, der von anfänglicher Konkurrenz bis zum Schlusskampf mit Gawein das komplizierte Herz Iweins antreibt. Deutlich wird damit: Nicht die Frau,9 sondern der männliche Ritter wird zum Dreh- und Angelpunkt dieses Latenzgefüges. Und es scheint diese Latenzordnung zu sein, die den Roman hartnäckiger als irgendeine Identitätsstufe oder Lernkurve des Helden durchzieht.
Mehrfach wechselt die Erzählung dabei die Zugriffsrichtung auf diese Ordnung, wie schon die Burghofszene nacheinander verschiedene Seiten des Dreiecks hervorhebt, dann wieder in den Beobachtungshintergrund zurücktreten lässt. Der Kommunikationsmodus des Klagens und Anklagens trägt wesentlich dazu bei, solche Wechsel herbeizuführen. Auch sie erstrecken sich über den gesamten Roman. Unter spöttischer Lizenz beginnen sie mit den Redewechseln der Artusrunde, die Kalogreants Schande hervorbringen. Nachdem sich Iwein aus dem Raum höfischer Sichtbarkeit verborgen davongestohlen hat, decken Laudines Klagen um Askalon diesen schrittweise auf; macht ihre Anklage zunächst die Kopräsenz des Mörders dingfest, so klagt sich Iwein in einem Soliloquium in sînem muote paradox an, indem er seine Liebe zur Feindin geißelt (V. 1610–1690); doch auch am Artushof fürchtet Iwein spöttische Anklage (daz Key / in niemer geliezze frî, V. 1531f.), sollte er keinen manifesten Beweis des Kampfsieges vorweisen können (V. 1527–1533). An der Klage Laudines entdeckt Iwein wiederum ihre Schönheit (V. 1599–1608). Mit gleichsam gerichtlicher »Beweisführung«10 interveniert Lunete zugunsten Iweins und macht im stichomythischen Schlagabtausch jenen Entscheidungsprozess explizit, der zuvor nur unausgesprochen dem Einverständnis von Herrin und Confidente zugrunde lag (V. 1789–1792). Als Anklägerin Iweins tritt Lunete am Artushof in Erscheinung, womit sie die fallengelassenen Aufgaben des Artusritters als Herr des Quellenreichs und seine ausgeblendete triuwe-Bindung in Erinnerung ruft.11 Noch den Romanschluss inszeniert Hartmann als Manöver des Aufdeckens. Wie bei seinen früheren Aufbrüchen vom Artushof verbirgt sich Iwein ein drittes Mal auf seiner Rückkehr zur Gewitterquelle:
Mit sînem leun stal er sich dar,
daz sîn niemen wart gewar
dâ zehove noch anderswâ,
und machte chuombers weter dâ.
(V. 7805–7808)
Laudine klagt mehrfach: über die erneute Bedrängnis, die das Unwetter für das herrscherlose Land heraufbeschwört (V. 7846: nû sî dir mîn nôt geclagt), sodann über Iweins Achtlosigkeit (V. 8077–8096).12 Der gerichtliche Rahmen, in den die Aussöhnung gestellt wird – Lunete nimmt ihrer Herrin eine förmliche Zusage von Zuneigung ab, der Iweins Schuldbekenntnis (V. 8102–8109) und Sühnefeststellung folgen (V. 8136) –, bindet Iwein und Laudine nicht nur aneinander (dazu genügte der Schwur). Er bringt vielmehr eine Spannung in den Vordergrund, die der gesamte Aventiurezyklus des Löwenritters zurückgedrängt, durch Hilfsbereitschaft eher symbolisch vereinfacht als verhandelt hatte: die Schwierigkeit nämlich, mehrseitige Aufmerksamkeit (V. 8081: ahte) nicht zu verlieren, sobald Handlungskalküle im Verborgenen verlaufen.13 Klagen decken auf, doch zielte schon die Bahrprobe vor der Leiche Askalons auf Unsicherheiten, die auf asymmetrische Räume der Beobachtung verweisen.14 Noch das merkwürdige Schlusstableau (V. 8020: ein wunderlîch geschiht) führt vor Augen, dass der Roman weniger von Versäumnissen seines Protagonisten15 erzählt als vielmehr vom permanenten Gleiten zwischen Wahrnehmbarkeit und Unsichtbarkeit.