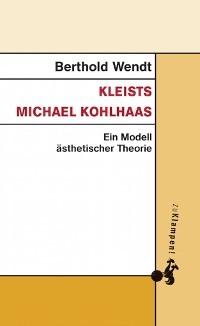Kitabı oku: «Kleists Michael Kohlhaas», sayfa 5
A 01–2) Zum Erhabenen bei Kleist
Die die Kleist’sche Dramaturgie bestimmende Vorstellung des moralischen Wunsches ist im Unterschied zu den Kantisch-Schiller’schen Vernunftideen als Einheit von Allgemeinem (Tugend) und Individuellem (Glückseligkeit) eine spezifische Verbindung, die als Zweck der Moral diejenigen moralischen Ideen ihrer kollektiven Abstraktheit überweist, die bloß ihre gesellschaftlichen Voraussetzungen und Bedingungen als allgemeinverbindliche Pflicht erfassen und sie damit noch ihrem höchsten Zweck gegenüberstellen. Eine idealistische Ästhetik, die durch den Untergang des Einzelnen das Allgemeine triumphieren lassen und dies als die Wahrheit der Kunst propagieren will, erfährt am diskursiv nicht nach Hause holbaren Begriff des höchsten Gutes ihre entscheidende Kritik. Zu einem affirmativen Begriff von Kunst taugt Kunst nicht, die seine Bedeutung verstanden hat; darum auch nicht zu der Vermittlerrolle zwischen theoretischer und praktischer Vernunft, die der Kunst von der idealistischen Philosophie zuzuschreiben versucht wird. Eben weil die Idee des höchsten Gutes in der Kunst so wenig wie in der Philosophie adäquat dargestellt werden kann, schießt sie über ihre indirekte Darstellung hinaus und begründet das Kunstwerk als ein Erhabenes.
Seine maßgebliche theoretische Bestimmung erfuhr der Begriff des Erhabenen bei Kant in der Analytik des Erhabenen in der Kritik der Urteilskraft225. Doch von der Kritik der Urteilskraft aus stellt sich zunächst das Problem der Übertragung der Erfahrung des Erhabenen auf die Kunst. Dazu finden sich bei Kant einander entgegengesetzte Bestimmungen. Denn zum einen ist es nach Kant ausgeschlossen, dass Kunstwerke erhaben sein könnten, da sie als Artefakte planvoll hergestellt und somit niemals formlos seien. »Ich […] bemerke nur, daß, wenn das ästhetische Urteil rein (mit keinem teleologischen als Vernunfturteile vermischt) und daran ein der Kritik der ästhetischen Urteilskraft völlig anpassendes Beispiel gegeben werden soll, man nicht das Erhabene an Kunstprodukten (z. B. Gebäuden, Säulen usw.), wo ein menschlicher Zweck die Form sowohl als die Größe bestimmt, noch an Naturdingen, deren Begriff schon einen bestimmten Zweck bei sich führt (z. B. Tieren von bekannter Naturbestimmung), sondern an der rohen Natur (und an dieser sogar nur, sofern sie für sich keinen Reiz, oder Rührung aus wirklicher Gefahr, bei sich führt), bloß sofern sie Größe enthält, aufzeigen müsse. Denn in dieser Art der Vorstellung enthält die Natur nichts, was ungeheuer (noch was prächtig oder gräßlich) wäre; die Größe, die aufgefaßt wird, mag so weit angewachsen sein als man will, wenn sie nur durch Einbildungskraft in ein Ganzes zusammengefaßt werden kann. Ungeheuer ist ein Gegenstand, wenn er durch seine Größe den Zweck, der den Begriff desselben ausmacht, vernichtet. Kolossalisch aber wird die bloße Darstellung eines Begriffs genannt, die für alle Darstellung beinahe zu groß ist (an das relativ Ungeheure grenzt); weil der Zweck der Darstellung eines Begriffs dadurch, daß die Anschauung des Gegenstandes für unser Auffassungsvermögen beinahe zu groß ist, erschwert wird. – Ein reines Urteil über das Erhabene aber muß gar keinen Zweck des Objekts zum Bestimmungsgrunde haben, wenn es ästhetisch und nicht mit irgend einem Verstandes- oder Vernunfturteile vermengt sein soll.«226 Vergleicht man diese Ausführungen mit den Beispielen, die Kant als geeignete Naturbetrachtungen anführt, so gewinnt die negierende Bestimmung des »Vernichtens« eine Bedeutung, die aus dem problematischen Verhältnis von Begriff und Zweck in diesen Überlegungen resultiert. »Kühne überhangende gleichsam drohende Felsen, am Himmel sich auftürmende Donnerwolken, mit Blitzen und Krachen einherziehend, Vulkane in ihrer ganzen zerstörenden Gewalt, Orkane mit ihrer zurückgelassenen Verwüstung, der grenzenlose Ozean, in Empörung gesetzt, ein hoher Wasserfall eines mächtigen Flusses u. dgl. machen unser Vermögen zu widerstehen in Vergleichung mit ihrer Macht, zur unbedeutenden Kleinigkeit. Aber ihr Anblick wird nur um desto anziehender, je furchtbarer er ist, wenn wir uns nur in Sicherheit befinden; und wir nennen diese Gegenstände gern erhaben, weil sie die Seelenstärke über ihr gewöhnliches Mittelmaß erhöhen, und ein Vermögen zu widerstehen von ganz anderer Art in uns entdecken lassen, welches uns Mut macht, uns mit der scheinbaren Allgewalt der Natur messen zu können.«227 Zweifellos ist bei allen diesen genannten Erscheinungen ein Begriff vorhanden, der es erlaubt, sie in ein Ganzes zusammenzufassen; doch gleichwohl kommt ihrer Erscheinung in der individuellen und aktuellen Wahrnehmung eine beängstigende Qualität zu, die sie gewalttätig und damit in spezifischer Weise unzweckmäßig für die Einbildungskraft erscheinen lassen (und zwar in anderer Weise als einem etwa eine Mücke als ein unzweckmäßiges Geschöpf der Natur vorkommen kann).
Dieser Prozess der negierenden Vernichtung des Zwecks, der den gleichwohl bestehenden Begriff vernichtet228, ist die Angel, vermöge derer die erhebenden Naturbestimmungen auf die Kunstwerke übertragbar sind, von denen Kant sagt, dass das Erhabene »der Kunst […] nämlich immer auf die Bedingung der Übereinstimmung mit der Natur eingeschränkt«229 sein muss. Dem entspricht dann die von Kant herangezogene Erfahrung des Erhabenen angesichts von architektonischen Werken wie des Petersdoms oder der Pyramiden. Weil sich kein Betrachterstandpunkt so wählen lässt, dass er einen Gesamteindruck ermöglicht, ist die Einbildungskraft in ihrer stets neu ansetzenden Synthesis überfordert. Die Repräsentation göttlich legitimierter Herrschermacht in solchen Bauwerken wie den Pyramiden verdankt sich einer organisierten erzwungenen Kooperation, deren Resultat die Vorstellungskraft jedes Einzelnen maßlos übersteigt. Das Erhabene lebt vom Ausdruck dieser Macht, aber zugleich als von ihrer spezifischen Geltung historisch befreit, auch von einem Moment am Erhabenen, das bei Kant ungedacht bleibt: vom Ausdruck des Glückverheißenden der Verschwendung. Da sich bei architektonischen Gebilden stets der Eindruck der Herrschgewalt von Menschen über Menschen aufdrängt, spricht Einiges dafür, dass Kant die Bewirkung des Gefühls des Erhabenen Gegenständen der Natur vorbehalten möchte. Denn da durch moderne Kriegs- und Herrschaftsmittel das Überwältigende an Kulturprodukten so gigantisch angewachsen ist, geht insbesondere von den politischen Erfahrungen seit dem 20. Jahrhundert rückblickend von den ästhetischen Repräsentationen der Macht eher ein Erstarrendes aus: die Ahnung des schicksalslosen molochischen Hinmordens um der Einschüchterung zur Staatsraison willen, deren sich als erhabene Gigantik gebender Pragmatismus die kalte und glatte, technizistisch entzauberte Fassade großindustrieller Fabrik- und Verwaltungsgebäude zeigt. Äußerste leidbringende Verschwendung und äußerste Zweckrationalität sind darin eins und zu ihr gehört die ›Ästhetik‹ der auf internalisierten Befehl herausgepressten Jubelextasen von in Blöcken aufmarschierten Soldaten.
Im Unterschied zu oder in Fortführung von Kants Überlegungen ist nun zu sagen, dass eben dieser Eindruck des Überwältigenden in seiner Zweideutigkeit den Eindruck des Erhabenen ausmacht: nicht nur regt die machtvolle Erscheinung der Natur das Bewusstsein menschlicher Freiheit auf, sondern ist zugleich darin die Erinnerung an die Verschränkung kollektiver Freiheit mit Macht als naturgewaltiger, autoritärer Instanz. Darüber hinaus liegt aber in diesen Naturerscheinungen das Moment einer wilden, scheinbar zweck- und ziellosen, dysfunktionalen Verschwendung von Energie, Kraft und anscheinend grenzenlosen Ressourcen. So erscheint, wenn man als Einzelner davorsteht, auch ein Strom wie der Rhein als erhaben, weil es die Einbildungskraft übersteigt, sich vorzustellen, woher diese Unmengen von vorbeiströmendem Wasser permanent gespeist sein sollten, die aus gigantischem Überfluss ununterbrochen zu Tal geführt werden. Dieser Eindruck scheinbar sinnloser Vergeudung hat eine tiefe Assonanz zum Glück der aus allen Zweck-Mittel-Relationen emanzipierten Lust um der Lust willen: »Vergeudung der Kraft im Glück jedoch, dessen Geheimnis […].«230 Damit ist auch erst der genuin ästhetische Grund der Anziehungskraft des Erhabenen erkannt. Denn die zivilisatorisch hergestellten Bedingungen des Schutzes vor der »scheinbaren Allgewalt der Natur« (K. d. U., B 105) können nur die Voraussetzungen dafür schaffen, den Menschen die inneren Ängste gegenüber der Allgewalt der Lust als einer gewaltigen psychischen Triebkraft zu nehmen. Unter unfreien Verhältnissen ist diese Verschwendung, wie jede Vorstellung eines Festes, nicht von dem Schatten ablösbar, den unter Herrschaftsverhältnissen die Bedingungen werfen, unter denen man sich rückhaltlose Kraftvergeudung ohne Gefährdung der Selbsterhaltung erlauben kann oder die verschwendbaren Güter akkumuliert wurden. Diese Verschränkung einzugestehen ohne moralistische Spielverderberei oder ästhetizistische Verklärung ist der Kunst aufgegeben und gelungen etwa im Schlusssatz der 7. Sinfonie von Beethoven oder in dramatischer Gestaltung im Mozart’schen Don Giovanni. Kant allerdings verkürzt die Analyse des Erhabenen um das dritte Moment, die Erinnerung an die begeisterte Freude an der Verschwendung.231 Dieses von mir analysierte Moment von glückhafter Verschwendung am Erhabenen hat deshalb den frühen Theoretikern desselben nicht auffallen können, weil Natur in der Aufklärung und der Goethezeit ein Kampfbegriff gegen das Künstliche und Manierierte des Adels mit seinem verschwenderischen repräsentativen Pomp gewesen ist. Die Vorstellung von Natur geht darum mit der der ökonomischen Versachlichung korrespondierenden Authentizität zusammen, ohne dass diese doch in der Sache identisch wären; Verschwendung widerspricht dem gesellschaftlich notwendigen Durchschnittsaufwand, dem die Hingabe an die angebliche Natürlichkeit der sozial ›unverstellten‹ Gefühle korrespondieren kann. Das Polemische am stilisierten Naturbegriff streicht das weder dem Adel noch dem Bürgertum dienliche Moment des maßlosen Glücksverlangens aus der Erfahrung des Erhabenen aus. Bedrohlich und zweckwidrig ist es als unvereinbar mit den schmalen Grenzen der bürgerlichen Existenz – und, wie an der Französischen Revolution sichtbar geworden, aus Angst vor seiner aus der Unterdrückung befreiten, aber von ihr noch unmittelbar gekennzeichneten und ggf. völlig entstellten Erscheinungsweise. Diese bildet den Hintergrund etwa der Novelle von der Verlobung auf St. Domingo.232 Die Unvereinbarkeit mit der Behaglichkeit der bürgerlichen Existenz ist ein Motiv, das seit Kleist, E. T. A. Hoffmann und Balzac die Kunst beschäftigt, sich aber mit zunehmender Funktionalisierung der Subjekte unverstellt kaum noch zeigen konnte. Negativ erscheint es zumeist als Todesverlangen (romantisch, neuromantisch oder verschränkt mit dem Neuen bei Baudelaire, oder als Enden-Wollen bei Beckett).
Kants Blick bleibt einseitig fokussiert auf die Elemente Macht und Größe, also der Naturgewalt, und erkennt in der Reaktion des Eindrucks der Anziehung durch und Lust an diesen Mächten nur das Aufrufen des Stolzes auf das moralische Vernunftvermögen, das die Unabhängigkeit des Einzelnen als Teil der Sozietät gegen die Naturgewalt ermöglicht und realisiert. In der Reduktion auf diesen Stolz aber, der von Kant ausdrücklich gegen demütige Unterwürfigkeit abgegrenzt wird233, lebt, wie Adorno als Dialektik der Aufklärung herausgehoben hat, in subjektiver Reproduktion, also unter dem Anschein es sei die ganze Freiheit, die Naturbeherrschung als Unterwerfung des Subjekts unter die Pflicht fort.
Kant ebenso wie Schiller haben also diese Momente der Inkommensurabilität: der Macht und des Glücks am Erhabenen in die Übereinstimmung mit praktischen Vernunftideen eingefangen. Das ordnet dem Vernunftvermögen idealistisch etwas zu, was seinem Sinn nach den Idealismus sprengt. Bei Schiller, für den dann das idealistische Propagieren der Vernunftidee der Freiheit geradezu sadistisch das würdig servierte Leiden des Protagonisten erfordert234, wird es ganz in die kunstvolle Feier der Opferung des Protagonisten überführt: am Untergang des Einzelnen erscheint das Allgemeine. Diese konstruktionelle Integration des Maßlosen, historisch sich auf einer Linie bewegend wie die antiaristokratische Verpönung von Luxus im Interesse wiederinvestierbaren Kapitals, ermöglicht der Hegel’schen Theorie der Kunst die logische Identifizierung des Erhabenen unter der Idee des Schönen als des sinnlichen Scheinens der Idee (Hegel), unter welcher geschichtlich Herrschaft und ihr Zweck dialektisch zusammengezwungen sich verallgemeinern – wenn auch auf Kosten der Kunst als dem ›Bewusstsein von Nöten‹235, die dann nicht länger das »höchste Bedürfnis des Geistes«236 sein kann. Denn die Idee, als geschichtliche Entfaltung der Vernunftideen gefasst und als Stufen des Selbstbewusstseins in Religion, Kunst und Philosophie reflektiert, macht gemäß Hegels systematischer Inhaltsästhetik den Gehalt der Werke aus, wobei das Zurückbleiben der sinnlichen Darstellung hinter dem diskursiven Inhalt in seiner in sich reflektierten Unendlichkeit der anschaulichen Darstellungsweise der Kunst prinzipiell zur Last gelegt wird. – Doch bei Kleist liegt die Sache auf Grund seines emphatischen Begriffs des einmaligen Individuums anders. Die Dialektik zwischen Einzelnem, seinem Leiden, und dem Allgemeinen, der moralischen Vernunftidee, kann darum nicht zu Gunsten des Letzteren positiv ausgetragen werden, sondern bleibt negativ, da das Leiden der Index des Falschen ist und sich nicht in einer heroisch-erzieherischen Geistemphase auflöst. Kleist dreht die Beweislage um: gerade weil dem Leiden objektive Bestimmungen zugrunde liegen, die das Vernunftvermögen aufrufen können237, ist der Bruch zwischen Individuum und Gesellschaft radikal, ist der Schein von Humanität gerade die das Gute vereitelnde Heuchelei. Weil die Vernunfterfahrung bei Kleist in ihrem höchsten Punkt als moralischer Wunsch individuiert ist (in der Liebe, im individuellen Anspruch auf Recht, als Glückseligkeit im höchsten Gut), kann das Individuum nicht gegen sie aufgerechnet werden, d. h. der Konflikt bleibt ungelöst und wird als solcher ästhetisch reflektiert.
Dabei ist das, was den Erkenntnisvermögen unangemessen ist, zunächst ganz allgemein die ästhetische Darstellung als Ganze, denn sie bleibt ambivalent. So stellt sie etwa im Prinz von Homburg die Erfüllung auf der Bühne als real dar, und bleibt doch »ein Traum, was sonst« (I, 709), schon allein deshalb, weil der Prinz wieder in den Krieg ziehen muss.
Darüber hinaus gerät die Darstellung der als persönliche Erfahrung aufgefassten Vernunftidee zu etwas der Einbildungskraft als zweckwidrig und gewalttätig Erscheinendem. Dies wohl am greifbarsten an der Marquise von O… oder an Kohlhaas und auch an Penthesilea oder der Hermannsschlacht. Idealtypisch für Kleists Dramaturgie ist die Marquise von O…, in der das handlungsauslösende Ungeheuerliche eine in der gesellschaftlich zweiten Natur auftretende, gewaltsame und mächtige moralische Naturerscheinung ist, die die Elemente der Bewirkung des Gefühls des Erhabenen in sich trägt.238 Zweckwidrig für die Einbildungskraft ist sie sowohl vermöge ihres empörenden Widerspruchs zu sittlichen Erwartungen, mehr aber noch durch den inneren Widerspruch, dass sie sich unter den gegebenen kriegerischen Umständen eine Äußerungsform geben muss, die sie als das Gegenteil ihrer selbst erscheinen lässt. Der beste Beweis dafür ist, dass der Graf F. selbst seine Tat als todeswürdiges Verbrechen auffasst und es sühnen möchte. Zeit jedoch lässt die Gesellschaft der ihrer Etikette gehorchenden Entfaltung des Glücks des Individuums nicht; die Alternative zur kühnen Untat wäre der Verzicht. Doch Kleist nimmt das bürgerliche Motiv der Liebe als Zeichen der Emanzipation des Individuums ernst. Der Darstellung des Undarstellbaren entspricht darum auf der Seite des Grafen seine Verantwortung eines Unverantwortbaren.
Fasst man die Erfahrung des Erhabenen wie bei mir ausgeführt, als an den Naturerscheinungen wahrnehmbare Verschränkung von (Über-)Macht und Glücksgefühl, so teilt die Erscheinung der Sache in der Marquise von O… diese Bestimmungen. Es erweist sich im Zusammenhang des Haushalts Kleist’scher Dramaturgie die Bezeichnung des Grafen F. als »Teufel« darum als ein Bekenntnis, weil die Marquise damit ausspricht, dass er, wie es die Fähigkeit von Teufeln ist, ihre geheimsten (schlimmen) Wünsche und Gedanken präzis erraten konnte. Als Beleg diene dazu die Szene Der Nachbarin Haus aus Goethes Faust, in der Mephistopheles Frau Marthe bei der ersten Begegnung nur anzuschauen braucht, um ihr kupplerisches und lüsternes Wesen zu erfassen: »Mephistopheles leise zu ihr: ›Ich kenne Sie jetzt, mir ist das genug‹«239. Darin aber ist der Graf F. dem Kurfürsten im Prinz von Homburg mit negativem Vorzeichen kongenial. Denn dieser kundschaftet mit seinem – durch den Ernst, den er ihm gibt – teuflischen, weil Vertrauen realitätsgerecht brechenden Spiel die geheimsten Wünsche der Seele aus (und hält sie für äußerst unstatthaft). Dieses, der subjektiven Vermittlung entzogene und vom anderen als erfüllte Bedingung unterstellte Wünschen ist eigentlich die Situation von Kinderglück, weil ihnen gute Eltern ihre Wünsche am Gesicht ablesen können, und von Jesus Christus den Menschen als Geschichtsziel aufgegeben, weil Liebe als Tugend genau diese Fähigkeit gegenüber den Wünschen anderer einschließt. Aber unter Bedingungen der Selbsterhaltung verletzt es den Stolz eines bürgerlichen Subjekts, das gewohnt ist und es für sein gutes Recht hält, seine Person wie ein Eigentum zu behandeln und über deren Übereignung an die Kenntnis oder den Gebrauch durch andere nicht ohne Gründe zu entscheiden. Wäre der Kurfürst von Anfang an der Übervater, für den er gelegentlich gehalten wird, so beginge er nicht den seinem Staatsamt geschuldeten ›Double-bind‹-Missgriff, die Wünsche seines väterlich geschätzten Prinzen nach realitätsgerechten Maßstäben zu verdammen. Der Graf F. hätte sein ›teuflisches‹ Wissen aber nur realitätsgerecht genutzt, wenn für die Liebe das Tauschprinzip gälte und er sich durch den vom Anderen nicht bewusst ebenfalls gewünschten und erlebten Beischlaf einen persönlichen Vorteil herausgeschwindelt hätte (denn die vielgerügte Vergewaltigung verlief ja ohne Gewalt). Die Liebe der Marquise zum Grafen F. ist hier vorausgesetzt, aber wer dies nicht tut, der müsste nicht nur die schärfste Kritik an ihr üben, weil sie sich doch ›bereden‹ oder ›bestechen‹ lässt, den Grafen zu heiraten und mit ihm noch Kinder zu bekommen, sondern auch noch die Novelle einer Inkonsequenz überführen, da diese Heteronomie mit der durch die Bekanntschaft mit sich selbst autonom gewordenen Marquise inkompatibel ist. Somit verweist aber die Tat des Grafen F. durch ihre ambivalente Zweckwidrigkeit auf die wahre, erhabene Idee dieser Tat. In der Novelle selbst wird sie indirekt von der Marquise ausgesprochen: in der den Gesetzen der bürgerlichen Welt entrückten Realisierung des Glücks, in der Aufgehobenheit von Konkurrenz und Angst, und somit in der Sphäre jenseits von Gut und Böse, kommt es darauf an, Engel und Teufel zugleich zu sein. Diese Idee ist in der Tat des Grafen präsent, aber in der Erscheinung so ambivalent und zweckwidrig für das sittliche Bewusstsein, dass es der Empfänglichkeit für das Erhabene bedarf, um an ihr das verschwenderisch-triumphale Moment des moralischen Wunsches zu erfassen, das darin liegt, es als im Wesen der Liebe liegend zu verstehen, dass sie spontan im Ergreifen der Situation240 lieber die Verwechslung mit einem todeswürdigen Verbrechen in Kauf nimmt als die Liebe den gesellschaftlichen Umständen zu opfern. Durch ihre Gebundenheit an die Situation haftet aber der moralischen Idee unvermeidlich der ›Schmutz‹ der transzendierten Ambivalenz an; und nur eine kunstfremde Aseptik diskursiver Begriffsreinheit könnte sie gänzlich davon befreien. Zugleich bietet gerade sie die Angriffsfläche für die Interpretationen, die das »hier – « (II, 106) Undarstellbare auf seine Bedingtheit zurückgeführt wissen wollen, die es selbst gerade als Erhabenes transzendiert.
Indem nun der Held versucht, das individuell Ungeheuerliche im Ergreifen des moralischen Wunsches in die Formen der Konvention zurückzuführen, öffnet sich dynamisch Schritt für Schritt der Bruch zwischen Vernunft und bürgerlicher Realität – als ihrer vermeintlichen Verwirklichung in der Geschichte – immer klaffender. So wird, wie Adorno formuliert, das Erhabene latent241. Hierbei muss nun im Unterschied zur Kantisch-Schiller’schen Konzeption des Erhabenen an Kleist auffallen, dass die Vorstellungen, die der Einbildungskraft gewaltsam sind, nicht der ersten Natur entstammen, sondern einem Kontrast innerhalb der zweiten Natur, also ihrer mit sich selbst. Der Begriff, den man sich nach Schiller machen muss, über den hinaus dann die Einbildungskraft ins Maßlose getrieben wird, ist bei Kleist nicht einfach Sinnlichkeit, Affekt oder Naturmacht, sondern die Erwartung aus der Begriffswelt der sittlichen zweiten Natur. So teilt jeder Leser der Marquise von O… die sittliche Entrüstung über die derben Landsknechte, die die Marquise vergewaltigen wollen. Und da kommt der Graf F. und macht genau dasselbe! Kann denn, ohne dass sich alle moralischen Begriffe ins Reich des Relativen verwässern, diese Tat etwas anderes als ein unverzeihliches und verabscheuungswürdiges Verbrechen sein? Wie es dem Leser die Erzählung in allen ihren Teilen aber vorführt, ist sie es nur äußerlich betrachtet; in ihrem lebendigen Wesen erweist sie sich als das gerade Gegenteil242. Kaum könnte diese Tat eine größere literarische Aufmerksamkeit beanspruchen, wenn sie nur ein Fall der Kriminalistik wäre, oder, wie das heute als Deutung üblich ist, der Erfahrungsbericht der Verarbeitung eines psychischen Traumas – und hätte dann auch ganz anders literarisch umgesetzt werden müssen. Dagegen entlarvt sich in der Folge ihres blitzhaften Heraustretens aus allen empirischen Bedingtheiten243 – als sinnlichgeistige Spontaneität oder als materiale Kausalität aus Freiheit – diffizil die Verlogenheit bürgerlicher Lebensformen244: diese beginnt bei der desexualisierenden Reinfantilisierung der Marquise durch ihren Vater nach dem Tod ihres Gatten und kulminiert in der grotesken Verlobungsszene nach dem Inserat, ohne damit im Mindesten am Ende zu sein. Somit ist es gerade die gesellschaftlich herrschende Moral, die die Abstoßung durch Zweckwidrigkeit bewirkt und transzendiert wird; transzendiert dann natürlich nicht zu ihren eigenen Moralvorstellungen, sondern zur Vorstellung von ihrer unverkürzten Erfüllung als moralischer Wunsch.
Entscheidend ist aber im Zusammenhang mit dem Erhabenen, dass sich in der Marquise von O… das Ungeheure der Tat und das Ungeheuerliche der Begebenheit dem Leser erst im Verlauf der Erzählung erschließt. Denn an der chronologisch anstehenden Stelle kapituliert die sinnliche Darstellung wegen ihrer Unangemessenheit an den Zweck. Und die Einheit von Darstellung und Dargestelltem ist symbolisiert durch den Gedankenstrich. Dieser ist aber nicht diskursiv misszuverstehen als die Darstellung der Nichtdarstellbarkeit, sondern – und darum steht dieses deiktische Wort im Text – er ist das Symbol des »hier« (II, 106) nicht Darstellbaren. Es bleibt ganz der ästhetischen Darstellung, der Form und ihrer sprachlichen Erfüllung, überantwortet, ob der Wunschgehalt der Tat und sein die Erzählung durchwirkender Sinn erfassbar wird oder nicht; und eben das macht die faszinierende, netzfreie Artistik dieser Erzählung aus, ihr Schweben über dem Abgrund des vernichtenden Scheiterns eines durch mangelhafte Durchführung hervorgerufenen Missverstehens. Denn gerade weil dieser Sinn zu gegebener Stelle nicht erklärt und die Tat nicht geschildert wird, erschließt sich nicht nur beides erst im Verlauf der Erzählung, sondern das Kunstwerk reflektiert in dieser Überantwortung des Sinns an die Sinnverdeutlichung durch seine spezifischen Mittel, dass er nur in der unauflöslichen Spannung der sinnlich-geistigen Elemente im Kunstwerk, in eben dieser Ausgesetztheit gegenüber dem Missverständnis, zu finden ist. Denn in diesem formalen Problem, den Gehalt nicht gegen die Darstellung im zweideutigen Stoff – hier: dem ambivalenten Geist der bürgerlichen Subjektivität – verselbständigen zu können, reflektiert die Kleist’sche Kunst mimetisch die Angewiesenheit ihres erfüllten Sinns auf außerkünstlerische Realität. Erhaben ist daran, dass das Kunstwerk, um nicht Lüge zu sein und Sinn zu hypostasieren, die Erfassung und Erfüllung seines Sinns dem überantwortet, von dem es weiß, dass es ihn in seiner gegenwärtigen Verfasstheit negiert – aber er auch nur sich in ihm als Verändertem erfüllen kann. Ein Vexierbild ist das Kunstwerk dadurch, weil es, hat man seinen Sinn verstanden, die falschen Momente durch seinen Sinn aufhebt und durchschaubar macht, worin dann ggf. das Dramatische ins Komische, in die Karikatur umschlägt; – dessen Gegenbild ist es aber auch als die Darstellung der domestizierenden Unterjochung seines Sinns unter die bürgerlichen Lebensformen, denen er skandalös ins Gesicht geschlagen hatte. Seine Dramatik wird dann düster, weil sie ein am Ende ohnmächtiges Sich-Aufbäumen, eine vergebliche Liebesmüh’ dokumentiert. Kleists Gesamtwerk reflektiert diese beiden Möglichkeiten durch die Verwendung der Form der Komödie (z. B. Käthchen, Zerbrochener Krug) oder der Tragödie (z. B. Penthesilea, Kohlhaas) oder dem Schweben zwischen beiden: (z. B. Amphitryon, Homburg).
Eine Interpretation muss nun aber unvermeidlich den Sinn als gesicherten nehmen, selbst wenn sie hernach seine Ausgeliefertheit darzulegen versucht. Sie täte sich und ihrer Sache keinen Gefallen, wenn sie diesen zu überspringenden und zu betonenden spekulativen Spalt nicht einbekennte. Eben darauf beruht der wesentliche Unterschied zwischen endlichem Verstand und spekulativer Vernunft. Mit anderen Worten: das erkenntnistheoretische Induktionsproblem. Dessen Witz ist, dass es nicht als unlösbar erkannt werden könnte, wenn es im Bewusstsein nicht schon gelöst wäre. Denn ein Bewusstsein, das sich innerhalb des Prozesses der Unlösbarkeit des unabschließbaren iterativen Verfahrens bewegt, wird nie zu dem Allgemeinbegriff kommen, der doch vorausgesetzt ist, um ihm nachzuweisen, dass er auf empirischem Wege nicht zu gewinnen ist. Damit stellt sich aber das spekulative Bewusstsein beruhigend auf die Seite der Gewissheit des spekulativen Begriffs als der wahren Wirklichkeit – wie modellhaft in der platonischen Ideenlehre. Dieser idealistischen Gewissheit widerspricht Kleists Kunst. Der Sinn, so klar er für sich strahlen kann: emphatische gegenseitige Liebe auf den ersten Blick, so bleibt er doch an das Material ausgeliefert und es ist am Ende sehr fraglich, ob von dieser profunden Liebe in der geschlossenen Ehe noch ein Funken übrig bleibt, aus dem auf ihn geschlossen werden kann. Was allein diesen am Material abstürzenden Sinn tragen kann, sind die dramatische Form, die Konstellation der Motive und Charaktere, der Stil. Darum erschließt er sich auch erst in der Synthesis des Ganzen, in der das Stürzende getragen ist wie in der Gewölbebogenkonstruktion.
Genauere Betrachtung verdient nun im Zusammenhang des Erhabenen das Motiv der Gewalt bei Kleist, das gerade in letzter Zeit oft hervorgehoben wird und besonders auffällig ist. Es wird vielleicht erst plastisch vermöge des sachlich richtigen Gegenarguments, dass die von Kleist geschilderten Gewalt- und Grausamkeiten im Vergleich mit etwa denen in antiken Werken gar nicht aus dem Rahmen fallen. Der besondere Eindruck, den sie machen, kann also nicht auf der Tat allein beruhen. Hervorgerufen wird er durch den bei Kleist jeweils herausgearbeiteten Kontrast, der unterschiedliche Formen annehmen kann. Genannt sei zunächst Gewalt als Ausdruck der radikalen Unangemessenheit der Realität an das gewünschte und im Kontext des Weltzustandes wünschbare Ziel (so in der Penthesilea oder am Schluss im Kohlhaas oder im Findling). Unter diesem Aspekt gewinnt Gewalt bei Kleist den Charakter der Demonstration oder Manifestation und ist mit den bestehenden Verhältnissen radikal unversöhnlich. Der Bruch wird festgehalten. Der maßlose und zweckwidrige Ausbruch der Gewalt ist negativer Ausdruck der Maßlosigkeit des Zwecks, seiner Richtung auf das Unermessliche (Goethe245), darum ebenso gräulich wie verständlich. Daraus ergibt sich der das Erhabene ausmachende Gegensatz von Abstoßung und Anziehung. Dabei schafft der Scheincharakter des Weltzustandes oder der jeweiligen Lebenssituation eine glückverheißende, versöhnliche Tendenz, die den Kontrast zur Gewalttat besonders betont. (Vgl. dazu u. a. meine Analyse der Szene der Vertreibung Herses von der Tronkenburg im Kapitel B 05). Gewalt ist bei Kleist auf der Grundlage dieses in der Blindheit seiner rationalen Aufgeklärtheit ambivalenten Weltzustandes nicht einfach Naturgewalt, Mythos, Vorwelt, sondern gesellschaftlich rational aufgeheizte, strukturelle Gewalt und als negativer Ausdruck des Vernunftziels gestaltete Gegengewalt. Die Erstere wird klar schon exponiert in Kleists Erstlingswerk, der Familie Schroffenstein, zeigt sich aber ebenso am Verhalten der Untergebenen in der Passscheinszene (II, 10 f.) auf der Tronkenburg und ist eben in Kleists Werk ständig latent.
Das Problem der Darstellung von Gewalt bei Kleist zu klären ist also nicht so einfach, weil Gewalt bei Kleist in diesen zwei wesentlichen Formen vorkommt: a) strukturelle Gewalt und b) Gegengewalt als Ausdruck. Dabei wäre es nun eine unzulässige Verkürzung der Variationenvielfalt bei Kleist, wollte man deren Verhältnis auf die einfache Formel ihres Gegensatzes bringen. Denn z. B. im Findling und in der Verlobung ist das, was man als Gegengewalt bezeichnen müsste, nicht oder nur indirekt und in verwirrter Weise auf ein Vernunftziel gerichtet: Ausdruck sind die Taten einzig als gewaltsamer oder schurkischer radikaler Ausbruch aus einer kompromisslerisch verlogenen oder undurchdringlich verstrickten Welt, an deren fataler Abgestimmtheit es nichts zu verbessern gibt, sondern aus der nur verzweifelte Ausbrüche möglich sind. Dieses Moment von Ohnmacht eignet aber bei Kleist aller Gegengewalt. Als gegenüber den zivilisierten Erwartungen zweckwidriger Ausbruch verweisen sie auf das die schlechte Kontinuität von Herrschaft brechende Ende von Geschichte als ihren Anfang.