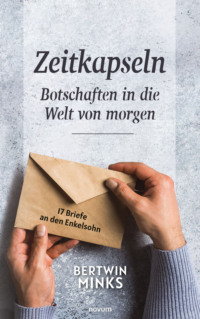Kitabı oku: «Zeitkapseln - Botschaften in die Welt von morgen», sayfa 5
Na schauen wir mal, wie die Leute in 17 Jahren mit dem Thema des anthropogen verursachten Klimawandels umgehen werden. Ich für meinen Teil hoffe, dass du kein Sympathisant der „Fridays for future“-Bewegung geworden sein wirst. Streikende und damit die Schule schwänzende Schüler können mit plakativen Bekundungen und naiven Parolen das Weltklima nämlich ganz und gar nicht retten. Mit der Verweigerung des Schulbesuchs gefährden sie dagegen ihre eigene Zukunft. Dazu kommt, dass viele junge Leute die komplexen klimatischen Wirkungszusammenhänge und die Diskussion um die von Menschen verursachte Erderwärmung gar nicht sachgerecht beurteilen können. Das hält die Klimaaktivisten jedoch nicht davon ab, die Schülerbewegung für ihre Ziele zu benutzen und sie für ihre Ideologie zu instrumentalisieren.
Mein Junge, ich bin mir ziemlich sicher, dass in 17 Jahren weder eine Temperatur-Apokalypse über die Menschen gekommen sein wird noch ganze Inselketten im Meer versunken sein werden. Darüber hinaus dürfte auch kein Massensterben aufgrund einer „Klimakatastrophe“ stattgefunden haben. Zu diesem Zeitpunkt wird die Erde für das vernunftbegabte Leben vermutlich immer noch eine weitgehend attraktive Heimstatt sein. Mein Optimismus mag erstaunlich anmuten, denn dann werden fast 10 Milliarden Menschen den Planeten bevölkern und seine Biosphäre im Übermaß belasten. Diese dramatische demografische Situation stellt nämlich die wirkliche Katastrophe für die Zukunft unserer Gattung auf der Erde dar.
Bei der Diskussion über die Klimaerwärmung wird offenbar auch außer Acht gelassen, dass die drastische Zunahme der Weltbevölkerung selbst ein beachtlicher Klimaeinflussfaktor ist. Scharfsinnige Köpfe haben ausgerechnet, dass ein Mensch allein durch seine bloße Anwesenheit auf dem Planeten etwa 80–100 Tonnen CO2 jährlich in die Atmosphäre emittiert. Diese immense Treibhausgas-Emission kann zwar besteuert, aber nicht eingespart werden, denn Menschen lassen sich nicht substituieren. Dazu kommen noch die Emissionen all dieser zukünftigen Erdenbewohner, denn die Leute wollen natürlich annehmlich leben, preiswert mobil sein und nicht in ungeheizten Höhlen wohnen.
In Anbetracht der sich zuspitzenden demografischen Entwicklung scheint daher das Erreichen der Klimaziele im Jahr 2100 durch die Reduzierung anthropogener CO2-Emissionen eine fragliche Angelegenheit zu sein. Doch wer weiß, ob das dann noch bei 16 Milliarden Menschen auf der Erde die Gemüter erregen wird?
Viele der sogenannten „Klimaschützer“ mögen Leute mit aufrichtigen Befürchtungen, ehrlichen Überzeugungen und lobenswerten Absichten sein. Doch sie scheinen nicht zu erkennen oder auch begreifen zu wollen, dass die anthropogen verursachte Klimaerwärmung vor allem eine Folge der dramatischen Bevölkerungsexplosion auf unserem Planeten ist. Ihr Kampf gegen die Mühlen der von Menschen gemachten Klimaerwärmung gleicht insofern einer Don Quichotterie, weil sich das Grundübel nicht mit „umweltkosmetischen“ Methoden wie der alleinigen Begrenzung von CO2-Emissionen beseitigen lässt.
Außerdem bin ich überzeugt, dass das für die Pflanzen so wertvolle und einseitig als schädliches Treibhausgas verunglimpfte Kohlendioxid eines Tages seine politisch gewollte „Buhmann-Rolle“ in der Klima- und Energiepolitik verlieren wird. Engagierte „Klimaschützer“ sollten sich außerdem bewusst sein, dass für viele Menschen vor allem die Bekämpfung von Armut, Hunger, Krankheiten und gesellschaftlicher Unterdrückung wichtiger ist. Zumindest diese Leute dürften ihre Existenz und Zukunft nicht vordergründig durch zu hohe CO2-Emissionen bedroht sehen. Wer weiß, vielleicht werden die Menschen auch noch ganz andere Krisensituationen meistern müssen, von denen sie heute noch keine Ahnung haben?
Matti, das kleine Klimaflugblatt soll dir die Komplexität und Vielfalt der globalen Klimaproblematik vor Augen führen. Man darf nicht vergessen, dass amtliche Wetteraufzeichnungen erst seit etwa 140 Jahren existieren. Was aber mag sich davor in den 12.000 Jahren nach dem Ende der letzten Eiszeit an Wetterkapriolen und Klimaveränderungen ereignet haben? Freilich ist auch diese Zeitspanne nur ein kleiner Ausschnitt aus der langen Klimageschichte unseres Planeten, die seit dem Proterozoikum in einem ständigen Wandel begriffen ist.
Oh, mein Junge, entschuldige, in der Hitze der Debatte hätte ich fast vergessen, dir ganz liebe Glückwünsche zum 20. Geburtstag zu übermitteln. Ich gestehe, dass mich meine Vergesslichkeit ein bisschen verunsichert, denn ich bin mir nicht sicher, ob dieser peinliche Lapsus einer an sich noch unbedenklichen altersbedingten Wunderlichkeit zuzurechnen ist. Na ja, was solls, schauen wir mal, wie sich die Dinge mit Opas Zerstreutheit weiterentwickeln mögen. Ich wünsch dir neben Gesundheit und Glück im Leben auch einen allzeit klaren Verstand, damit du Unwahrheiten, Lügen und die vielfältigen, komplizierten und manchmal auch versteckten Wahrheiten in deiner Lebenswirklichkeit erkennen kannst.
Nach den statistischen Erhebungen zur Lebenserwartung männlicher Personen, die um die Mitte des vorigen Jahrhunderts geboren worden sind, werde ich an deiner Geburtstagsfeier bestimmt nicht mehr teilnehmen können. Es sei denn, ich finde wider Erwarten eine Zeitmaschine, die mich an den Zeitpunkt und den Ort deiner Feier in der Zukunft transportieren könnte. Da das für mich ein ziemlich unwahrscheinlicher Glücksfall sein dürfte, möchte ich dich vorsorglich schon heute aus der Vergangenheit ganz herzlich drücken und grüßen,
dein dir liebevoll zugetaner Großvater!
Anlage
Kleines Klimaflugblatt
Kleines Klimaflugblatt
1. Das globale Klima – Mythos, Phänomen und Klimaschutz
Nachdem zum Ende des Archaikums vor ca. 3 bis 2,5 Milliarden Jahren die Oberflächentemperatur der Erde die 100 °C-Grenze unterschritten hatte, konnte sich auf dem Planeten ein geophysikalisches Phänomen entwickeln, das die Menschen später „Klima“ genannt haben. Das globale Klima entstand und entsteht durch das komplexe Zusammenwirken zeitlich varianter geologischer, geochemischer, geophysikalischer und astronomischer Vorgänge, die mit der Biosphäre des Planeten wechselwirken und mannigfaltige Rückkopplungseffekte erzeugen. Insofern muss das Weltklima seit Anbeginn als eine pure Variable begriffen werden. Das Phänomen des Klimawandels stellt daher keine Entdeckung der Menschen dar, sondern er ist seit etwa drei Milliarden Jahren auf der Oberfläche der Erde eine planetare Realität!
Mit Beginn des industriellen Zeitalters scheint sich nun auch der Mensch anzuschicken, das Weltklima zu beeinflussen. Doch was ist daran als Dichtung abzutun und was sollte als Wahrheit begriffen werden? Unbestritten scheint nur eine Tatsache zu sein: Das globale Klima hat sich seit Hunderten von Millionen Jahren stets und ständig verändert und gewandelt. Insofern haben Vorstellungen von Leuten, die den Klimawandel am liebsten abschaffen möchten, etwas Irrationales und zugleich Lächerliches an sich.
Der Begriff „Klimaschutz“ resultiert aus dem gleichen falschen Denkansatz und stellt eine unglückliche Wortschöpfung dar. Eine so komplexe geophysikalische Größe wie das Weltklima ist in Raum und Zeit in keiner Weise fixiert und verändert sich ohne das Zutun des Menschen seit seiner Entstehung permanent. Ähnlich wie das Wetter ist auch die klimatische Entwicklung für längere Zeiträume nicht exakt vorhersagbar. Niemand vermag eine Wunschvariante der klimatischen Situation festzuhalten oder festzuzurren. Wäre das möglich, müsste man die Frage stellen, welches Klima in welchem raumzeitlichen Intervall denn geschützt und bewahrt werden soll? Das Klima von vor 15.000 Jahren wird es wegen der damaligen eiszeitlichen Bedingungen wohl nicht sein. Doch ist es das vor 1000 oder 500 Jahren oder das gestrige? Vielleicht erscheint auch das „heutige“ oder selbst noch das „morgige“ Klima erhaltens- und schützenswert? Nein, eine pure Variable kann man nicht wie ein kostbares Gut erhalten oder bewahren. Sie lässt sich allenfalls in ihrer naturgegebenen Variabilität im Trend beeinflussen. In welcher Weise das geschehen sollte oder auch nicht, hängt von der Perspektive im Auge des jeweiligen Betrachters ab. Insofern bestehen zum klassischen Schutzgut „Umwelt“, das bei allem Wandel in seiner substanziellen Vielfalt erhalten werden soll, schon ein paar Unterschiede.
Die Menschen sind auf jeden Fall gut beraten, wenn sie sich im globalen Maßstab einigermaßen klimaneutral verhalten, damit die natürlichen Klimaprozesse weitgehend unbeeinflusst bleiben und nicht durch menschliche Aktivitäten aus den Fugen geraten. Ob dieser Grundsatz auch dann noch gilt, wenn die Dynamik des natürlichen globalen Klimawandels in Skalen und Bereiche abgleitet, die sich für das vernunftbegabte Leben als nachteilig erweisen, mag zunächst dahinstehen. In so einem geophysikalisch gar nicht so unwahrscheinlichen Fall (z. B. weltweite Abkühlung) könnten sich gegensteuernde anthropogene Aktivitäten möglicherweise auch als sinnvoll erweisen. Doch solche Vorstellungen mögen den meisten Menschen gegenwärtig wohl abwegig vorkommen oder zumindest gewöhnungsbedürftig erscheinen.
2. Simulationen, Prognosen und die Chaostheorie
Simulationen von dynamischen Prozessen sind ein wissenschaftlich anerkanntes und legitimes Hilfsmittel, um Aussagen über Zeiträume zu erhalten, die dem Experiment nicht direkt zugänglich sind. Sie erweisen sich beispielsweise für die Vorhersage astrophysikalischer Entwicklungen als unverzichtbar. Aber bei dieser wissenschaftlichen Praxis ist Vorsicht geboten. Eine Simulation kann nur dann realistische und belastbare Ergebnisse liefern, wenn die maßgeblichen Input-Parameter möglichst vollständig bekannt sind und wissenschaftlich seriös ermittelt wurden. Sonst können Simulationen in der Tat in die Nähe banaler Computerspiele geraten.
Bei Klimaprognosen besteht die Schwierigkeit, die relevanten Wirkungsfaktoren angemessen zu berücksichtigen. Der Aspekt erweist sich als problematisch, weil deren Dynamik und Schwankungen nicht in jedem Fall ausreichend bekannt sind. Die von Klimaforschern in Computer-Simulationen ermittelten Temperatur-Prognosen bedürfen daher der Bestätigung durch experimentelle Daten. Insofern kann der Beweis für eine Temperaturprognose, die das Jahr 2100 betrifft, erst in 70 bis 80 Jahren erbracht werden. Solange eine derartige Validierung nicht erfolgt ist, sind die Prognosen derjenigen Klimaforscher, die sich als „Klima-Antiskeptizisten“ oder „Klima-Optimisten“ verstehen, als Hypothesen zu betrachten. Deren Simulationsergebnisse müssen daher wissenschaftlich hinterfragt werden dürfen und bis zu ihrer experimentellen Bestätigung diskutabel bleiben. Auf keinen Fall sollten experimentell nicht bestätigte Annahmen bildungsferneren Leuten bereits als zu erwartende Gewissheiten weisgemacht werden.
In diesem Zusammenhang scheint auch ein Blick auf die Aussagen der Chaostheorie zweckmäßig zu sein. Das Wort Chaos bedeutet nicht, dass nichtlineare dynamische Systeme die Gesetze der Physik ignorieren. Doch in solchen deterministischen Systemen können kleinste Abweichungen bei den Anfangsparametern eine Vorhersage unmöglich machen. Man denke nur an den berühmten Flügelschlag eines einzelnen Schmetterlings im Amazonasbecken, der nach den Überzeugungen des Meteorologen Edward Lorenz das Wetter in Texas beeinflussen kann. Ein weiteres prominentes Beispiel für die Unvorhersagbarkeit von Ereignissen stammt aus der Astronomie. Tausende Simulationen zur Stabilität der Merkur-Bahn mit einer (step by step) Verschiebung der Ausgangslage von nur jeweils einem Meter haben ergeben, dass prospektive Aussagen zur Dynamik der Bahnparameter des Planeten nach nur zwei Millionen Jahren unmöglich werden.
Die zahlreichen nichtlinearen Prozesse, die das Klima entstehen lassen, können in ihrem komplexen Zusammenspiel sowie den vielfältigen Rückkopplungen und Überlagerungen in ihrer Gesamtheit mathematisch nicht vollständig modelliert werden. Darüber hinaus wird die Dynamik einiger relevanter Einflussfaktoren nach wie vor nicht ausreichend verstanden. Daher ist die Frage, ob und in welchem Ausmaß anthropogene Aktivitäten das globale Klima maßgeblich und nachhaltig verändern können, auf Anhieb ganz und gar nicht einfach zu beantworten.
2.1 Sonnenaktivität und Solarkonstante
Die Sonne muss als Motor jeglichen irdischen Lebens betrachtet werden. Sie stellt den bedeutsamsten Faktor für das globale Klima dar. Die sogenannte Solarkonstante S0, die eigentlich ein Parameter ist, bezeichnet ein Maß für die auf der Erde eintreffende solare Strahlung. Die Größe S0=1367 W/m2 unterliegt im Rahmen der Sonnenaktivität Schwankungen (ca. 0,1 %) und einer Dynamik, die vom Alter der Sonne als Hauptreihenstern bestimmt wird. Die junge Sonne hatte eine Leuchtkraft, die etwa 70 % des heutigen Wertes betrug. Sie nimmt alle 100 Millionen Jahre etwa 1 % zu. Die geringere Strahlungsleistung unseres Sterns war vermutlich dafür verantwortlich, dass der Planet Erde am Ausgang des Proterozoikums vor ca. 800 bis 600 Millionen Jahren mindestens zwei kapitale Eiszeiten erlebt hat. Dabei sollen nach dem Modell „Schneeball Erde“ die Ozeane selbst am Äquator mit einem bis zu 2 Kilometern mächtigen Eispanzer bedeckt gewesen sein.
Die „Solarkonstante“ hat aber auch in historischen Zeiten Schwankungen aufgewiesen. So zeigte die Sonne beispielsweise von 1645 bis 1715 in einem anhaltenden Sonnenflecken-Minimum eine verringerte Aktivität. Die klimatischen Folgen des sogenannten Maunder-Minimums der Sonnenaktivität haben in Verbindung mit Vulkanausbrüchen in Europa zu einer Klimaepoche geführt, die als kleine Eiszeit bezeichnet wird. In dieser Zeitspanne, die etwa vom 16. bis zum 19. Jahrhundert datiert wird, war die globale Oberflächentemperatur auf der Erde etwa 1 °C niedriger als heute.
In der jüngeren Klimageschichte sind weitere Sonnenfleckenminima bekannt, die trotz leicht angestiegener atmosphärischer CO2-Konzentrationen zu deutlichen Abkühlungen geführt haben. Das betrifft die Phase des Früh-Mittelalterminimums (640-710 u. Z.), das Spörer-Minimum (1460-1540 u. Z.) und das Dalton-Minimum (1795-1820). Aus einer stark erhöhten Sonnenaktivität resultierte dagegen die spätmittelalterliche Erwärmungsphase von 1140 bis 1340 u. Z., als die Insel Grönland als ein grünes Eiland verstärkt besiedelt wurde.
Die Aktivität unseres Sterns manifestiert sich auf der Sonnenoberfläche optisch durch die Anzahl der Sonnenflecken. Man kennt einen elfjährigen Zyklus, der die Zeitspanne einer ruhigen Sonne (Sonnenflecken arme Zeit) und die Phase einer aktiven Sonne (viele Sonnenflecken) umfasst. Längerfristige Perioden sind diskutiert worden, konnten bisher aber statistisch und wissenschaftlich nicht belegt werden. Während des Sonnenflecken-Zyklus kehrt sich das Magnetfeld der Sonne um. Die Ursachen für diesen physikalischen Vorgang sind nicht wirklich bekannt. Weitere naturwissenschaftliche Defizite betreffen die Erklärungen der Schwankungen im solaren Spektrum im Bereich einer  -Strahlungsfrequenz bei 1024 Hz und lokale Differenzierungen auf der gesamten Sonnenoberfläche. Obwohl ein Standardmodell der Sonne existiert, das vor allem die Neutrino-Erzeugung der Fusionsprozesse zu erklären versucht, werden die komplizierten plasmaphysikalischen Vorgänge in unserem Zentralgestirn von der Wissenschaft keineswegs ausreichend verstanden. Daher sind verlässliche Aussagen zur Entwicklung der Sonnenaktivität oder detaillierte Vorhersagen zur Dynamik der „Solarkonstante“, die eigentlich als eine Variable begriffen werden muss, bisher wohl nicht möglich!
-Strahlungsfrequenz bei 1024 Hz und lokale Differenzierungen auf der gesamten Sonnenoberfläche. Obwohl ein Standardmodell der Sonne existiert, das vor allem die Neutrino-Erzeugung der Fusionsprozesse zu erklären versucht, werden die komplizierten plasmaphysikalischen Vorgänge in unserem Zentralgestirn von der Wissenschaft keineswegs ausreichend verstanden. Daher sind verlässliche Aussagen zur Entwicklung der Sonnenaktivität oder detaillierte Vorhersagen zur Dynamik der „Solarkonstante“, die eigentlich als eine Variable begriffen werden muss, bisher wohl nicht möglich!
Allerdings sagen magnetohydrodynamische Modelle voraus, dass das für 2023–2026 zu erwartende Sonnenfleckenmaximum des aktuellen 25. Sonnenzyklus ausfallen könnte. Länger- oder mittelfristig prognostizieren diese Modelle sogar eine deutlich verringerte Aktivität unseres Sterns ähnlich wie im Maunder-Minimum des 17. Jahrhunderts. Insofern könnte eine gewisse globale Abkühlung in naher Zukunft auch wieder eine klimatologische Option sein!
2.2 Treibhauseffekt durch klimawirksame Gase
Der Treibhauseffekt wird durch Gase verursacht, die die Strahlungswärme der Energiequelle Sonne auf die Oberfläche des Planeten gelangen lassen, aber gleichzeitig verhindern, dass die Wärme wieder in den umgebenden Weltraum abgegeben wird. Als atmosphärisch relevante Gase für diesen physikalischen Mechanismus werden vor allem Fluor-Kohlenwasserstoffe, schweflige und nitrose Gase sowie Methan verantwortlich gemacht. Ob auch das Gas CO2 zu den Treibhausgasen gehört, war lange Zeit keineswegs schlüssig erwiesen. Es gab zwar zahlreiche Laborergebnisse, die die Klimawirksamkeit von Kohlendioxid belegt haben. Dennoch existiert bis heute nur eine einzige Feldstudie, die einen Zusammenhang zwischen einer erhöhten CO2-Konzentration und einer lokalen Klimaerwärmung nahelegt. Darüber hinaus ist nach wie vor umstritten, in welchem Ausmaß Kohlendioxid das Klima beeinflusst. Die Theorie von der ausschließlich CO2-basierten Klimaerwärmung wird nämlich durch eine Reihe von paläoklimatischen Befunden infrage gestellt.
In der Erdgeschichte gab es in den letzten 540 Millionen Jahren seit der kambrischen Radiation nachweislich (wie Bohrkerne belegen) mehrfach Phasen mit einer erhöhten CO2-Konzentration und niedrigen Temperaturen sowie niedrigen atmosphärischen CO2-Werten und erhöhten Temperaturen. Als Beleg dafür werden nachfolgend einige Beispiele angeführt, die diesen Sachverhalt zu bestätigen scheinen:
Die globale Temperaturgeschichte der Erde ist seit dem Ende des Präkambriums vor ca. 541 Millionen Jahren mit der atmosphärischen CO2-Konzentration nur teilweise, manchmal aber auch überhaupt nicht korreliert gewesen. Im Paläozoikum erreichte der CO2-Gehalt der Atmosphäre mehrfach Werte von 4.000 bis 6.000 ppm. Heute liegt die Kohlenstoffdioxidkonzentration in der Atmosphäre mit 400 ppm eigentlich nahe am erdgeschichtlich bekannten Minimum.
Der Temperaturanstieg am Ende des Paläozäns und dem Beginn des Eozäns (PET-Maximum vor etwa 57 Millionen Jahren) wird auf 5 bis 6 Kelvin (K) beziffert. Die Zunahme der atmosphärischen CO2-Konzentration kann nach den paläoklimatischen Befunden jedoch nur einen globalen Temperaturunterschied von 1 bis 3 K erklären.
In der gegenwärtigen Warmzeit, dem Holozän, ist das Maximum der Temperatur bereits vor etwa 8 000 Jahren aufgetreten. Seitdem hat es bis heute einen Abwärtstrend der Temperatur von 1,5 °C gegeben. Im gleichen Zeitraum ist aber der CO2-Gehalt der Atmosphäre von 260 auf etwa 400 ppm angestiegen.
Die Rekonstruktion der Warm- und Kaltzeiten im Holozän seit dem Ende der letzten Eiszeit vor 12.000 Jahren zeigt ein Auf und Ab der Temperaturen, die nicht mit Schwankungen der atmosphärischen CO2-Konzentration korreliert sind. Ein prominentes Beispiel dafür ist das Zustandekommen der kleinen Eiszeit vom 16. bis zum 19. Jahrhundert, das sich nicht allein auf Vulkanausbrüche zurückführen lässt.
Physikalisch gesichert ist, dass ein weltweiter Temperaturanstieg zur Ausgasung von CO2 aus den Ozeanen führt. Eine globale Abkühlung verursacht dagegen einen Rückgang der CO2-Konzentration in der Atmosphäre, da das Wasser der Ozeane dann in der Lage ist, mehr CO2 zu speichern. Die paläoklimatischen Befunde lassen aber insgesamt Zweifel daran aufkommen, dass das globale Klima in der Vergangenheit von nur einem einzigen klimawirksamen Parameter maßgeblich gesteuert und beeinflusst worden sein soll!
2.2.1 Natürliche Ursachen des Treibhauseffektes
Auf dem Planeten Erde sind etwa 1.500–2.000 tätige kontinentale Vulkane bekannt. Dazu kommt ein noch viel größere, doch weitgehend unbekannte Anzahl submariner Vulkane. Dabei handelt es sich um Feuerberge, die in den letzten 10.000 Jahren mindestens einmal ausgebrochen sind. Ungefähr 40 bis 50 davon zeigen tägliche Aktivitäten, bei denen Staub, Kohlendioxid und andere Treibhausgase (vor allem schweflige und nitrose Gase) in die Atmosphäre emittiert werden. Dazu kommen Emissionen von klimawirksamen Gasen (hier vor allem Methan) bei Erd- und Seebeben. Physikalischen Abschätzungen zufolge sollen die Mengen an Kohlendioxid, die dabei in die Atmosphäre gelangen, für die Beeinflussung des Weltklimas vernachlässigbar sein. Sie werden auf etwa zwei Größenordnungen unter der Menge des anthropogen verursachten Anteils beziffert. Doch wer weiß, ob dieses Schätz-Ergebnis wissenschaftlich belastbar ist? Immerhin unterliegen vulkanische Aktivitäten mehr oder weniger starken Schwankungen. Außerdem dürfte die Erfassung der Aktivität submariner Quellen unvollständig sein. Darüber hinaus mag dahinstehen, ob die Klimarelevanz der bei Eruptionen freigesetzten Stäube und schwefligen Gase zu vernachlässigen ist.
Immerhin sind nach dem Ausbruch des Pinatobu (Philippinen 1991) die globalen Temperaturen vorübergehend um 1,5 °C gesunken. Nach dem Ausbruch des Tambora (Indonesien 1815) sollen es, Berechnungen zufolge, sogar 2,5 °C gewesen sein. Aufgrund der Zufälligkeit und Variabilität des Ausmaßes solcher geophysikalischen Ereignisse und ihrer unvollständigen Erfassung ist zu vermuten, dass sich deren Einfluss auf den irdischen Treibhauseffekt langfristig nicht zuverlässig einschätzen lässt und daher von den anthropogen verursachten Beiträgen auch nicht sicher abzugrenzen ist.
Ein anderes Szenario ergibt sich, wenn sogenannte Supervulkane ausbrechen oder supermassive effusive Ereignisse stattfinden. Die dabei freigesetzten Energien übersteigen diejenigen von „normalen“ Eruptionen um ein Vielfaches. Auf der Erde sind immerhin 20 bis 30 Vulkane mit einem Vulkanexplosionsindex (VEL) größer 7 (Supervulkane) bekannt, deren Ausbruchshäufigkeit zwischen 5.000 und 48.000 Jahren liegen soll. Die letzte Eruption eines solchen Vulkans hat vor 26.000 Jahren in Neuseeland stattgefunden. Die supermassiven effusiven Ereignisse, die beispielsweise die sibirischen oder die Dekkan-Traps in Indien geschaffen haben, liegen dagegen schon viele Millionen Jahre zurück. Das mag, was die Zeitspannen anbelangt, nicht besonders beunruhigend klingen. Die Menschen sollten sich jedoch bewusst sein, dass solche Ereignisse einschneidende Folgen für die jeweilige regionale Biosphäre und das globale Klima haben. Bei solchen verheerenden Ereignissen, können daher am Computer simulierte Klima-Prognosen schlichtweg hinfällig werden.
2.2.2 Anthropogene Quellen von Treibhausgasen
Der von den Menschen verursachte Eintrag von klimawirksamen Gasen in die Atmosphäre ist vielfältig, unbestritten und nimmt ständig zu. Das ist bei einer dramatisch wachsenden Weltbevölkerung und ihren zunehmenden ubiquitären Bedürfnissen aber auch zu erwarten. Die Hauptquellen betreffen die Energieerzeugung (ca. 40 %). Dabei handelt es sich vor allem um Kraftwerke, die fossile Energieträger (z. B. Kohle, Öl, Gas) verbrennen.
Ein weiterer relevanter Emittent ist der weltweite Land-, Wasser- und Luftverkehr, der auf der Nutzung von Kohlenwasserstoffen und ihren Produkten beruht. Aber auch gewerbliche Bereiche sowie Industrie und Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft sind nicht zu vernachlässigende Emittenten von Treibhausgasen. Darüber hinaus müssen in diesem Zusammenhang auch urbane CO2-Quellen, die auf der Nutzung von Kohle, Öl oder Gas basieren (z. B. Heizungen, Verbrauchseinrichtungen) erwähnt werden. Die im globalen Maßstab anthropogen erzeugten Treibhausgase lassen sich mengenmäßig einigermaßen zuverlässig abschätzen. Doch die Beurteilung, in welchem Verhältnis die anthropogenen Emissionen zu dem Eintrag natürlicher Quellen in die Atmosphäre stehen, bleibt aufgrund von deren unvollständiger Erfassung, stochastischer Aktivitäten und erheblicher Intensitätsschwankungen unsicher und prinzipiell problematisch!
2.3 Geotektonische Prozesse
Die Plattentektonik mit der Spreizung ozeanischer Böden in den mittelozeanischen Rücken und deren Subduktion in Tiefseegräben sowie der Auffaltung von Gebirgen in Kollisionszonen kontinentaler Platten hat das globale Klima in allen Erdzeitaltern entscheidend gestaltet und geprägt. Die geotektonischen Prozesse scheinen einem Muster zu folgen, das der Wilson-Zyklus beschreibt. Danach werden Superkontinente zerfallen und sich dann erneut zu einer großen Landmasse vereinigen. In den vergangenen Erdzeitaltern vom Präkambrium bis zum Perm sollen sich mindestens drei solcher Superkontinente gebildet haben, die später wieder in einzelne Kontinentalplatten zerbrochen sind:
Rodinia vor ca. 1,1 bis 0,8 Milliarden Jahren
Pannotia vor ca. 650 bis 550 Millionen Jahren
Pangaea vor ca. 300 bis 250 Millionen Jahren
Die plattentektonischen Prozesse des Wilson-Zyklus wirken auch in der Zukunft fort. So soll in etwa 150 bis 200 Millionen Jahren wieder ein Superkontinent entstehen, dem die Menschen bereits den Namen Amasio gegeben haben.
Die Drift der Kontinente hat zwar einen maßgeblichen und langfristigen Einfluss auf die Klimageschichte des Planeten, da die Verteilung von Landmassen und die Struktur der Meere mit ihren transozeanischen Strömungen auf der Erdoberfläche völlig umgestaltet werden. Diese geotektonischen Prozesse erstrecken sich jedoch über einen Zeitraum, der sich nach Millionen von Jahren bemisst. Für retrospektive Klimaanalysen oder prospektive Aussagen, die nur wenige Jahrhunderte oder Jahrtausende umfassen, spielt der Einfluss dieser geophysikalischen Prozesse daher praktisch keine Rolle.
2.4 Transozeanische Strömungen
Transozeanische Strömungen und damit verbundene Phänomene Grundsätzlich werden diese unsichtbaren Straßen im Meer langfristig von der Plattentektonik geformt, verändert und meistens radikal umgestaltet. Doch diese Strömungen unterliegen auch kurzzeitigen Veränderungen. Wenn sich beispielsweise der Wärmehaushalt der Ozeane durch Vereisungs- und Abschmelzungsvorgänge oder anderweitige Abkühlungen und Erwärmungen ändert, werden Dichteschwankungen im Salzwasser erzeugt, die die Tiefenwasser-Zirkulation beeinflussen. Dieser Effekt kann sich auf den Verlauf, die Temperatur und die Intensität von Meeresströmungen auswirken. Demzufolge können beispielsweise der Golfstrom, der Humboldtstrom, die äquatorialen Ströme und deren Gegenströme auch in überschaubaren Zeiträumen das globale Klima unter Umständen sogar drastisch (z. B. Erlahmen des Golfstroms) beeinflussen.
Die Veränderung der Temperaturprofile, der Intensität und der Geschwindigkeit transozeanischer Strömungen gehen mit Phänomenen wie El Nino, La Nina oder der (ozeanischen) positiven oder negativen transatlantischen Oszillation einher. Obwohl diese Phänomene lokal auftreten und zeitlich begrenzt sind, können sie in ihrer Gesamtheit die Komplexität und Periodizität des globalen Klimas auch relativ kurzfristig und länger andauernd beeinflussen.
2.5 Astronomische Ursachen
Himmelsmechanische Prozesse verändern die auf der Erde eintreffende Sonneneinstrahlung über die jährlichen Schwankungen hinaus und führen zu einer langperiodischen Variation des Solarparameters. Die zeitvarianten Muster der Veränderungen resultieren aus drei sich überlagernden Änderungen der Parameter von Erdbahn und Erdachse. Dabei handelt es sich um folgende astronomische Effekte:
eine Präzession der Erdrotationsachse (Zyklus 28.000 Jahre) und eine Präzession der Perihel-Drehung der Erdbahn (Zyklus 112.000 Jahre)
eine Variation der Ekliptik-Schiefe (Zyklus 41.000 Jahre)
eine Änderung der Exzentrizität der Bahn-Ellipse (Zyklus ca. 100.000 Jahre)
Dazu kommt eine erweiterte Modifikation, die auch die periodische Kippung der Ekliptik im Vergleich zur Sonne-Jupiter-Bahnebene (Zyklus ca. 400.000 Jahre) berücksichtigt. Die von dem serbischen Mathematiker Milankovic berechneten Zyklen (einschließlich der erweiterten Modifikation) können die Abfolge der Warm- und Kaltzeiten während der letzten 700.000 Jahre im Pleistozän relativ gut abbilden. Darüber hinaus wird den Milankovic-Zyklen auch für weiter zurückliegende klimatische Ereignisse im Karbon, Perm und der Trias ein signifikanter Einfluss zugeschrieben.
Diese himmelsmechanischen Zyklen wirken natürlich auch in der Zukunft fort. Ihre Zeitskala umfasst Jahrzehntausende bis hin zu einigen Hunderttausend Jahren. Wie ausgeprägt und in welchen Zeiträumen die Milankovic-Zyklen das globale Klima wirksam beeinflussen können, hängt allerdings von der Überlagerung mit anderen klimawirksamen Faktoren ab.
Das globale Klima kann auch durch andere astronomische Ereignisse massiv und nicht vorhersagbar beeinflusst werden. Einschläge von größeren Asteroiden oder Kometen haben in der Erdgeschichte mehrfach Spuren hinterlassen. Durch solche Katastrophen-Szenarien wird auch das globale Klima einschneidend verändert. Impakte sind als Zufallsereignisse nicht berechenbar oder vorhersagbar, doch sie können die Klimaentwicklung des Planeten praktisch jederzeit erheblich und für lange Zeiträume umgestalten.
2.6 Kosmische Strahlung
Bei der kosmischen Strahlung handelt es sich um eine hochenergetische Teilchenstrahlung, die von der Sonne, der Milchstraße und aus anderen Galaxien stammt. Sie besteht vor allem aus Protonen (87 %), Alpha-Teilchen (12 %) und sonstigen schwereren vollständig ionisierten Atomkernen. Seit etwa 50 Jahren wird ein Zusammenhang zwischen der kosmischen Strahlung und einer Bildung von Wolken diskutiert. Damit könnte der Intensität der kosmischen Strahlung auch ein Einfluss auf das globale Klima in Form eines abkühlenden Effektes zugeschrieben werden.
Das Erdmagnetfeld stellt normalerweise einen Schutzschild gegen die kosmische Strahlung dar, indem es die Teilchen weitgehend aus der Atmosphäre eliminiert. Es mehren sich jedoch die Anzeichen, dass eine Umpolung des irdischen Magnetfeldes in den nächsten Jahrzehnten oder Jahrhunderten bevorstehen könnte. Die Feldstärke des irdischen Magnetfeldes schwächt sich nämlich seit Jahrzehnten ab. Außerdem ist der magnetische Südpol in den letzten 50 Jahren aus dem kanadischen Archipel über den arktischen Ozean in Richtung der ostsibirischen Inseln gewandert. Diese Polwanderung stellt ein Anzeichen für einen bevorstehenden Umpolungsprozess des Erdmagnetfeldes dar. Er findet im Mittel etwa alle 250.000 Jahre statt. Die letzte Umpolung soll bereits 780.000 Jahre zurückliegen. Das Ereignis ist sozusagen überfällig. Daneben gibt es tiefe kurze Magnetfeldeinbrüche ohne Umpolung, die häufiger stattfinden. Der letzte derartige Einbruch ereignete sich vor 10.000 Jahren.