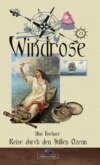Kitabı oku: «Reise durch den Stillen Ozean», sayfa 24
Fünf junge Engländer, die ich später noch näher kennen lernen sollte, da sie gleichfalls einen Monat auf Hawaii zuzubringen und den Krater Kilauea zu besuchen gedachten, liessen sich aus Langweile von dem Bootsmann britische Flaggen auf die Vorderarme tätowiren und bekamen in Folge dessen eine starke Entzündung der betreffenden Hautpartien. Noch lange eiterten und schmerzten die wehenden Banner, und ich selbst hatte in der Folge, als ich ihr Reisegefährte nach dem Kilauea wurde, darunter zu leiden, indem sie gepeinigt auf den Bootsmann der City of New York schimpften und übler Laune waren. Man ergreift eben auf See jede noch so geringfügige Gelegenheit sich zu beschäftigen. Ich verlegte mich darauf, meinen Körper mehrmals täglich Gewichtsbestimmungen auf der Brückenwage im Gepäckraum zu unterziehen, und hatte die Freude zu konstatiren, dass mein Gewicht trotz des fürchterlichen Schwitzens und trotz der mageren Salonkost auf der zwölftägigen Reise um zwei Pfund zunahm. Mein Aufenthalt in Kandavu mochte mich allerdings um viel mehr leichter gemacht haben.
Auch eine wandernde Konzertgesellschaft aus Kalifornien hatten wir an Bord, welche öfter als mir lieb war oben in der Social Hall eine Produktion zum besten gab. Es wurde Piano gespielt und gesungen, trompetirt und gegeigt. Wir anderen aber sassen herum und schwitzten.
Zuweilen war es interessant und unterhaltend, das Benehmen von Personen zu beobachten, die an jenem leichtesten Grad von Seekrankheit, der sich in einem gewissen Stumpfsinn äussert, litten. Da liegt zum Beispiel Einer den ganzen Tag regungslos in seinem Streckstuhl. Nur von Zeit zu Zeit erwacht auf einmal der Thätigkeitstrieb in ihm, er springt auf, aber gleich wirft er sich wieder in seinen früheren Zustand, sobald er merkt, dass das Schiff noch immer schaukelt. Ein Anderer wandert beständig mit einem Buch unterm Arm herum, von seiner Kabine auf Deck, von Deck nach dem Salon hinunter, nach der Social Hall, nach dem Rauchzimmer, nach der Seitengallerie, nach vorne und nach hinten, setzt sich hierhin und setzt sich dorthin, ohne zur Ruhe und zum Lesen zu gelangen. Man fragt sich dutzendmal, ob Vormittag oder Nachmittag sei und was jetzt nächstens für eine Mahlzeit käme, und hat es nach einer Viertelstunde wieder vergessen.
Die Langweile wäre unerträglich geworden, wenn wir nicht zwei Reverends mit unter den Passagieren gehabt hätten, die sich beständig zankten.
Gleich der erste Tag der Reise, jener durch die profane Institution des Datumwechsels in zwei gespaltene, Vielen unbegreifliche Sonntag, gab Veranlassung zu einem sehr amüsanten frommen Disput zwischen den beiden Gesalbten des Herrn. Der eine behauptete, der erste Sonntag sei der richtige und durch Gottesdienst zu feiern, der andere behauptete dies von dem zweiten, und schliesslich einigten sie sich dahin, dass jeder an dem von ihm verfochtenen Sabath predigte und vorbetete.
Reverend Mister Shark, wie der Verfechter des zweiten Sabaths hiess, ein schlauer, magerer Yankee, entpuppte sich übrigens im weiteren Verlauf der Reise als räudiges Schaf der episkopalen Kirche, dem es nur darum zu thun gewesen war, seinen alten englischen Kollegen, welcher die Würde eines Deacon besass, zu ärgern. Reverend Mister Shark hatte sich schon lange von der Frömmigkeit ab und einem lukrativeren Berufe zugewendet. Er war Wanderprofessor geworden und zog von Land zu Land, um Vorlesungen über drei oder vier historische Gegenstände zu halten, zu welchen er grosse farbige Illustrationen besass. Damit machte der smarte Yankee eine Menge Geld und stand sich sehr wohl dabei ohne viel Mühe zu haben, nachdem die vier Vorlesungen einmal gründlich eingepauckt waren. Um sonstige Wissenschaften schien er sich nicht sonderlich zu kümmern. Er frug mich einmal sehr verwundert, wie es möglich sei, dass wir den senkrechten Stand der Sonne später passirten als den Aequator.
Der Andere aber war ein Bonze vom reinsten Wasser und zugleich ein höchst komischer Kauz, eine Figur, wie sie nur das raffinirte Muckerthum englischer Rasse hervorzubringen vermag. Ewig schwebte ein gottbeseligtes, wehmüthiges Lächeln auf den dicksinnlichen Lippen des kurzen und fetten, glattrasirten und glattgescheitelten Männchens. Wenn ihn ein gesundes Lachen anwandelte, wozu er viel natürliche Neigung hatte, kämpfte sein angenommener Ernst, der solch weltliche Heiterkeit verbot, gewaltsam dagegen, und eine unübertrefflich süsssaure Grimasse kam zum Vorschein. Aus lauter christlicher Demuth hielt er den Kopf stets auf die eine Seite geneigt, und unermüdlich war er darauf bedacht, durch Miene und Benehmen die natürliche Einfalt seiner Gesichtszüge noch zu vermehren.
Er hatte eine lange und kräftige und robuste, eckige und majestätische Ehehälfte bei sich, die ihn kommandirte. Sie war der Typus einer bösen Sieben und übertraf ihn weit an Schulterbreite und Höhe. Ohne sie war er ein hilfloser Greis, nicht etwa an Jahren, sondern aus lauter christlicher Demuth. Sie schleppte ihn täglich mit langen Schritten, so dass er kaum folgen konnte, über Deck auf und ab, sie drückte ihn in seinen amerikanischen Streckstuhl, wenn sie dessen müde war, riss ihn wieder empor und führte ihn zu Tisch, wenn das Gong erschallte. Er gehorchte mechanisch und lautlos. Wo sie ihn hinwarf, da blieb er sitzen. Um sich die Reisemütze aufs Haupt zu stülpen brauchte er immer beide Hände, während die junonische Gattin ihn festhielt und vielleicht noch mit einem derben Schlag auf den Deckel nachhalf.
Nur beim Essen entwickelte er eine grössere Selbständigkeit und Gewandtheit. Juno durchbohrte die Stewards mit giftigen widerstandslosen Augen und herrschte sie an, falls sie ihren Gemahl vernachlässigten. Er aber ass und ass und lächelte wehmüthig dabei über seine menschliche Schwäche und faltete wie zum Gebet die Hände, wenn er wieder mit einer Schüssel fertig war. Ein Lieblingsthema seiner Predigten – er predigte beinahe jeden Abend nach dem Konzert – handelte von der wahren Philosophie des Christenthums, welche über den Tod triumphire. Ich möchte den gefrässigen Bonzen in einem gegebenen Fall gesehen haben, wie schnell er sich alle erreichbaren Rettungsgürtel umgeschnallt hätte, statt erst lange über den Tod zu triumphiren.
Er würde gewiss sich unschätzbare Verdienste um unser aller Seelenheil erworben haben, wenn nicht sein Widersacher, der böse Reverend Mister Shark, unablässig darauf bedacht gewesen wäre, ihm zu widersprechen und ihn zu ärgern, wobei er immer, weniger redegewandt als dieser, den Kürzeren zog. Zuweilen legte sich dann zornglühend die herrschsüchtige Juno ins Mittel, aber auch sie hatte gegen den aalglatten gewandten Yankee, der ihr stets mit der grössten Artigkeit begegnete, keinen Erfolg. Die Partei des dicken Deakon nahm immer mehr ab, die des smarten Yankee immer mehr zu, und an den letzten Abenden vor unserer Ankunft in Honolulu besuchten nur mehr ein paar alte Damen männlichen und weiblichen Geschlechts die Andachtsübungen des hochehrwürdigen Deakon.
Wie gesagt, ohne die zwei Pfaffen wäre es recht langweilig gewesen an Bord, und wohl alle die Reisegefährten von damals werden sie nie vergessen, sondern in dankbarem Andenken bewahren.
XVIII
HONOLULU
Ankunft. Wieder der Reverend Mister Shark. Erste Eindrücke von Honolulu. Geschichtliches, Ethnologisches und Erotisches. Sehenswürdigkeiten. Die Regierung, das Parlament, das Militär. Amerikanerthum und Deutschthum. Die Chinesen. Klima und Sanität. Die Leprosen. Der Fischmarkt. Die Umgebung. Ritt nach dem Pali.
Am Morgen des 16. August hatten wir die Insel Oahu, auf welcher Honolulu, die Hauptstadt des Hawaiischen Königreiches liegt, in Sicht. Die Ueberfahrt von Kandavu hatte somit nicht ganz zwölf Tage gedauert.
Die zwölf Hawaiischen oder Sandwich-Inseln erheben sich, der Richtung des vulkanischen Spaltes in der Erdrinde entsprechend, aus welchem sie hervorgequollen sind, in einer gestreckten Reihe von Nordwest nach Südost. Wir kamen aus Südwest, also senkrecht auf sie zu, und konnten in Folge dessen nur jene Insel sehen, die gerade vor uns war, Oahu.
Hohe Berge mit sanft ansteigenden Böschungen, kahl oder mit einer eigenthümlich hellen Vegetation bedeckt, stiegen aus dem indigoblauen Wasser des Ozeans empor. Blendend von der Sonne beleuchtete Schaumstreifen, die Brandung über den Riffen, umsäumten die Ufer. In einer zierlichen Yacht amerikanischer Bauart, von deren Gaffel die Flagge des Königreiches der Hawaiischen Inseln wehte, legte sich der Lootse, ein Amerikaner, an unsere Seite. Sechs wohlgestaltete braune Kanakas, alle in weissen Hemden, weissen Hosen und weissen Marinekäpis, bildeten die Besatzung seines Fahrzeuges, welche echt amerikanisch sofort gedruckte Reklamen von Geschäften in Honolulu vertheilte.
Langsam und mit halber Kraft steuerten wir vorsichtig zwischen Klippen dem Lande zu. Man hatte mir immer so viel von der Vortrefflichkeit des Hafens von Honolulu gesprochen. Ich war erstaunt zu bemerken, wie wir an einer Stelle stoppten, dass die Schraube den Grund aufwühlte und das Wasser trübte.
Erst als wir dem dünnen Mastenwalde des Hafens ziemlich nahe waren, kam Honolulu aus seinem dichten Grün tropischer Gärten, in die es so malerisch gebettet liegt, einigermassen zum Vorschein. Nur die höheren Gebäude, Thürme und Flaggenstangen überragten zwischen schlank emporstrebenden Palmen den üppigen, die kleineren Häuser verbergenden Pflanzenwuchs und liessen die Stadt mehr ahnen als direkt wahrnehmen. Links zogen sich die Gärten und hie und da durchblinkenden Häuser in eine Thalschlucht hinan, rechts trug ein kahler Hügel, röthlich gesengt von den Strahlen der Sonne, ein altes Fort und Kanonen zum Salutiren auf seinem Rücken. Hinter dem Ganzen eine hohe Kette mit Wolken verschleierter Berge. Drei Kriegsschiffe, zwei amerikanische Fregatten und ein englisches Kanonenboot, lagen im Hafen vor Anker. In kleinen Kanuus, einfacher und solider konstruirt als jene der Viti-Insulaner, ruderten nackte Gestalten, blos mit dem suspensoriumartigen Maro bekleidet, uns entgegen. Es war Ebbe, und Weiber fischten über den Riffen, sammt den landesüblichen schwarzen Talaren bis über die Hüften im Wasser umherwandelnd.
In hellen Schaaren standen Europäer und Eingeborene am Landungsplatz, uns in Empfang zu nehmen. Hundert diensteifrige Hände bemächtigten sich der durch die Böte des Dampfers gelandeten schlingenförmigen Enden der Taue, mit welchen unser Koloss langsam an den Kai gewunden werden sollte, und stülpten sie über die Pfosten. Das seemännische Brüllen und Toben des Kapitäns und der Offiziere, welches nie bei dieser endlos langweiligen Prozedur des Anlegens fehlen zu dürfen scheint, vertrieb die mobileren Passagiere vom Schiff. Böte kamen längsseits, und wir flüchteten an der Strickleiter hinunter und an Land, welches wir ungefähr eine halbe Stunde früher betraten als jene, die an Bord geblieben warten mussten, bis der Dampfer am Kai festgemacht war.
Der ganze prangende Reichthum tropischer Früchte begrüsste uns, in grossen Pyramiden von Apfelsinen, Ananassen, Mangos, Bananen, Papayas und Paradiesäpfeln am Ufer aufgestapelt. Eine Menge barfüssiger, aber sonst wohlbekleideter Kanakas, mit rothen Tüchern, Blattguirlanden und Blumenkränzen geschmückt, stürzte auf uns zu und bot uns Wagen und Reitpferde an. Hübsche schwarzäugige Mädchen, mit zierlichen Sonnenschirmchen den dunklen Teint beschattend, über und über mit Blumen behangen, kokettirten sehr verführerisch den frisch angekommenen Fremdlingen zu. Was mir zu allererst an diesen Eingeborenen auffiel, war ihre frappante Aehnlichkeit mit den Maoris von Neuseeland. Es waren ganz und gar die Maoris, nur vielleicht durch das paradiesische Klima ihrer Inseln zu etwas höherer Grazie verfeinert. Lauter herrlich schöne Gestalten. Und mitten in diesem malerischen, das Auge erfreuenden Gewühl die widerwärtigsten, hässlichsten Menschen die ich kenne, bezopfte Chinesen, an den Enden langer Stangen Blechgefässe mit Goldfischen herbeischleppend.
Die Zollformalität wurde von den Beamten auf das Liebenswürdigste abgekürzt. Ich hatte blos eine Deklaration zu schreiben, nichts schmuggeln zu wollen, und durfte sofort mit meinen Kisten passiren. Ein leichtes Buggi führte mich und die theure Habe im Galopp durch die staubigen Strassen nach dem Hotel. Die Ankunft des Dampfers schien für die Bewohner von Honolulu ein Fest zu sein. Männer und Weiber, Knaben und Mädchen und kleine Kinder strömten geputzt und blumenbekränzt zu Fuss, zu Pferd und zu Wagen dem Hafen zu.
Das »Hawaian Hotel«, ein grosses schönes Gebäude in einem Garten von Akazien, Papayas und Bananas, belebte sich bald mit den Passagieren des Dampfers. Der Dampfer hatte hier Ladung zu nehmen und sollte erst morgen die Reise nach San Francisco fortsetzen. Es sprach nicht sehr für seine Küche, dass fast alle Kajütspassagiere die Pause benutzten, sich ihr zu entziehen und dafür auf dem Lande sich schadlos zu halten. Ein zahlreicher Tross von Verkäufern, die Blumenkränze und Korallen, Blattguirlanden und Muscheln und sonstige Artikel feilboten, von Kutschern und Pferdevermiethern belagerte unten im Garten und draussen auf der Strasse das Hotel während des ganzen Tages.
Unsere kalifornische Konzertgesellschaft hatte bereits seit mehreren Tagen Proben abgehalten, um während des kurzen Aufenthalts in Honolulu, wenn es sich günstig mit der Zeit fügte, schnell ein Konzert zu geben und so im Vorübergehen einige hundert Dollars zu machen, was gewiss recht vernünftig und amerikanisch war. Nun traf es sich auch wirklich mit der Zeit so gut, als man nur wünschen konnte, und Alles freute sich auf den genussreichen Abend. Aber ein anderer praktisch denkender Mann an Bord, der Reverend Mister Shark nämlich, war noch viel schlauer und amerikanischer gewesen und hatte bereits einen Monat vorher das königliche Theater, den einzigen hiezu in Honolulu vorhandenen Raum, für eine Vorlesung über den Tower von London in Beschlag genommen. Und als die Konzertgesellschaft nach Honolulu hineinfuhr, hing bereits allenthalben vor den Läden das grosse, schlecht in Holz geschnittene Bildniss des Reverend Mister Shark, seine ganze Lebensbeschreibung voll unendlichen Ruhmes und die Anzeige, dass dieser glänzende Mann, nur um den flehentlichsten Bitten der Bewohner von Honolulu zu entsprechen, sich heute Abend herablassen werde, gegen einen Dollar Eintritt über den Tower von London ungeahnte Enthüllungen zu geben. Die Konzertgesellschaft machte lange Gesichter. Es wurde viel geklatscht und geschimpft, aber ohne wesentlichen Erfolg, und statt musikalischer Gefühlsreize erschütterten am Abend die Gräuel der britischen Königsgeschichte ein kunstsinniges aus braunen und weissen Menschen bunt zusammengewürfeltes Publikum.
Hawaii ist ein konstitutionelles Königreich unter einem eingeborenen König, der über etwa 49 000 eingeborene Vollblutunterthanen herrscht. Ausser diesen leben noch ungefähr 900 Amerikaner, 200 °Chinesen und 2500 Europäer (600 Engländer, 400 Portugiesen, 200 Deutsche, 90 Franzosen) nebst mehr als 2400 Kanakamischlingen theils mit weissem, theils mit chinesischem Blut unter seinem Szepter, so dass sich die Gesammtbevölkerung des Hawaiischen Königreiches auf nahezu 56 900 beläuft. Dasselbe bedeckt einen Flächenraum von 19 757 Quadratkilometer, ist also gleich wie Viti nur um weniges grösser als Württemberg.
Als die Hawaiier zuerst in der Historie auftraten, was vor 100 Jahren geschah, waren sie in lauter kleine Stämme unter eigenen Häuptlingen zersplittert. Ihre berühmteste That seit Anfang bis Jetzt ist die Tödtung des grossen Seefahrers Cook, in der Kealakeakua-Bai 1779, geblieben. Cook ist der Entdecker der Hawaiischen Inseln, und von ihm wurden sie auf den Namen seines Vorgesetzten, des damaligen Chefs der Admiralität in London, Lord Sandwich, getauft. Die Einheit Hawaiis stammt von Kamehameha I., welcher dieselbe im Anfang unseres Jahrhunderts durch Unterwerfung aller anderen Häuptlinge herstellte. Er wird deshalb nach seinem bedeutenderen Zeitgenossen in Europa der Napoleon der Sandwichinseln genannt. Unter ihm kamen die ersten Missionäre, amerikanische Kongregationalisten, ins Land und errangen bald immer mehr Einfluss, so dass schliesslich sie die faktischen Herrscher waren. Gegenwärtig ist ihre Macht im Abnehmen begriffen. Da auch andere Sekten kamen und Konkurrenz machten, so fehlte es auch hier nicht an dem Altweibergezänk der Pfaffen. Eine auffallende Menge von verlassenen Kirchen und Kapellen allenthalben auf den Inseln, welche lebhaft an Tirol erinnert, giebt Zeugniss von jener nunmehr glücklich überwundenen Blüthezeit der Hierarchie.
Auf Kamehameha I. folgten noch vier andere Kamehamehas. Der Fünfte gab 1864 die bestehende Verfassung, nach welcher vier Minister einem aus Ober- und Unterhaus zusammengesetzten Parlament verantwortlich sind. Das Oberhaus zählt 30, das Unterhaus 42 Mitglieder. Da Kamehameha V. ohne Thronerben starb, wählte das Parlament einen gewissen Lunalilo, und als auch Lunalilo ohne Thronerben starb, einen gewissen Kalakaua zum König, und dieser letztere regiert noch jetzt.
Von der grössten Bedeutung für das Emporblühen Hawaiis war früher die Walfischfängerei des Stillen Ozeans. Hawaii bildete eine Hauptstation der Waler, die dort anlegten um sich zu verproviantiren. Gegenwärtig sind die Walfische so selten geworden, dass es sich nicht mehr verlohnt, auf sie Jagd zu machen. Ausser den vielen ehemaligen Kapitäns, welche grösstentheils mit Kanakinnen verheirathet die Insel bevölkern, ist kaum eine Spur jener einst so bedeutenden Industrie mehr vorzufinden.
Die Hawaiier oder Kanakas, wie sie sich selbst nennen, sind reine Polynesier. In ihrer äusseren Erscheinung dürften sie sich kaum von den Eingeborenen Neuseelands unterscheiden, höchstens dass sie vielleicht im Durchschnitt nicht ganz so gross und grobknochig sind wie jene und mehr zur Fettbildung neigen. Die Farbe beider ist ein gesättigtes Braun von verschiedenen Graden der Dunkelheit, sie schien mir niemals so dunkel wie bei den Vitis, niemals so hell und gelblich wie bei den wenigen Tonganern, die ich auf Kandavu gesehen hatte. Ihre Haare sind im Allgemeinen schlicht, zuweilen etwas gekräuselt, aber nicht mehr als dies auch bei uns vorzukommen pflegt. Das Tätowiren, von dem man auf den Gesichtern alter Maoris wahre Kunstwerke bewundern kann, ist bei den Kanakas wohl niemals stark in der Mode gewesen. Man findet nur an alten Weibern hie und da blaue Ringe um die Finger.
Die Sprachen beider haben trotz der 4000 Seemeilen Entfernung so viel Gemeinsames, dass ein Maori und ein Kanaka sich noch verständigen können. Auch dem Hawaiischen fehlen alle mit »S« zusammengesetzten Laute sowie das »F«. Während jedoch das Viti und das Maori höchst wohllautend sind und an das Italienische erinnern, klingt das Hawaiische rauh und barbarisch. Die sehr oft nur aus einem einzigen Vokal gebildeten Silben werden abgesetzt von einander ausgestossen, so dass ein gewisses Gacksen entsteht. Es giebt z. B. eine Ortschaft, welche Maalaea (fünf Silben) heisst. Die vielen Cha, Ka und harten L mit dem R-ähnlichen Vorschlag wie das Schweizer Doppel-L und die Eigenthümlichkeit fast aller Laute, im Gaumen und mit Betheiligung der Nasenhöhle zu klingen, geben der Sprache etwas Unbehülfliches. Ihr Gruss ist hochpoetisch und heisst »Aloha oë« – ich liebe dich.
Ebenso wie bei den Maoris haben auch bei den Kanakas die allzu konsonantenreichen europäischen Namen sich viele Umänderungen gefallen lassen müssen. So ist z. B. aus Britain »Beretania« geworden. Unser Emperor William heisst in Hawaii »Emepela Uilama« und Bismarck »Bihimaka«. Ehe ihre Sprache von den Missionären in die starren Formen der Schriftzeichen eingezwängt wurde, musste natürlich die Möglichkeit der fortwährenden Umbildung eine sehr beträchtliche sein. Dass trotzdem zwischen dem Maori und dem Hawaii so grosse Uebereinstimmung herrscht, ist äusserst merkwürdig und lässt auf eine nur kurze Zeit der Trennung schliessen. Wie wenig auf manche ihrer Laute jene passten, die den Europäern geläufig sind, geht daraus hervor, dass verschiedene Berichterstatter ganz verschieden niederschrieben. Cook schrieb z. B. »Owyhee« statt Hawaii, »Honoruru« statt Honolulu, statt Kauai »Atooi«, statt Molokai »Morotoi«. Das bei so vielen Völkern vorkommende Verwechseln der beiden Buchstaben »L« und »R« gilt auch im Hawaii, und ebenso werden T und K miteinander verwechselt, weshalb man zuweilen auch »Tamehameha« liest. Ich selbst notirte einmal »Rumi rumi« in mein Taschenbuch und fand später dass es »Lome lome« gedruckt wird.
Ehemals ist auch bei ihnen das Nasendrücken (»Hony« jetzt gleichwie im Maori sowohl das erst von den Weissen importirte Küssen als auch Riechen bedeutend) in Geltung gewesen und soll hie und da noch von alten Personen geübt werden. Ebenso wenig fehlt ihnen der Begriff »Tabu« und der bei allen Polynesiern mit Ausnahme der Maoris eine gleich grosse Rolle spielende Gebrauch des Kawatrinkens, nur dass man hier statt »Kawa« »Awa« sagt.
Auch die Hawaiier sind Kannibalen gewesen, aber niemals in demselben Grade wie die Maoris oder gar die Viti-Insulaner. Sie brachten den Göttern Menschenopfer, und diese wurden dann von den Priestern und Vornehmen gefressen.
Auf ihrer gegenwärtigen Kulturstufe sind sie noch immer ein sonderbares Gemisch von alter Barbarei und neuer Zivilisation. Die Kleidung ist im Allgemeinen europäisch, nur dass die Weiber lange lose Talare ohne Taille tragen. In den Städten wie Honolulu auf Oahu, Hilo auf Hawaii, Lahaina und Wailuku auf Maui sind auch die Wohnungen grösstentheils europäisch, in den Dörfern und den einsamen Gehöften jedoch noch nach altem Stil, einfache, ruppige Strohhütten. In der Nahrung hat sich seit Cooks Besuchen nichts Wesentliches geändert. Poi, ein säuerlicher Brei aus Taromehl, ist der Hauptartikel, rohe Fische und Hundefleisch sind noch immer Lieblingsgerichte. Die Mahlzeiten werden auf dem Boden eingenommen, und haben die reicheren, vornehmen Kanakas auch die schönsten Tische und Stühle, sie ziehen es vor, sich daneben auf eine Matte niederzulassen.
Die Hawaiier sind jene Polynesier, welche am raschesten aussterben. In den letzten zwanzig Jahren ist die einheimische Bevölkerung von 80 000 auf 50 000 Köpfe herabgesunken. Der Hauptgrund liegt wohl in der Unsittlichkeit der Weiber und in ihrer Leidenschaft für das Reiten, der sie sich ohne Schonung und Rücksicht, rittlings wie die Männer im Sattel sitzend, hingeben. Die meisten Frauenzimmer reiten sehr geschickt und muthig. Ich sah aber zuweilen auch Reiterinnen mit angsterfüllten Mienen und krampfhaft den Sattelknopf umklammernd dahingaloppiren.
Die Erotik spielt eine grosse Rolle bei den schönen Kanakinnen, und in Honolulu hat sich dieselbe zu einer ziemlich schamlosen Prostitution entfaltet. Dort sind die Missionäre in dieser Beziehung machtlos. Anderwärts aber halten sie ein scharfes Auge auf ihre der Sünde nur zu sehr geneigten weiblichen Lämmer. Während unserer Anwesenheit in Hilo gingen sie in ihrem Misstrauen und in ihrer Vorsicht so weit, uns während der Nacht einen Polizeimann vors Hotel zu postiren.
Man hat im Hawaiischen Königreich reichlich Gelegenheit, Mischlinge aller Grade und Kombinationen aus den drei hauptsächlich vertretenen Rassen, Kanakas, Chinesen und Weissen, zu studiren. Wir Menschen sind bisher in so viele einzelne Stämme isolirt gewesen, dass man bereits an der Einheit unseres Geschlechtes zu zweifeln begann. Jetzt leben wir in einer Uebergangsperiode aus dem Prozess der Differenzirung in jenen des Wiederzusammenfliessens. Die Kommunikationen dehnen sich immer weiter aus. Ueberall wo der Europäer hinkommt, schüttelt er die Stämme durcheinander, kreuzt sich mit dunklem Blut oder unterdrückt es, und vielleicht in einigen tausend Jahren wird es nur mehr Eine Rasse geben.
Honolulu ist eine gartenreiche und deshalb sehr ausgedehnte Stadt mit einer Bevölkerung von 14 000, worunter etwa 1000 Weisse. Die Strassen sind breit und durchschneiden sich nach amerikanischem Muster schachbrettartig, links und rechts begrenzt von Mauern und Zäunen, hinter welchen schlanke Palmen sich wiegen und dichtbelaubte Mangobäume die leicht gebauten luftigen Häuser der weissen und braunen Bewohner verbergen. Die Flora, die sich in den Gärten entfaltet, ist kosmopolitisch. Von allen möglichen Tropenländern haben sich hier Vertreter zusammengefunden. Wohin der Europäer kommt, übt er seinen die Pflanzengeographie nivellirenden Einfluss. Neben der einheimischen Kokospalme steht die königliche Palme aus Westindien, die Dattelpalme aus Afrika. Ostindische Papayas und Mangobäume, chinesische Bambusdickichte und brasilianische Araukarien, Bananas jeglicher Abkunft und hundert andere Pflanzen, von denen man nicht mehr weiss, woher sie stammen, haben sich eingebürgert.
Die Strassen sind staubig, aber die Gärten glänzen stets im frischesten Grün, Dank der reichlichen Wasserversorgung. Ein munterer Gebirgsbach kommt hinter der Stadt in Kaskaden von den wolkenverschleierten, schroffen Höhen herab und vertheilt sich in tausend Aeste und Aestchen, deren Enden aus Kautschuckröhren und transportablen, beständig im Kreise sich drehenden Spritzfontänen überall den Rasen und die Gebüsche bethauen. Hinter den Zäunen sind zuweilen kleine oben offene Verschläge, und häufig stehen in diesen an schwülen Nachmittagen braune Hawaiier und Hawaiierinnen im Kostüm unserer Stammeltern, einen Wasser spendenden Schlauch in der Hand und den Körper berieselnd. Der Zaun deckt ihre Blössen, während sie vergnügt auf die Strasse sehen und mit den Vorübergehenden plaudern.
Unter den öffentlichen Gebäuden ragt das freistehende Regierungsgebäude dominirend hervor. Es ist in Renaissance aus Stein gebaut und trägt in der Mitte einen massiven Thurm, der eine lohnende Aussicht gewährt.
Ein weiter luftiger Saal im Erdgeschoss dient dem Parlament zu seinen Sitzungen. An den einfach weiss getünchten Wänden hängen die Bildnisse der fünf Kamehamehas, des Lunalilo und des Kalakaua, theils in Oel gemalt, theils in lebensgrossen Photographien. Der erste Kamehameha, Hawaiis Napoleon, ist noch mit seinem altheidnischen rothen Federmantel geschmückt, die anderen vier tragen ebensoviele Entwickelungsstufen europäischer Generalsuniformen zur Schau, die zwei letzteren sind im modernen Zivilfrack mit breitem Ordensband und strahlendem Ordensstern erschienen.
Hier spielen sich zuweilen gar schnurrige Debatten ab. Unter den vier Ministern des Kabinets sind drei Weisse, die Präsidentschaft ist weiss, und das Haus selbst besteht zu einem Drittel aus Weissen. Es wird sowohl englisch als hawaiisch debattirt. Eine hawaiische Interpellation findet oft eine englische Antwort, oft sprechen zwei Redner zu gleicher Zeit, der eine englisch, der andere hawaiisch, der Hawaiier wüthend, der Engländer kühl und spöttisch. Und ehe des Morgens die Komödie beginnt, wird gebetet. Es machte mir bei wiederholten Besuchen den Eindruck, als ob die Weissen nicht viel Notiz von den Reden der Kanakas nähmen. Sie sind eben Kinder. Man lässt sie schreien und thut schliesslich doch was man will. Erst kürzlich war ein Gesetz durchgegangen, welches den im Hawaiischen Königreich ansässigen Heilkünstlern sehr verderblich werden konnte, nämlich dass jedem Arzt die Lizenz entzogen werden sollte, der einem Ruf zu einem Kranken nicht sofort Folge leistete. Die Zeitungen brachten viel Schmähartikel über dieses Gesetz und drückten dabei ganz unverblümt ihre vollste Verachtung der braunen Gesetzgeber aus.
In den übrigen Räumen des Regierungsgebäudes befinden sich die Kanzleien der verschiedenen höheren Staatsbeamten, eine Staatsbibliothek und ein Staatsmuseum. An den Thüren liest man bis auf einen nur englische Namen, die dazu gehörigen Titel sind zugleich englisch und hawaiisch daruntergeschrieben, so z. B. »His Excellency W. L. Green, Minister of Foreign Affairs, Kuhina no ko na aina e«.
Die für einen so abgelegenen Punkt der Erde überraschend reiche Bibliothek enthält ausser juridischen und theologischen eine ansehnliche Zahl naturwissenschaftlicher und geographischer Werke und wurde mir auf meinen nur leise angedeuteten Wunsch mit der grössten Liberalität zur Verfügung gestellt, was nächst der überhaupt hier herrschenden Zuvorkommenheit gegen Fremde wohl auch dem Umstande zu verdanken war, dass dieselbe sehr wenig benützt wird. Ich war stets der einzige gänzlich ungestörte Leser und unbeschränkte Alleinherrscher. Kein griesgrämiger Bibliothekar trübte den Genuss der Bücher. Das Museum enthält hauptsächlich ethnographisch sehr werthvolle hawaiische Alterthümer. Die Hälfte davon war eben zur Ausstellung nach Philadelphia gesandt worden und nicht zu sehen. In der Sammlung befindet sich auch ein Palmstumpf, vor welchem in der Kealakeakua-Bai der grosse Cook getödtet worden sein soll, was mir erst später in San Francisco besonders interessant wurde, da dort in einem Museum ein anderer Palmstumpf ausgestellt ist, von dem man dasselbe behauptet.
Dem Regierungsgebäude gegenüber liegt die Residenz des Königs, ein ganzer Block, rings von einer steinernen Mauer mit vier Thoren, an jeder der begrenzenden Strassen eins, umgeben. Nur ein hoher Flaggenmast ist über der Mauer und den Bäumen dahinter sichtbar. Ist die Flagge aufgezogen, so gilt dies als Zeichen, dass der König zu Hause und umgekehrt, gerade wie bei uns. Ein eigentlicher Königspalast existirt gegenwärtig nicht. Man trägt sich schon lange mit dem Gedanken einen zu bauen, aber die Hauptsache, das Geld hierzu, fehlt noch. Einstweilen muss sich das Werk der Zukunft damit begnügen, seinen Schatten in dem Strassennamen »Palace Walk« vorauszuwerfen.
Die Militärmacht Honolulus ist eine sehr bescheidene und besteht nur aus einer Bande Musikanten und zwei Dutzend Palastgardisten. Erstere tragen dunkelblaue Waffenröcke, letztere hellblaue Husarenjacken mit weissen Schnüren, beide weisse Hosen und weisse Käpis. Diese zwei Sorten von Soldaten bummeln den ganzen Tag auf den Strassen herum, so dass man sie überall sieht und auf eine viel grössere Zahl schliessen möchte. Der Kapellmeister ist natürlich ein Deutscher. Seine Bande, lauter junge Kanakas, macht ihm alle Ehre und spielt jeden Samstag auf Queen Emmas Square, einem freien Platz mit Gartenanlagen, auf welchem dann die ganze schöne und vornehme Welt der Residenzstadt promeniren geht. Kurz ehe ich abreiste, streikten die Musikanten, aus welcher Veranlassung und auf wie lange, blieb mir unbekannt.