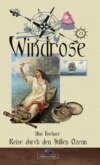Kitabı oku: «Reise durch den Stillen Ozean», sayfa 26
XIX
VON HONOLULU NACH HILO
Ihre Königliche Hoheit Ruth Keelikolani. Morgentoilette der Reisegesellschaft. Lahaina und Kawaihae. Das Hotel zu Hilo. Unser Vergnügungskommissär Hapai. Brandungschwimmen. Die höhere weibliche Schuljugend im Bade. Hula Hula und Konzert. Der Rainbow Fall.
Die Verbindung zwischen den Inseln wurde damals hauptsächlich durch den königlichen Poststeamer Kilauea, der etwa so gross wie ein Helgoländer Dampfer und bereits so altersschwach und baufällig war, dass er unterdessen wahrscheinlich zu existiren aufgehört hat, vermittelt. Jeden Montag ging er von Honolulu ab, dreimal im Monat nach Maui und Hawaii und einmal nach Kauai.
Am 21. August schiffte ich mich nebst meinen fünf Engländern auf ihm ein, um nach Hilo, der Hauptstadt der grössten Insel Hawaii, zu fahren und von dort aus den berühmten Vulkan Kilauea zu besuchen. Fast gleichzeitig mit uns verliess der Schuner, der die vierzehn Leprosen nach Molokai bringen sollte, den Hafen von Honolulu. Wir kamen gerade noch recht, um Zeugen einer ergreifenden Abschiedsszene zu sein. Sechs Polizisten eskortirten die traurige Schaar, hinterdrein folgten jammernd und weinend die Angehörigen der armen Verbannten wie bei einem Leichenbegängniss. Sie schieden auf Nimmerwiedersehen.
Es war fünf Uhr Nachmittags, als wir uns an Bord des Kilauea begaben. Eine bunte Menge von Kanakas und Weissen, von Pferden und Wagen umstand die Abfahrtstelle. Ganz Honolulu schien wieder auf den Beinen zu sein, dem Dampfer das Geleit zu geben.
Man sagte, eine Prinzessin sollte mit uns nach Hilo gehen, und bald fand ich unter dem Gewimmel, welches das Schiff erfüllte, Ihre Königliche Hoheit heraus. Es war dieselbe kolossal fette alte Person, welche ich kurz vorher auf der Strasse in einem eleganten Buggi eigenhändig hatte vorbeikutschiren sehen, während ihre Begleiterin respektvoll einen Sonnenschirm über sie hielt. Jetzt sass sie unter dem Leinendach des Achterdecks, umgeben von ein paar vornehmen Hawaiierinnen, schwitzte und athmete mühsam unter der Last ihres Fettes und glich mit ihrer breiten gespaltenen Doppelnase und ihren strotzenden Fettwülsten am Halse einem abgehetzten Bullenbeisser. Stupid sah sie gerade vor sich hin und empfing apathisch die Huldigungen, die ihr zu Theil wurden, indem mehrere Männer, unter diesen auch der Kronprinz, ehrfurchtsvoll entblössten Hauptes sich zu ihr herandrängten, um ihr die Hand zu küssen. Auch drei oder vier Weisse die ich kannte sah ich auf solche demüthige Weise ihr huldigen, sah wie auch sie mit entblösstem Haupt auf die Hand des stupiden Fettscheusals sich niederbeugten. Ich musste mich abwenden, ich fühlte, dass sie sich vor mir schämten. Ruth Keelikolani wie die Prinzessin, eine Halbschwester der beiden letzten Kamehamehas, heisst ist nämlich sehr reich, und Mancher hofft aus ihrer Gunst Gewinn zu schlagen.
»Acht geben auf die Pferde« lautete das vorsorgliche Kommando des Kapitäns, und die Dampfpfeife brüllte zum Zeichen, dass alle Nichtpassagiere das Schiff zu verlassen hätten. Glücklicher Weise blieben nur Wenige von der grossen Menge an Bord und wir bekamen Luft. Der Dampfer trennte sich von dem Kai, heftiges Winken mit Taschentüchern von hüben und drüben, und wir bewegten uns vorwärts, ein schönes lebensvolles Bild von braunen Gesichtern, glänzenden Augen, grellen Gewändern und Blumenguirlanden am Ufer zurücklassend. Einem von unserer Gesellschaft entführte ein Windstoss seinen Strohhut ins Wasser, und sogleich war ein Kanuu darauf aus, packte den Deserteur und brachte ihn freundlich zurück, ohne dass eine Belohnung gereicht werden konnte. Welcher Jollenführer in Hamburg, New York oder London hätte dasselbe gethan?
Die Prinzessin hatte für sich eine breite Bettstelle mit einem Zeltdach darüber auf Deck stehen. Im weiteren Verlauf unserer Beobachtungen kam auch ein weisser Topf zum Vorschein, dessen mächtiges Kaliber uns anfänglich über seine Bestimmung in Zweifel liess, bis wir durch einen unzweideutigen Akt in Klarheit versetzt wurden. Es dauerte nicht lange, so fing sie an ihre Abendmahlzeit zu nehmen. In einer Kürbisschüssel wurde ihr Poi gereicht, den sie in der üblichen Weise mit Zeige- und Mittelfinger heraustunkte, und auf einem Porzellanteller etliche salzbestreute rohe Fische, die sie schnell mit den Händen packte und einen nach dem anderen gierig verschlang, indem sie wohlig schmatzte. Danach bekam die Dienerschaft, zwei ältliche Burschen und eine junge hübsche Kammerzofe, ein aus denselben Artikeln bestehendes Essen. In dieser Beziehung sind die Hawaiier noch immer die alten Barbaren und werden es bleiben, bis sie vom Erdboden verschwinden, trotz Konstitution und Parlament.
Auch der Gouverneur von Hawaii, Seine Excellenz Samuel Kipi, fuhr mit uns nach Hilo, und ich wurde ihm vorgestellt. Er ist ein äusserst würdig und anständig aussehender strammer alter Herr in untadelhafter europäischer Kleidung. Aber auch er ging nicht wie wir in die Kajüte zur Tafel, sondern blieb oben auf Deck bei der Prinzessin sitzen und schmatzte mit rohen Fischen und Poi herum. Ich habe überhaupt nie einen Hawaiier auf unsere Weise essen sehen. Sie sind hierin konservativer als die Maoris, ihre nahen Verwandten.
Die Nacht brach herein. Wir hatten unsere Betten auf Deck tragen lassen, um kühler zu schlafen. Die See wurde unruhig, ein heftiger Wind blies in das einzige Gaffelsegel und legte das Schiff stark auf die Seite, so dass wir beständig nach dem Geländer hinunterrutschten und nur wenig schlafen konnten. Ueberall regten sich die Qualen Neptuns unter den Passagieren. Rechts von mir stöhnte ein seekranker Chinese, links schnarchte die dicke Königliche Hoheit in ihrer Zeltbettstatt. Ich sah beinahe den ganzen Sternenhimmel sich umdrehen, ohne ein Auge zuzuthun.
Morgens um vier, als es eben dämmerte, ankerten wir vor Lahaina auf der Insel Maui, der ehemaligen Hauptstadt der ganzen Gruppe, einer schönen, gartenreichen Ortschaft mit einer weissgetünchten Kirche und mehreren grösseren Gebäuden, hellgrüne Zuckerfelder zu beiden Seiten und im Hintergrund, der zu den kahlen Bergen ansteigt. Einige Passagiere und Waaren wurden hier in Böten gelandet, dann gings wieder fort.
Vor uns trat die untere Hälfte des mächtigen 3000 Meter hohen Haleakala, des »Hauses der Sonne«, der den grössten erloschenen Krater der Erde von 27 englischen Meilen oder 43 Kilometer Umfang auf seinem Gipfel trägt, immer deutlicher in die Augen, die obere Hälfte mit dunklen Wolken verhüllt. Zur Rechten deckten die Inseln Kahoolawe und Molokini den Meereshorizont, wir waren ringsum von Land umgeben. Ueberall hohe kahle Berge, in deren Geröllböschungen winzig erscheinende Häuser eingestreut sind.
Wir fuhren jetzt unter dem Schutz der Inseln in ruhigem Wasser, und Alles an Bord wurde lebendig. Auch die dicke Königliche Hoheit war schon auf, hatte sich bereits eine Portion roher Fische und eine Schüssel Poi ins Bett reichen lassen, und guckte nun vergnügt mit dem Ausdruck eines gutgelaunten Bulldoggs durch den Spalt ihres Leinwandkäfigs ins Freie.
Als ich unten in der gemeinschaftlichen Kajüte Toilette machte, hatte ich Gelegenheit einer That zartester Galanterie beizuwohnen. Die hübsche Kammerzofe kam die Treppe herab um etwas zu holen. Es wurde an der Thür eben aufgewaschen und der Boden war voll Wasser. Sogleich sprang der Steward, ein Kanaka wie fast die ganze Mannschaft, herbei und setzte seinen Fuss in die Nässe, damit sie auf ihm trocken hinüberschreiten konnte. Allerdings geschah diese Aufmerksamkeit nicht ganz uneigennützig. Denn während sie sich Dank lächelnd des männlichen Fusses als Tritt bediente, umschlang sie der kühne Jüngling und drückte ihr einen lauten Kuss auf die Lippen, was sie sich sehr gerne gefallen liess.
Mit uns auf dem ersten Platz fuhr noch eine weisse Dame mit zwei kleinen Mädchen, die jedoch alle drei grösstentheils in ihren Kojen blieben, da sie seekrank waren, und etwa zwei Dutzend eingeborene Weiber, Männer und Kinder, die auf Deck herumlagen. Vorne auf dem zweiten Platz war es etwas voller. Der Hauptunterschied zwischen der Weiblichkeit erster und zweiter Klasse war, dass die einen des Morgens ihre Unterextremitäten ziemlich ungenirt mit weissen Strümpfen und zierlichen Stiefelchen schmückten, die anderen jedoch barfüssig blieben. Alle aber, selbst die ältesten reizlosesten Matronen, bekränzten sich beim Erwachen des Tages mit frischen Blumen- und Blätterguirlanden. Dann zogen sie enge Holzpfeifen aus dem Busen und liessen sie im Kreise herumgehen. Den Tabak hatten sie in alten blechenen Pulverflaschen bei sich und klopften ihn erst auf die Hand. Spangen von bunten Muscheln wurden um die Arme befestigt, Ringe mit falschen Edelsteinen glitzerten an den Fingern, einige indess hatten nur tätowirte Ringe. Golden stieg die Sonne hinter den Wolkenbänken des Haleakala empor und bestrahlte leuchtend unsere malerische Reisegesellschaft.
In der Makena-Bucht legte sich der Kilauea an eine Boje, um Bauholz zu landen. Da dies einige Zeit in Anspruch nahm, liessen wir uns ans felsige Ufer setzen. Mehrere grosse, breite und schwere Blockwagen mit je acht Paar langhörniger Ochsen bespannt warteten hier, um die Balken ins Innere abzuführen, eine Schaar Bummler lungerte herum, und ein Rudel schwarzäugiger Mädchen lachte mich kichernd aus, als ich zwischen der Brandung nach Schnecken und Krabben suchte.
Wir verliessen den Schutz der Insel Maui und kamen nun wieder, quer nach Hawaii hinübersteuernd, in offenes Wasser. Scharf blies der Nordostpassat durch die 30 Seemeilen breite Lücke über die weissen Kämme der Wellen hin, und wieder fing die Seekrankheit an zu wüthen. Bisher hatten die Kanakafamilien an langen Zuckerrohrstangen gekaut oder aus ihren kurzen dünnen Holzpfeifen Tabak geraucht. Jetzt griffen sie wieder der Reihe nach zu jenen fatalen Gefässen, die hier eine ebenso bedeutende Rolle spielen, wie zwischen Kuxhaven und Helgoland.
Immer deutlicher traten die kolossalen Massen des Haleakala hinter uns heraus. Seine graue Kappe löste sich vor den Strahlen der Sonne, und ein Kegelberg von den gewaltigsten Dimensionen erhob er sich aus dem Ozean. Riesige Schluchten zerklüfteten radienartig seine stetig und fast ohne Brechung ansteigenden Wände in ebensoviele gewaltige Pfeiler von 1000 Meter Höhe, die weit und mächtig in die brandende See vorsprangen. Nicht die Spur einer Vegetation war an ihnen zu entdecken. Die schroffen Flächen schienen vollkommen kahl zu sein. Unten durchbrachen hie und da kleinere sekundäre Vulkane den Boden. Wolkenschatten flogen gleich blauen Inselchen darüber hin.
Gegen Abend ankerten wir in der Kawaihae-Bucht an der Westseite der grossen Insel Hawaii. Von hier kehrten wir wieder zurück und fuhren um das Nordkap herum nach der östlichen Seite, auf deren Mitte ungefähr die Hauptstadt Hilo liegt. Kawaihae war früher ein sehr bevölkerter Platz und besteht jetzt nur mehr aus wenigen Häusern. Die Trümmer eines alten Heidentempels, welcher noch zu Anfang dieses Jahrhunderts zahlreiche Menschenopfer gesehen haben soll, erinnern an die einstige Grösse.
Es wurde rasch dunkel, und wie wir nach einer besseren Nacht als der vorhergehenden erwachten und um uns blickten, hatten wir die bald schroffe, bald anmuthige, stets aber grossartige Nordostküste Hawaiis ganz nahe zu unserer Rechten. Ueberall stieg das Land in steilen Wänden, deren Höhe zwischen 20 und 200 Meter auf und ab undulirte, empor. Wasserfälle stürzten von ihnen in wenigen Absätzen rauschend herab, so häufig, dass wir fast immer einen in Sicht hatten. Von den Kanten zogen sich, hier auf der stets befeuchteten Windseite besser gedeihend, Flächen von dunkeln Ohiawäldern wechselnd mit helleren Zuckerplantagen sanftansteigend zu den beiden Riesen Maunaloa und Maunakea, die noch verschleiert vom Morgendunst den Hintergrund als dunkle Mauer bildeten, hinauf. Ein paar kleine Ortschaften mit reinlich weissgetünchten Kirchen guckten verstohlen aus grünen Schluchten.
Um eine Ecke biegend gelangen wir in die Byron Bai und sehen Hilo vor uns. Ebenso gartenreich oder noch gartenreicher als Honolulu, erhält dieses reizende Städtchen von kaum 1000 Einwohnern durch zwei hohe Kirchen, von welchen die eine, die katholische, Doppelthürme im Jesuitenstyl besitzt, einen fast europäischen Anstrich8.
Die ersten Eindrücke, die wir empfingen, als wir in Hilo das Land betraten, liessen nichts zu wünschen. Ueberall freudig mit Blumenkränzen geschmückte hübsche Mädchen, überall freundliche, einladende Gesichter. Selbst die zahlreichen Chinesen, welche beinahe die ganze dem Kai zunächstgelegene Strasse okkupiren, schienen hier weniger abstossend zu sein.
Ein Chinese von sehr anständigem Aussehen war es auch, den uns der liebenswürdige Kapitän des Kilauea als Hotelwirth rekommandirte. Ein Dutzend Kanakas ergriff diensteifrig unser Gepäck und wir folgten ihnen nach dem Hotel, einem einfachen Gartenhaus mit Veranda, welches weiter oben in der dritten oder vierten Parallelstrasse lag und in dem wir aufs beste untergebracht und verpflegt wurden. Zwei Halbchinesen, Vettern des Wirthes, von denen namentlich der Aeltere, Hapai, rühmlichst genannt zu werden verdient, nahmen sich mit grösster Hingebung der Bedienung an.
Unsere erste Sorge war ein Süsswasserbad aufzusuchen, und Hapai führte uns nach dem Wailuku, der sich gleich neben Hilo in das Meer ergiesst. Ein wilder Gebirgsfluss braust der Wailuku durch romantisch zerklüftete Schluchten von Lavafelsen herab aus dem Maunakea, zwischen hohen schwarzen Blöcken in mehrere Arme zersplitternd, sich wieder vereinigend, hier in Wasserfällen hinunterstürzend, dort über breitere Betten von Rollsteinen dahinschäumend, grossartig und wild wie Alles auf diesen Inseln. Seitlich von der reissenden Strömung des Flusses haben sich stufenförmig übereinander mehrere geräumige Tümpel mit ruhigerem Wasser gebildet, welche zum Baden dienen. Bizarre Pandanusbäume, festgeklammert an den Wänden mit ihren sperrigen Wurzelpyramiden, hängen von oben herab und wiegen rauschende Büschelköpfe im lauen Passatwind. Auf dem anderen Ufer wuschen einige Weiber. Sie sassen dabei sammt ihren weissen Hemden bis zum Nabel im Wasser und riefen uns fröhlich »Aloha« herüber.
Nach dem Bade gingen wir an den Strand und liessen uns das berühmte Brandungschwimmen produziren. Leider kommt dieser interessante Wassersport der Kanakas immer mehr ausser Uebung. Namentlich die Bevölkerung von Hilo soll ehemals sehr geschickt darin gewesen sein. Kein Theil der Küste von Hawaii ist geeigneter, jene imposanten bis zu vier Meter hohen lang ausrollenden Wogenketten zu erzeugen, als der flache Strand der Byron Bai, gerade dem Ozean und dem Nordostpassat entgegen geöffnet. Nur drei Brüder verstehen sich noch aufs Brandungschwimmen und erboten sich, gegen je einen Dollar ihre Künste zu zeigen.
Sie holten ihre zu diesem Zweck dienenden Bretter, etwa anderthalb Mannslängen hoch, eine Armlänge breit, aus schwerem Holze, sehr dünn und mit scharfen Rändern, herbei und gingen mit ihnen, bis auf den Maro entkleidet, ins Meer hinaus. Untertauchend, so oft eine überschäumende Woge herankam, durch die Wogenthäler theils schwimmend, theils mit den Füssen vom seichten Grunde sich abstossend, entfernten sie sich schneller als ich es je für menschliche Lungen möglich gehalten hätte immer weiter und weiter vom Lande. Wir setzten uns auf die Spitze eines dem Ufer entsteigenden Lavafelsens und sahen ihnen durch Ferngläser nach, bis sie nur mehr als schwarze Pünktchen im Gischte der flachen Brandung zu erkennen waren. Dann schwangen sie sich plötzlich auf ihre Bretter und kamen langsam wieder näher. Auf welche Weise dies geschah, konnte ich anfänglich nicht unterscheiden. Sie bewegten sich nicht in der Richtung der See dem Lande zu, sondern schräg zu dieser im Zickzack kreuzend, so dass sie einmal auf der uns zugewendeten, dann wieder auf der entgegengesetzten Böschung abwärts und aufwärts glitten. So eilten sie den Wogen voran. Während sie in das Thal hinabschossen, legten sie sich flach mit dem Bauch aufs Brett und nahmen die Hände als Ruder benützend einen Anlauf, um über die vorne rollende Woge hinauf und durch den schäumenden Kamm zu gelangen. Waren sie glücklich oben, so sprangen sie auf die Knie oder auch wohl auf die Füsse und schwebten einen Augenblick aufrecht über dem Wasser. Nicht immer gelang ihnen dies, und zuweilen warfen sie um und verschwanden. Aber gleich waren sie wieder auf ihrem Brett und glitten wieder über die See dahin. Mehrmals gingen sie noch hinaus, um von Neuem ihr anmuthiges Spiel zu zeigen, bis wir genug hatten.
Die drei Dollars, welche die drei Brüder auf solche Weise verdienten, schienen den gesammten Jungen von Hilo einen Impuls zu geben, sich gleichfalls im Brandungschwimmen zu versuchen, und als wir gegen Abend wieder an den Strand kamen, arbeiteten ihrer mehrere Dutzend mit Brettern im Wasser herum, jedoch ohne etwas Nennenswerthes zu leisten. Die schöne Sitte, an der sich früher Alles, auch das zarte Geschlecht nicht ausgenommen, betheiligte, schwindet dahin wie die Hawaiier selbst.
Weiter gegen das östliche Ende der halbkreisförmigen Byron Bai, welches das kleine Coconut-Inselchen markirt, da wo die Brandung weniger stark war, wurde gefischt. Unter lautem Geschrei betheiligten sich Männer und Weiber an diesem Geschäft. Die Männer mit kurzen Hemden bekleidet oder nackt bis auf den niemals fehlenden Maro, die Weiber sammt ihren hellfarbigen, prangend grünen und rothen Gewändern, wateten sie in grösseren Gesellschaften den anrollenden Wellen, die ihnen jedesmal bis zu den Hüften stiegen, entgegen und hielten grosse Netze horizontal ausgespannt unter die Oberfläche des Wassers. Ich konnte jedoch nichts bemerken, was einem gefangenen Fisch glich. Ein dicker Polizist mit Käpi, Messingschild auf der Brust und einem Stock in der Rechten promenirte auf dem Strand und schien die Aufsicht zu führen.
Unser Hapai, der sich zu der Rolle eines Vergnügungskommissärs berufen fühlte, rieth uns, nach Tisch abermals an den Wailuku zu gehen, weil um diese Zeit die höhere weibliche Schuljugend sich dort einzufinden und zu baden pflege, und gerne folgten wir seinem angenehmen Vorschlag.
Der Badeplatz war noch leer. Drüben am anderen Ufer sassen dieselben Frauenzimmer, die wir schon Vormittags gesehen hatten, noch immer im Wasser und wuschen. Wir warteten nicht lange als wir über uns auf der Kante jugendliche Stimmen hörten. Eine Schaar Mädchen von 14 bis 18 Jahren, in hellen Gewändern und blumenbehangen, blickte herab, etwas enttäuscht und betroffen über unsere Anwesenheit. Sie debattirten hin und her, kicherten und zogen sich zurück, aber nur, um nach wenigen Minuten zwischen den schwarzen Blöcken des Ufers wieder zu erscheinen, einen Steinwurf unterhalb der Stelle, an der wir sassen.
Im Nu waren sie entkleidet und schwammen, ihr Bündel mit dem rechten Arm hoch in die Luft haltend und das Gesicht von uns abgewandt, durch die reissende Strömung nach der gegenüberliegenden Seite. Sie schienen in Bezug auf ihre Kleider uns nicht zu trauen und hatten dabei vielleicht nicht ganz Unrecht. Um die Exponirung ihrer Reize waren sie jedoch weniger besorgt. Vollständig nackt sprangen sie glatt und geschmeidig von einem Block zum andern, um oberhalb den Fluss nochmals zu kreuzen und zu unserem Badetümpel zu gelangen. Hier sprangen sie von einem Felsen herab und machten vorwärts und rückwärts Purzelbäume ins Wasser. Sie hatten augenscheinlich die Absicht, uns mit ihren Künsten zu unterhalten, was ihnen gewiss nicht übel gelang. Wir setzten uns nieder auf eine natürliche Felsentribüne, drehten uns Zigaretten und klatschten Beifall, während die liebenswürdigen Mädchen immer eifriger ihre Purzelbäume zum Besten gaben. Es waren fast lauter üppige, verlockende Gestalten im duftigen Reiz der eben vollendeten Formen, kleine bronzene Aphroditen, für die moderne Kunst ohne die leiseste Idealisirung zu sinnlich angekränkelten Statuetten verwendbar.
Auch eine von den Wäscherinnen drüben schwamm in ihrem Hemd herbei, um sich vor uns zu produziren und ebenfalls Purzelbäume ins Wasser zu machen. Bald merkte sie, dass sie im Hemd gegen ihre nackten Konkurrentinnen im Nachtheil war und durchaus nicht denselben Beifall erntete. Sie liess es fallen – eine echte Tochter Evas. Noch mehr Weiber schwammen herbei, auch manche ältere und unvermögend zu reizen, aber auch sie wollten sich produziren und Purzelbäume machen, theils im Hemd theils ohne.
Schliesslich kam ein Kunststück, welches uns fast die Haare zu Berg trieb. Unterhalb des Tümpels, vor dem wir sassen, theilt sich der Wailuku in drei Arme, welche in enge aus mächtigen Lavablöcken gebildete Kanäle eingezwängt, erst eine Strecke heftig dahinschiessen und dann als zehn Meter hohe Wasserfälle frei in ein tieferes von steilen Wänden umschlossenes Becken hinabstürzen. Mit Besorgniss sahen wir, wie die Mädchen den gefährlichen Kanälen sich immer mehr näherten. Wir trauten kaum unseren Augen, sie schienen gerade in die wildeste reissendste Strömung zu steuern. Die Strömung ergriff sie und führte sie fort, sie verschwanden. Entsetzt sprangen wir über die nächsten Blöcke, um, wie wir fest glaubten, die Unvorsichtigen unten zerschmettern zu sehen. Aber zu unserem Erstaunen tauchten sie wieder empor aus dem schäumenden Wasser, riefen lachend uns zu, ihnen zu folgen, und kletterten gewandt an den Wänden in die Höhe, um von Neuem das waghalsige Schauspiel zu unternehmen. Spöttisch freuten sie sich, dass uns ihre Leistungen so sehr imponirten.
»Ich wette, das wagen Sie doch nicht« neckte man mich, und unten winkte gerade eine besonders verführerische kleine Sirene. Ich wettete, warf meine Kleider ab und sprang in den Fluss, und eine Minute später hatte ich etwas gewagt, was ich kurz vorher für Wahnsinn erklärt hätte. Pfeilschnell riss es mich, auf dem Rücken, die Beine voraus, zwischen den Felsblöcken durch. Ich plumpste hinab, es wurde dunkel, es wirbelte mich ein paar mal im Kreise, aber leicht und rasch arbeitete ich mich aus ziemlich beträchtlicher Tiefe an die Oberfläche empor. Zweimal machte ich diese wilde Wasserfahrt, ohne jemals an eine der vielen Unebenheiten zu stossen. Ich fühlte deutlich, wie der heftige Zug der Strömung gleichsam federte über den scharfen Zacken, als ob sie gepolstert wären. Viel schwieriger war es, aus dem Abgrund wieder zurückzuklettern, und kaum würde ich den Weg gefunden haben, wenn nicht die braunen Genossinnen des Bades mich geleitet hätten. Hapai der uns nachgegangen war, warnte mich, dass schon mancher da drunten stecken geblieben und nicht wieder zum Vorschein gekommen sei. Deshalb stand ich von weiteren Experimenten ab, froh um eine interessante Erfahrung reicher zu sein.
Für den Abend hatte unser Hapai die nationale »Hula Hula« genannte Tanzproduktion arrangirt. Zwei Tänzerinnen und drei Musikanten, alle natürlich blumengeschmückt, erschienen im Salon des Hotels, und eine Menge neugieriger Zuschauer folgte ihnen.
Der Hula Hula geniesst den Ruf, unter den vielen lasziven polynesischen Tänzen der laszivste zu sein, und was ich davon, obgleich abgeschwächt durch die dem Fremden gegenüber stets beobachtete grössere Zurückhaltung, zu sehen bekam, schien mir dies wohl zu rechtfertigen.
Zuerst setzten sich die Tänzerinnen sowohl als auch die Musikanten mit gekreuzten Beinen in zwei Reihen auf den Boden und erhoben einen gellenden Wechselgesang, indem sie bald langsam und feierlich, bald rasch und leidenschaftlich den Oberkörper und die Arme hin und her warfen und kleine birnförmige Kalebassen die mit Steinchen gefüllt waren in den Händen schüttelten, was einen heillosen rasselnden Lärm hervorbrachte. Die Melodie, zwar ewig in zwei Sätzen wiederkehrend, war viel komplizirter als die beim Haka der Maoris und beim Meke Meke der Vitis gehörten. Die zwei Tänzerinnen trugen einen dem Hula Hula eigenthümlichen Schmuck um die nackten Knöchel, bauschige Wülste aus dunklen Vogelfedern, zwischen welchen Hundezähne befestigt waren. Sie hatten nicht den gewöhnlichen langen losen Talar an, sondern eine Art Mieder und aufgeschürzte, um die Taille gebundene Röcke. Ehemals beschränkte sich das Tanzkostüm auf Blumenkränze in den Haaren und um die Brüste, auf die Knöchelwülste und auf ein kurzes Röckchen, welches nur dazu diente, empor geschnellt zu werden. Jetzt herrscht beim Hula Hula in der Regel ein höherer Grad von Bekleidung bis zu jener höchsten Dezenz hinauf, welche Pluderhosen vorschreibt. In vertrauten Kreisen soll allerdings die ursprüngliche Einfachheit noch immer sehr beliebt sein.
Nach einiger Zeit sprangen die beiden Frauenzimmer auf und begannen nun stehend, ohne ihre Plätze zu verändern, unter den nämlichen wilden Geberden, unter dem nämlichen wilden Schreien und Rasseln höchst unzüchtige Bewegungen mit dem Becken zu verüben. Immer hastiger und erregter wurde ihr Toben, die Blumenkränze flogen zerrissen zu Boden, und die braunen Zuschauer hinter unseren Stühlen geriethen in Begeisterung, lachten laut und klatschten entzückt in die Hände und betheiligten sich an dem Vergnügen, indem auch sie dieselben Hüftenbewegungen machten, so weit es der dichtgedrängt volle Raum gestattete.
Nach mehrmaligen Pausen ging es immer in derselben Weise fort, die Variationen schienen nur im Texte zu liegen, den wir nicht verstanden. Einmal warfen sich die Musikanten, welche sitzen geblieben waren, auf alle Viere nieder und führten in dieser Stellung wahrhaft bestialische Zuckungen aus.
Wir hatten für die Tänzerinnen und Musikanten und für die zahlreichen uneingeladenen Gäste Thee machen lassen, während wir selbst zu unseren Spirituosen griffen, die wir von Honolulu mitgebracht, weil solche auf Hawaii verboten sind. So kneipten wir eine Zeit lang miteinander während immer mehr Neugierige kamen, zur grossen Entrüstung Hapais, der uns bereden wollte, das ganze braune Publikum aus dem Hause zu jagen. Aber die Kanakas waren so naiv liebenswürdig in ihrer Zudringlichkeit, dass wir ihnen nicht böse sein konnten.
Als der Hula Hula vorüber war, fing draussen im Garten ein Rudel junger Männer an, vierstimmige Lieder vorzutragen, die sie von den Missionären gelernt hatten, und die mir wieder ein glänzendes Zeugniss ablegten von der grossen musikalischen Begabung der Polynesier. Sie hörten schliesslich gar nicht mehr auf zu singen, bis wir ihnen bedeuteten, dass es Zeit sei schlafen zu gehen. Solange wir in Hilo waren, wiederholten sich jeden Abend diese Konzerte.
Am nächsten Tag gingen wir aus, Pferde für die Kilaueapartie zu miethen. Ein in Hilo ansässiger Engländer, an den wir Empfehlungen hatten, war uns dazu behülflich. Fünfzehn Dollars ist der herkömmliche Preis für den fünftägigen Ritt, wobei ausbedungen wird, dass im Fall des Verunglückens eines der Thiere keine Entschädigung verlangt werden dürfe. Man brachte uns etwa zwanzig Pferde und wir trafen unsere Wahl. Dann ritten wir, um sie zu probiren, nach dem eine halbe Stunde entfernten Rainbow Fall. Der Wailuku ergiesst sich dort 20 Meter tief in ein weites Becken. Der von ihm emporgewirbelte Staubregen entwickelt im Glanz der Sonne und von der entsprechenden Stelle aus gesehen jenes zarte Phänomen, dem die Sehenswürdigkeit ihren Namen verdankt.
Nahe dem Wege stehen drei kleine kuppenförmige Hügel nebeneinander, mit grüner Vegetation überzogen. Es sind zweifellos alte Vulkane, obwohl ich nicht oben gewesen bin.