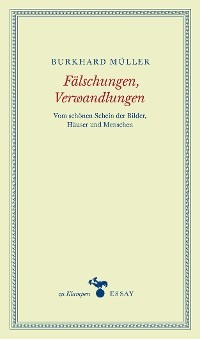Kitabı oku: «Fälschungen, Verwandlungen», sayfa 2
Der unenttarnte Fälscher ist der große Wohltäter des Markts und Betriebs, ihr Gleitmittel, wo es hart auf hart geht und zu stocken droht. »Du betrügst zwar«, hat Helene Beltracchi im Interview erklärt, »aber es gibt doch gar kein richtiges Opfer.« Im Gegenteil, solange alles gutgeht, gibt es nur Nutznießer: Keiner hat Geld verloren, alle haben welches gewonnen. So können ja auch Banken zehnmal so viel Geld, wie sie als Eigenkapital besitzen, verleihen, vorausgesetzt, niemand thematisiert diesen (im Prinzip bekannten) Umstand ausdrücklich. Das geschieht ganz regelmäßig und legal. Unangenehm wird es erst, wenn »someone calls the bluff«. Dann will plötzlich jeder sein Geld zurück, das nicht da ist, eine Panik entsteht, und es muss der Staat einspringen, um den Kollaps des Systems abzuwenden. Im Fall des aufgeflogenen Fälschers allerdings geschieht dies nicht, sondern es bleibt jeder auf seinem Schaden sitzen; und alle sind sich einig, dass, was er getan hat, bloß illegal war.
Aber erst, wenn er auffliegt. Bis dahin sind Markt und Fälscher sich insgeheim einig: Nichts ist letztlich so unimitabel, wie es tut, lässt sich doch alles über den einheitlichen Leisten des Marktpreises schlagen. Tut man dem Galeristen oder Kunsthändler, der den Fälscher von ferne erblickt, Unrecht, wenn man behauptet, er grüße ihn mit einem Augurenlächeln? Doch wenn es auffliegt, sind sie beide dran, und sie vermögen dann einander auch keinen Trost zu spenden.
Es bleibt Markt und Betrieb nichts übrig, als den heimlich Benötigten und Ersehnten öffentlich zu verleugnen und abzuwehren. Drei Mittel sind es, die sie gegen ihn, wie halbherzig auch immer, zum Einsatz bringen: die Stilkritik; die Provenienzforschung; und die Materialprüfung. Die Stilkritik hat im Fall Beltracchis ein Fiasko erlebt, von dem sie sich so schnell nicht und vielleicht nie wieder erholen wird. Was die Provenienz angeht, also den möglichst lückenlosen Nachweis des Verbleibs eines Kunstwerks von seiner Entstehung bis zur Gegenwart, konnten die Beltracchis mit ihren frei erfundenen historischen Sammlungen straffrei ein Theater von erstaunlicher Unverfrorenheit abziehen. Es genügte an einem bestimmten Punkt, dass sie ein altes Wohnzimmer nachstellten, mit Fotokopien der von ihnen mittlerweile verkauften Gemälde schmückten (kam ja sowieso alles schwarzweiß rüber), Helene Beltracchi mit Rüschenbluse und Häubchen als Großmutter posierte (was offenbar keinem auffiel) und das Ganze mit einer altertümlichen Kamera festgehalten wurde.
Zum Verhängnis wurden den beiden schließlich Fehler beim Material: Eine Farbtube, auf der »Zinnweiß« stand, enthielt in Spuren ein Titanweiß, das zum fraglichen Zeitpunkt noch nicht auf dem Markt war. Sie fielen am Ende einer Fehldeklarierung zum Opfer. Man wird dieses Endes nicht recht froh. Es ist, als wäre Caesar, statt den Dolchen der Senatoren, einer Lebensmittelvergiftung erlegen. Sie sind über etwas gestürzt, was sich zu ihrem Können rein zufällig verhielt.
⁎
Beltracchi, wie gesagt, ist ein entspannter Typ auch in widriger Lage. Er trägt seinen Anspruch so lässig vor, dass man ihn leicht übersehen kann. Sonst sollten weitere Kunstkreise doch erschrecken. Denn was er zuletzt von sich behauptet, das ist nicht nur, er sei so gut wie die von ihm Nachempfundenen, sondern besser. Man überlege sich, was das bedeutet.
»Rembrandt war auch nicht besser«, hat der 1995 verstorbene Künstler Horst Janssen erklärt. Es war ein Ausruf der Qual gewesen. Wenn man seine aquarellierten Blätter betrachtet, sieht man, was er meint: Er war wirklich ein unwahrscheinlich begabter Zeichner, weit begabter, als seine Zeitgenossen wahrhaben wollten, die ihn vor allem als Exzentriker schätzten. Aber wozu sollte es im 20. Jahrhundert gut sein, wenn einer vollendet das konnte, was dreihundert Jahre früher auf der Höhe der Zeit war? Die Rede ist nicht nur von dem mechanischen Vermögen, von einem anderen fertig etwas zu übernehmen, zu dessen Ausbildung dieser sein ganzes Leben gebraucht hatte – sondern einem echten Talent (was immer man sich darunter genau vorstellen mag). Doch wer es hat, sitzt nach gängiger Auffassung in einem nutzlosen Anachronismus gefangen, ungefähr so, wie wenn heute jemand die steinzeitliche Technik der Klingenherstellung genauso gut beherrschte wie ein Mammutjäger. Die seitherige Entwicklung der Waffen ist über die Klingenindustrie hinweggegangen. Dennoch ist nicht leicht anzugeben, worin genau der Anachronismus denn bestünde, denn im Gegensatz zum technologischen Fortschritt wird ein eigentlicher Fortschritt im Fall der Kunst ja entschieden bestritten. Die Wertschätzung für Rembrandt steht so hoch wie oder höher als vor einem Drittel Jahrtausend. Rembrandt hat damals etwas geschaffen, was bis heute in Ehren besteht. Warum also wäre einer, der so begabt ist wie Rembrandt, darum heute kein Rembrandt mehr?
Hier liegt etwas mit dem Begriff der Tradition im Argen. Sie dauert an bis in die Gegenwart; und doch wird ihr die edelste Frucht versagt, die Tradition zeitigen kann, nämlich die Fähigkeit, neue Werke ihresgleichen hervorzurufen. Solche Tradition soll zwei Eigenschaften haben, die sich nur schwer vereinbaren lassen: Lebendig soll sie sein, aber doch auch abgeschlossen – wo sich doch nur im Offenen das Lebendige vollzieht.
Diesen Widerspruch hat Janssen als seine persönliche Tragik ausbaden müssen. Der Fall Beltracchi ist nicht tragisch, aber krasser. Sein Wirken trägt statt dessen Züge der Komödie, ja der Satire. Es wird in der individuellen Zuspitzung exemplarisch eine Gesamtlage sichtbar, mit den Affekten des Schmerzes für die unmittelbar Betroffenen, des Schrecks bzw. der schadenfrohen Erheiterung für die Allgemeinheit. Erheiterung und Schreck verhalten sich dabei komplementär zueinander und haben durchaus im selben Bewusstsein Platz. Der Sachverhalt, den Beltracchi zum Vorschein gebracht hat, lautet: Es gibt kein einziges Merkmal des Kunstwerkhaften in der Kunst, das sie mit Sicherheit als Kunst beglaubigt – solang man unter Kunst um jeden Preis etwas Originales verstehen will. Der emphatische Begriff des Originals wird sich nach Beltracchi möglicherweise nicht mehr halten lassen. Vielleicht werden die Namen der Künstler wieder hinter den Werken versinken wie bei den mittelalterlichen Dombauhütten. Schwer vorstellbar, dass vom Bamberger Reiter zwei Generationen nach seiner Fertigstellung eine »Fälschung« in Umlauf geraten wäre, aus dem einfachen Grund, weil es nichts daran gab, was sich fälschen ließ. (Schule gemacht hat er natürlich trotzdem.)
Dass es zum Schluss der Lapsus mit der falschen Farbtube war, der den Nach- und Weiterschöpfer zu Fall brachte, kann darüber nicht hinwegtäuschen. Beltracchis Enttarnung hat die Geschlossenheit der betreffenden Werke auf kontingentem Weg wiederhergestellt. Er konnte verhaftet und verurteilt werden; widerlegt ist er nicht. Im Prozess ging es um vierzehn Gemälde, weitere rund fünfzig hat er zugegeben; aber er schätzt, dass in den Museen und Sammlungen immer noch rund zweihundertfünfzig seiner Schöpfungen hängen. Warum hat er, da er schon am Gestehen war, nicht auch sie identifiziert?
Ganz einfach, sagt er: Es hat ihn keiner danach gefragt. Ein Versehen war das wohl nicht. Müsste man auch alle diese Bilder »abschreiben«, wie der bezeichnende Ausdruck sowohl im Banken- als auch im Kunstwesen lautet, entstünde leicht ein Schaden, den man sich am besten so vorstellt wie im Film »Batman«, wo der Joker eine Milliarde Dollar in großen Scheinen verbrennt. So weit wollten es offenbar weder Justiz noch Kunstbetrieb kommen lassen. Es genügte ihnen, die sprudelnde Quelle zu verstopfen, um die weitere Verwässerung des Kunstwerts prinzipiell zu verhindern; das bereits angefüllte Reservoir auszuschütten aber wäre ein zu großer konkreter Verlust gewesen. Diese Bilder also hängen weiterhin in den Galerien der Welt, rechte Kuckuckskinder, die keiner von den echtbürtigen unterscheiden kann und jeder genauso liebt wie die eigenen – solang, bis er eines Tages entsetzt dahinterkommt, wer sie wirklich gezeugt hat. Beltracchis Bomben ticken weiter, und kein Mensch weiß, ob und wann sie hochgehen werden.
⁎
So etwas wie, dass Rembrandt auch nicht besser war, würde Beltracchi nicht sagen. Er deutet vielmehr an, dass Rembrandt an ihn nicht heranreicht; er tut es indirekt, wenn er von der Leichtigkeit, ihn zu fälschen, spricht. Beltracchi übertrifft in der Tat auf zweierlei Weise die Künstler, deren Werk er erweitert hat.
Zum einen ist die, man darf ruhig sagen, wissenschaftliche Reflexion an seiner Tätigkeit beteiligt, wie es sonst bei bildenden Künstlern höchst selten geschieht – ein Beispiel dafür gibt sein Kommentar über das Werk von Campendonk; und sie wird bei ihm direkt schöpferisch, was nun wiederum den Kritikern und Historikern versagt zu bleiben pflegt. Zum anderen musste jeder dieser Künstler gemäß vorherrschender romantischer Meinung ja immer nur er selbst sein, eine Leistung, die zweifellos noch dem Unbegabtesten ohne Anstrengung gelingt. Beltracchi aber vermag durch einen Willensakt in jeden einzelnen von ihnen hineinzuschlüpfen; er ist, einer nach dem anderen, sie alle zusammen. Wenn jeder andere Künstler sich damit bescheiden muss, gemäß seiner Anlage nur entweder Löwe oder Nachtigall oder Reh sein zu können (denn der wahre Künstler ist ein Naturphänomen), ist Beltracchi Reh, Nachtigall und Löwe zugleich und Zoologe noch obendrein.
Dieses Vermögen hat viele Zeitgenossen verärgert. Wenn man es charakterisieren will, ohne sogleich in die Verleumdung zu verfallen, bietet sich als Analogon am ehesten die Schauspielkunst an. Auch der Schauspieler bezieht sich auf ein Werk, das ein anderer bereits geliefert hat, in seinem Fall der Bühnendichter, und hantiert mit ihm, indem er eine Rolle übernimmt. Diese Rolle ist pro Drama jeweils eine, aber im nächsten Stück kann es schon wieder eine ganz andere Rolle sein, die er einstudiert; man schätzt ihn geradezu entsprechend seiner Fähigkeit, sich in Verschiedenstes hineinzufinden. Solches Rollenspiel folgt eng dem vorgegebenen Text, muss aber durchaus als eine Kunst eigenen Rechts gewürdigt werden; sie verhilft einem fossilisierten Schatz zum Leben. Hierzu ist es erforderlich, dass der Schauspieler den Schein erzeugt, er sei, obwohl er sie ganz augenscheinlich dennoch bleibt, nicht diejenige bürgerliche Person, deren Name in seinem Pass steht, sondern ein ganz anderer – ein König zum Beispiel, der seit Jahrhunderten tot ist, oder ein Feenwesen, das nie gelebt hat. Er muss sein Publikum dazu bringen, dass es ihm die Transformation glaubt. Es ist ein offener und insofern ehrlicher, ein allgemein akzeptierter Schein, während der Kunstfälscher (und hier endet die Analogie) seinen Schein nur um den Preis der Verhehlung entfaltet. Hier zahlt, anders als auf dem Theater, das Publikum nicht dafür, dass es getrogen wird, sondern weil es sich im Besitz einer unmittelbaren Realität wähnt; nicht als gläubiges konstituiert es sich demnach, sondern als leichtgläubiges. Und doch verschafft des Akteurs nachschöpferisches Werk dem ganzen Umkreis der Kunst Gegenwart in der Performanz. Er verwandelt einen Bestand in eine Bewegung.
⁎
Es ist das Unglück des großen Fälschers, dass der Schein, der in der Welt des Theaters als Rolle und in der Welt der Finanz als Spekulation auf eine ungewisse Zukunft seine Legitimität besitzt, sich bei ihm immer nur als Betrug vollziehen kann. Genau wie die beiden anderen Systeme arbeitet auch das seine auf Kredit – nur dass es ihm verwehrt ist, von dessen schwindelnder Flugbahn wieder auf den Boden des Reellen heimzukehren. Seine Geschosse entschwinden ins Blaue hinein und kommen, sofern überhaupt, nur per Absturz zurück. So ist seiner satirisch-dramatischen Tätigkeit doch unvermeidlich ein Zug des Traurigen und des Hässlichen beigemischt. Ja, Herr Beltracchi ist ein Krimineller, und es fiele mir nicht ein zu verlangen, dass ihm seine Haftstrafe erlassen würde. Die Betroffenen mögen habgierig gewesen und am Ende nicht der Verarmung anheimgefallen sein, der Betrug selbst ein feiner und hoher: Doch am Ende teilt er den Stoff, aus dem er besteht, mit den gröberen Delikten, die nach demselben Paragraphen geahndet werden. Mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Beltracchi ist rechtskräftig verurteilt und hat seine Strafe abgesessen; damit ist das Nötige geschehen, und weitere Empörung auf eigene Rechnung zu mobilisieren (wie es manche Interviewer getan haben), erscheint mir entbehrlich.
Wichtiger ist mir ein anderer Gesichtspunkt: Wie Beltracchi in unenttarntem Zustand zum Wohltäter des Betriebs wurde, so erweist er sich nach seiner Enttarnung zuletzt als der Wohltäter der Kunst. Zuerst und zum allermindesten hat er gewissermaßen einen Test-Einbruch ins System vollbracht, bei dem die Alarmsicherung komplett versagt hat; auch seine ärgsten Widersacher werden zugeben, dass sie bei dieser Gelegenheit etwas Nützliches gelernt haben.
Zweitens hat er der zum Kitsch geronnenen, der falschen Hoch- und Höchstschätzung der Kunst einen kalten Guss verpasst. Solche Schätzung fußt auf einer gedankenlosen Identifikation von Persönlichkeit und Werk; diese Einheit hat Beltracchi mit einem schmerzlichen Ruck auseinandergerissen. Von nun an wird man immer mit der Möglichkeit zu rechnen haben, dass ein gutes Bild seine Weihen nicht vom Seelenzustand des malenden Schmerzensmanns empfangen hat, sondern allein von den Pinselstrichen, aus denen es sich zusammenfügt. Dazu hat Beltracchi gezeigt, wie man die Probleme der Provenienz umgeht. Im Weinkeller des Kunstgenusses hat er gewissermaßen die Etiketten von den Flaschen abgelöst und zwingt nun alle, die für Kenner und Genießer gelten, zur Blindverkostung – eben jenem Vorgang, bei dem sich die Urteilskraft unmittelbar und unbestochen zu bewähren hat: Bei seinen Geschmacksurteilen kann sich künftig niemand mehr auf das Schildchen verlassen, das mitteilt, wo das Hochgewächs herstammt, sondern es muss ein jeder angeben, wie es ihm tatsächlich mundet. Beltracchi veranlasst die Freunde der Kunst, vom Modus der Verehrung auf den der Betrachtung und Erfahrung umzuschalten. Da fallen denn angestammte Kenner und Liebhaber reihenweise auf die Nase. Recht so.
Drittens und vor allem hat er damit dem Tauschwert der Kunst einen Nasenstüber verabfolgt. Wenn man sich nicht mehr sicher sein kann, ob man da eigentlich ein echtes oder bloß ein gutes Bild vor sich hat, wird die Bereitschaft, exorbitante Summen zu zahlen, vielleicht doch zurückgehen. Denn für den bloßen Kunstgenuss wird man am Ende nicht so viel bezahlen, wie wenn man ein Spekulationsobjekt erwirbt, das am Kunstwerkhaften lediglich seine obskure Voraussetzung hat, insofern damit für die absolute Knappheit gebürgt ist. Um noch einmal den Vergleich mit dem Wein zu bemühen: Wenn nur noch der Geschmack zählt, wird man für eine wirklich gute Flasche Bordeaux vielleicht noch hundert Euro hinlegen, aber nicht mehr zehntausend.
Zu hoffen wäre, dass Beltracchis Aktivität als Korrektiv auf den Kunstmarkt einwirkt: Der Druck der überhöhten Preise führt dazu, dass die Fälschung lohnend wird, das Ventil öffnet sich, ein Teil des Dampfs tritt aus, und der Kessel wird vor der Explosion bewahrt. Der Fälscher hat im kybernetischen Ganzen der Kunst durchaus seine konstruktive, nämlich eine mäßigende Aufgabe.
Fasst man das Gesamtbild ins Auge, wird man weder gegen die Strafe für die Beltracchis etwas einzuwenden haben, noch gegen deren offenen Vollzug. Ihre astronomischen Schulden (acht Millionen Euro sollen es sein) werden sie kaum bedienen können, wenn man Wolfgang Beltracchi nicht in der einen oder anderen Form wieder das Malen erlaubt. Er hat sogar einmal, vor Jahrzehnten, im Münchner Haus der Kunst in eigenem Namen ausgestellt. Was er wirklich konnte, scheint damals nicht recht zum Zuge gekommen zu sein; jedenfalls hat er diese Linie nicht weiter verfolgt.
⁎
Wäre ich ein Geschädigter, ich hielte es folgendermaßen: Ich würde öffentlich darüber lachen, dass ich der Angeschmierte bin, denn zum Schaden muss der Spott nicht auch noch kommen. Dann lüde ich den Fälscher ein, gegen eine kleine Unkosten-Pauschale in Höhe von sagen wir fünftausend Euro und mit möglichst großer Beteiligung der Medien, auf dem angeblichen Derain-Gemälde, das er mir damals untergejubelt hat, den Namenszug Derains durchzustreichen und statt dessen schwungvoll drüber zu setzen: »Beltracchi«. Dann wäre ich bis auf weiteres der einzige Besitzer einer authentifizierten Fälschung dieses Mannes.
Wahrscheinlich aber kämen schon sehr bald andere auf denselben Trichter, mit einem Wort: Es würde sich ein Markt entwickeln. Wer weiß, zu welchen Notierungen er es brächte, die Preise könnten in die Höhe schießen, vielleicht bis in die Nachbarschaft der von Beltracchi Nachempfundenen. Es könnte durchaus attraktiv werden, nunmehr ihn zu fälschen, das heißt, die echten Fälschungen durch falsche Fälschungen zu vermehren. Allerdings müsste einer, der das glaubwürdig schafft, ein kaum vorstellbares Hyper-Talent sein, das es hinkriegt, ins Beltracchische Hineinschlüpfen hineinzuschlüpfen.
Ein Experte wie Werner Spies dürfte sich hier endgültig überfordert fühlen. Ja es wäre sogar denkbar, dass, sollte der von Beltracchi so nachdrücklich geförderte Expressionist Campendonk einmal keine Konjunktur mehr haben, sich der Eigentümer eines echten Campendonk-Bildes verlockt fühlt, es als eine Fälschung Beltracchis auszugeben, um dann seinerseits wegen Betrugs im Gefängnis zu landen …
Beltracchi regt in vielerlei Hinsicht zum Nachdenken an. Sein Vermächtnis besteht im Zweifel. Der schadet den Preisen und nützt der Kunst. Er ist ein unentbehrliches Durchgangsstadium auf dem Weg zur Wahrheit. Denn darüber, was die Wahrheit der Kunst sei, herrschen heute mancherlei überhitzte Missverständnisse.
Nachschrift
Dieser Artikel in der Zeitschrift »Merkur« hat die Aufmerksamkeit des Galeristen Curtis Briggs erregt, der Wolfgang Beltracchi vertritt, seit er aus dem Gefängnis entlassen ist und unter eigenem Namen malt. Curtis Briggs bittet mich, eine kleine Rede zur Beltracchi-Pressekonferenz in seiner Schwabinger Galerie zu halten – ein Auftrag, dem ich gern nachkomme. So habe ich Gelegenheit, die Beltracchis auch persönlich kennenzulernen. Mich beeindruckt die absolut solidarische Liebe des Paars, die sich in jeder Kleinigkeit ausdrückt. Die blondgrauen Mähnen der beiden, die auf Bildern zuweilen etwas wie aus der Zeit gefallen wirken, vereinen sich im Leben zu einer silbernen Doppelaura. Am Vorabend beim gemeinsamen Dinner trägt Beltracchi ein Outfit, das ihn höher dünkt als jeder Smoking: ein von ihm selbst gefertigtes T-Shirt, das ihn als Figur bei den »Simpsons« zeigt. In dieser Zeichentrickserie nämlich durfte seine Persona auftreten, natürlich mit der üblichen gelbgesichtigen Stilisierung. Das ist ein globaler Ritterschlag, wie ihn selbst der globale Kunstmarkt nicht zu spenden vermag. Allerdings hat er das aus dem Internet übernommene Originalbild ein wenig in seinem Sinn abgeändert: Er hat die Locken seines Alter Ego verlängert, so dass er sich in ihm leichter wiederzuerkennen vermochte. Eine kleine, eine harmlose Verfälschung, ein bisschen wie in Offenbachs Operette »Die Prinzessin von Trapezunt« die Artistengruppe, die in der Lotterie gewinnt und keine Kunststücke mehr für die Öffentlichkeit vollführen muss – aber nachts schleicht der Feuerfresser zum Ofen, um heimlich ein paar glühende Kohlen zu naschen …
Ich halte meine kleine Rede, zehn Minuten vielleicht. Beltracchi meint, die sei für ihn wie ein Geburtstagsgeschenk, was mich sehr freut. Die anwesenden Journalisten stellen insgesamt nicht sehr inspirierte Fragen. Sie neigen stark zum Moralisieren und finden Beltracchi, obwohl er jetzt offensichtlich ehrbar geworden ist, nicht so reumütig, wie sie sich das vorgestellt hätten. Er vermasselt ihnen das vorgefasste Skript. Ob das Leben denn nicht viel leichter und froher sei, jetzt, wo er einen Schlussstrich gezogen habe? Nein, bescheidet Beltracchi den Frager, früher habe er erstens Geld und zweitens seine Ruhe gehabt; jetzt habe er weder noch. Eine junge Journalistin, die wissen will, ob und wann er denn zu einem eigenen Werk durchdringen wolle, fertigt er unwirsch ab: Sie habe ja wohl eine Stunde hundsmiserabel zugehört. Sie wird rot und trotzig, schweigt aber.
Und was sind es für Bilder, die man hier sieht? Ein bösartiger Kommentar, der am nächsten Tag erscheint, verkündet: Der kopiert ja noch immer! Aber das stimmt nicht. Weder hat Beltracchi je kopiert, noch tut er das Gleiche wie zuvor. Er beweist seine hohe Kunst, die sich mit der Vielfalt der Tradition auseinandersetzt. Doch hat er von der Drohung abgelassen, die seine Tätigkeit für den Markt bedeutet hat; ein Pirat, der immer noch so schnell springen und schießen kann wie eh und je, aber nunmehr davon absieht, seine Waffe den Pfeffersäcken aufs Herz zu richten. Das führt natürlich zu gewaltigen Preiseinbrüchen: Ein echter Beltracchi erzielt nur ungefähr ein Prozent des Preises wie ein fälschender. Das wären so um die fünfzigtausend Euro. Dieser den Künstler demütigende Tiefstand bezeugt vor allem die lernunfähige Verstocktheit eines gierigen Markts, dem die nächsten Enttäuschungen in Form von enttarnten Nachschöpfungen wohl schon bald bevorstehen. Ich finde Beltracchis Bilder gut und in jenem konservativen Sinn gelungen, wie ein Kunstwerk es sein sollte, das sich wahrhaft ins Reich der Kunst einschreiben will. Dieses ist gewiss ein schwankendes Kontinuum und noch gewisser ein von Grund auf amoralisches, insofern Kunst zu jeder Zeit den Herrschenden nach dem Mund geredet hat. Interessant wird solche Kunst dann, wenn die auftraggebenden Machthaber zu Staub zerfallen sind, wie sie es zuletzt immer tun: Hält ihr Gewölbe aus eigener Kraft, wenn die Gerüste abgezogen sind? Mein Lieblingsbeispiel ist immer das Deckengewölbe des göttlichen Tiepolo im Treppenhaus der Würzburger Residenz. Kommissioniert wurde es als Triumph des Würzburger Fürstbischofs über die vier Weltteile, ein Thema, das heute niemanden mehr vom Hocker reißt. Aber dieses Deckengemälde, übrigens das größte der Welt, ist längst hinausgewachsen über das Ländchen des Bischofs, der es bezahlt hat. Riesenhaft prangt es über den Köpfen seiner nunmehr demokratischen Besucher.
Seine aktuelle, katalysatorische Rolle hat Beltracchi desungeachtet verloren. Indem seine Bilder, in eigenem Namen signiert, nur mehr als kostenneutrale Mahnmale zu wirken vermögen, hat er es aufgegeben (aufgeben müssen), den verkehrten, total verrückt gewordenen Markt dort zu beißen, wo es ihm weh tut: ins Geld. So scheint sein neues, »ehrliches« Werk zum Vergnügen seiner spießigen Feinde in die Bedeutungslosigkeit abzugleiten. Wo doch jedes dieser Bilder verkündet: Er kann malen! Und zwar so gut, dass ihr den Unterschied nie herausfindet.
Beltracchi, der um jeden Preis Geld herbeischaffen muss, hat sich derweil eine besondere Nische gesucht: Er malt, dokumentiert vom Fernsehen, Prominente im Fernsehen, von Günther Jauch bis Gloria von Thurn und Taxis, jede Woche eine(n) anderen, im Stil der gemeinsamen Wahl. Das zahlt seine Rechnungen und schafft ihm Aufmerksamkeit. Aber schade ist es doch auch, dass er auf diese Weise seine Kunst, die von Haus aus eine echte und ernste, eine traditionsbewusste ist, an die bloß schrille Zeitgenossenschaft vergeudet.