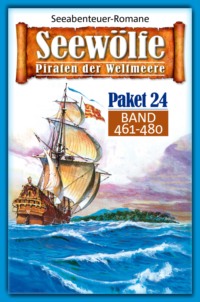Kitabı oku: «Seewölfe Paket 24», sayfa 22
O’Leary tobte unterdessen wie ein Besessener in seiner Zelle herum. Es hatte wirklich den Anschein, als wolle er zur Rebellion aufrufen.
„An den Galgen mit dem Hund!“ brüllte er. „Er ist ein Pirat! Sie sind alle Piraten! Ich will zum Kommandanten!“
„Jawohl, zum Kommandanten!“ heulte Thomas Lionel, der sich von den Peitschenhieben einigermaßen wieder erholt hatte.
„Man höre uns an!“ schrie sein Bruder Simon Llewellyn mit spitzer Stimme.
Die Wärter rückten an. Sie bauten sich vor den Zellentüren auf, stießen wüste Drohungen aus und ließen ihre Peitschen durch die Luft pfeifen. Aber auch das nutzte nichts.
O’Leary witterte eine Chance, sich gewissermaßen freikaufen zu können, wenn er Jean Ribault als Kumpan des Seewolfs belastete. Diesen Plan verfolgte er und ließ nicht mehr davon ab. Was waren schon ein paar Hiebe der Wärter? Er brüllte weiter und heizte damit nicht nur die Aufruhrstimmung bei seinen eigenen Kumpanen an, sondern auch bei den Gefangenen in den anderen Zellen des Kerkers.
So wirkte die Toberei gleichsam ansteckend auf die Hafenstrolche, die Langfinger und Beutelschneider, die im Gefängnis von St. Augustine einsaßen. Sie sprangen in ihren Zellen herum, fluchten, schrien und schlugen mit ihren Näpfen und Bechern gegen die Gitter.
Das erzeugte einen wahren Teufelslärm. Die Kerle ließen ihrer dumpfen Wut, im Kerker wegen irgendwelcher „Lappalien“ gefangen zu sein, freien Lauf. Mit ihrer Brüllerei brachten sie die Kerkerwände zum Zittern.
Die Wärter rissen die Zellentüren auf und droschen mit Peitschen auf die Gefangenen ein. Soldaten rückten nach und verstärkten sie.
Aber O’Leary leistete erbitterten Widerstand. Er packte eine der Peitschen, zerrte daran und riß den Wärter, der ihn verprügelte, auf diese Weise dicht zu sich heran.
„Bring mich zum Kommandanten!“ brüllte er. „Ich hab’ ihm was zu melden, du Hund!“
Aber zwei andere Wärter, bullige Kerle mit Stöcken, fuhren dazwischen. Sie befreiten ihren Dienstkollegen und hieben auf O’Leary ein. O’Leary brach unter einem Hagel von Schlägen zusammen.
„Ihr Schweine!“ heulte Thomas Lionel.
Einer der Wärter drosch ihm seinen Stock auf die Schulter, und Thomas Lionel brach jammernd zusammen. Er fiel auf seinen Bruder, der sich vorsorglich schon hingeworfen hatte.
Dann waren die anderen Kerle der Sir-John-Crew an der Reihe. Sie warfen sich zwar den Wärtern entgegen, doch sie hatten gegen Stöcke und Peitschen nicht die geringste Chance.
Ganz in die eine Ecke der Zelle zurückgewichen waren Sir James und die sechs anderen hochwohlgeborenen Nichtstuer. Als die Wärter drohend auf sie zumarschierten, hob Sir James mahnend den Zeigefinger.
„Ich weise Sie darauf hin, daß wir an dieser Revolte nicht teilgenommen haben, meine Herren“, sagte er mit bebender Stimme.
„Was quatscht der Kerl?“ fragte einer der Wärter.
„Ich versteh’ nichts“, entgegnete sein Nebenmann. „Aber ich glaube, die brauchen wir nicht zu vertrimmen. Die haben sowieso schon die Hosen voll.“
Ein letzter Sir-John-Kerl brach unter einem wuchtigen Stockhieb zusammen, dann herrschte in dieser Zelle Ruhe. In den Nachbarzellen ertönten immer noch Flüche, Schreie und Hiebe, aber auch dort schien es allmählich stiller zu werden. Die Wärter rückten ab, warfen die Türen krachend zu und riegelten sie ab.
Sir James Sandwich atmete auf und strich sich mit der Hand durch die Haare.
„Freunde, das habt ihr nur meinem mutigen Einsatz zu verdanken“, sagte er. „Sonst hätten uns diese gräßlichen Menschen nämlich auch gezüchtigt.“ Voll Verachtung, aber auch mit Schadenfreude blickte er auf O’Leary, die Crew und die Ferkel-Brüder, die am Boden lagen. O’Leary und einige andere waren ohnmächtig und bluteten aus Platzwunden.
Die Männer um Renke Eggens indes blieben ungeschoren, weil sie sich ruhig verhielten. Auch Jean Ribault wurde nicht behelligt. Er hockte in seiner Einzelzelle und überlegte, wie er sich bei dem Verhör, zu dem er sicherlich bald abgeholt werden würde, am besten verhalten sollte.
Don José de Zavallo hastete die Treppe hinauf und stieß auf den oberen Stufen mit dem Posten des Kommandanten zusammen.
„Verdammter Idiot!“ schrie er ihn an. „Kannst du nicht aufpassen?“
„Verzeihung, Señor Teniente“, sagte dieser.
„Also, was hast du hier zu suchen?“
„Der Kommandant will wissen, was los ist“, erwiderte der Soldat.
„Das werde ich ihm melden“, sagte de Zavallo.
Er stieg die letzten Stufen hoch, trat ins Freie und marschierte über den Festungsinnenhof. Der Soldat folgte ihm.
Selbstverständlich ging es dem Teniente nicht nur darum, Don Lope de Sanamonte über die Hintergründe der Kerkerrevolte aufzuklären. Er wollte auch seine eigene Rolle ins rechte Licht rücken. Natürlich war es sein, de Zavallos, Verdienst, daß sofort wieder Ruhe und Ordnung eingekehrt waren.
Don Lope de Sanamonte blickte Don José de Zavallo an, als dieser vor ihn hintrat.
„Nun reden Sie schon“, sagte er. „Wen haben Sie mir da eigentlich angeschleppt? Verrückte?“
Alles, was die Sicherheit von St. Augustine bedrohte, mußte seiner Ansicht nach beseitigt werden. Es durfte keine Risikofaktoren geben. Nach dem Überfall des gefürchteten Schnapphahns Mardengo war de Sanamonte im übrigen dazu übergegangen, die Festungsarbeiten voranzutreiben.
Dazu benutzte er unentgeltliche Arbeitskräfte, nämlich die im Kerker einsitzenden Gefangenen. An diesem Morgen waren sie wegen des Neuzugangs der deutschen Seefahrer noch nicht zur Arbeit abgerückt, anderenfalls wären sie längst draußen beim Graben gewesen.
Zur Zeit war es die Aufgabe der Gefangenen, die Landseite, die nach Westen zu den Sümpfen wies, auszuheben. Dort sollte ein breiter und tiefer Wehrgraben ausgeschachtet werden, so daß St. Augustine zur Inselfestung wurde. Das war eine mörderische Arbeit, weil der Boden zum größten Teil sumpfig und morastig war. Aber wen kümmerte schon, wenn der eine oder andere bei der üblen Schufterei sein Leben ließ? Es war letztlich doch eine gerechte Strafe.
De Zavallo berichtete – de Sanamonte lauschte aufmerksam. Als der Teniente ihm erklärte, daß einer der englischen Gefangenen, der frühere Bootsmann O’Leary, in einem Mann des Neuzuganges einen Kumpan des Piraten Killigrew erkannt hätte, horchte er auf.
„Und wie äußert sich der neue Gefangene dazu?“ fragte er.
„Er streitet die Beschuldigung ab und behauptet, seit Jahren als Erster Offizier für ein deutsches Handelshaus zu fahren“, erwiderte der Teniente. „Als solcher ist er allerdings auch an Bord der beschlagnahmten deutschen Karavelle gewesen. Nun, wie dem auch sei, es hat wegen O’Learys Brüllerei fast einen Aufstand gegeben. Wer weiß, was die Kerle noch alles angestellt hätten, wenn ich nicht sofort dazwischengegangen wäre.“
„Ja, schon gut. Wem darf man nun Glauben schenken, dem Deutschen oder dem Engländer?“
„Señor“, sagte de Zavallo. „Ich erlaube mir den Vorschlag, den O’Leary noch einmal verhören zu lassen und diesem Ersten Offizier der ‚Goldenen Henne‘ auf den Zahn zu fühlen.“
„Wie heißt der Mann?“ fragte der Kommandant.
„Der Deutsche? Jan Rebau – oder so ähnlich. Ich kenne mich mit dieser verflixten Sprache ja nicht aus.“
De Sanamonte hob den Kopf. „Wie war das? Ribau? Ribo? Ribault?“
De Zavallo konnte nur mit den Schultern zucken.
„Das ist verdächtig“, sagte Don Lope de Sanamonte. „Jean Ribault – das ist kein deutscher, sondern ein französischer Name. Besteht die Besatzung dieser Karavelle nicht ausschließlich aus Deutschen?“
„Bis auf den Bastard.“
„Welchen Bastard?“
„Den Indianermischling“, erwiderte de Zavallo. „Der Kapitän behauptet, er sei der Lotse, aber das glaube ich nun wieder nicht. Ja, Sie haben recht, Señor, es ist einiges faul an diesen Deutschen.“
Don Lope brauchte im übrigen nur den Namen Killigrew zu vernehmen, und schon sah er rot. Innerlich war er aufgewühlt genug. Was steckte hinter diesen Vorgängen? Bereiteten irgendwelche Schnapphähne unter dem Oberkommando des Killigrew-Halunken neue Anschläge vor? Auf St. Augustine? Das mußte er herausfinden – mit allen Mitteln.
„Gut“, sagte der Kommandant. „Holen Sie mir als ersten diesen O’Leary, Teniente. Aber denken Sie daran, ihn schwer bewachen zu lassen. Er ist bekannt für seine Gewalttätigkeiten.“
„Ja, Señor“, sagte de Zavallo. Er zeigte klar und verließ den Raum. Hatte er das nicht prächtig hingekriegt? Der Kommandant hatte sogar den Verdacht bestätigt, den er, de Zavallo, von Anfang an gegen diese deutschen Kauffahrer gehegt hatte.
Wenn sich jetzt noch herausstellte, daß sie in Wirklichkeit Piraten waren – nicht auszudenken! Er, der Teniente, hatte dann ein Komplott verhindert, einen Angriff auf St. Augustine!
Diese und ähnliche Gedanken begleiteten Don José de Zavallo bei der Rückkehr in den Kerker. Er gab seine Befehle und ließ O’Leary aus der Zelle holen. Noch war der Kerl bewußtlos. Aber ein Kübel eiskalten Wassers, das ihm einer der Wärter ins Gesicht klatschte, beendete seine Träume.
O’Leary fuhr hoch und verzog wegen der Schmerzen sein Gesicht.
„Was ist?“ fragte er dumpf.
„Das wirst du gleich sehen“, entgegnete de Zavallo. Er bedeutete seinen Soldaten mit einer Geste, daß sie O’Leary aufrichten sollten. Die Männer packten ihn und stellten ihn auf die Beine, dann zerrten und stießen sie ihn fort – vier Soldaten und drei Wärter, die ihn keinen Moment aus den Augen ließen.
De Zavallo schritt hinter ihnen her, seine Miene war überheblich und triumphierend. Jetzt würde man ja erfahren, was es mit der Behauptung des Engländers auf sich hatte.
Und sollte die Wahrheitsfindung schwierig werden, dann würde das peinliche Verhör den Hunden die Zunge lösen, entweder diesem O’Leary oder dem deutschen Ersten Offizier, der vielleicht doch kein richtiger Deutscher, sondern möglicherweise ein Franzose war. Oder ein englischer Pirat? Wie auch immer, es mußte sich jetzt herausstellen.
Don Lope de Sanamonte empfing den ganzen Trupp in seinem Arbeitsraum. Die Wärter und Soldaten nahmen O’Leary in die Mitte, damit er ja nicht auf den Gedanken verfiel, dem Kommandanten etwa an die Gurgel zu springen. De Zavallo stand breitbeinig da und hatte die Hand auf dem Griff seiner im Waffengurt steckenden Steinschloßpistole liegen.
Doch der ehemalige Bootsmann der „Lady Anne“ schien keine kämpferischen Absichten zu hegen. Nachdem ihm die Wärter in der Mangel gehabt hatten, sah er reichlich zerbeult und zerschrammt aus. Mit etwas gesenktem Kopf stand er da und musterte sein Gegenüber.
Auch der Dolmetscher war eingetroffen. Er mußte jedes Wort übersetzen, da O’Leary ja des Spanischen nicht mächtig war und Don Lope wiederum kein Englisch konnte.
„O’Leary“, sagte Don Lope, nachdem er den Bootsmann eingehend betrachtet hatte. „Du hast versucht, eine Gefängnisrevolte anzuzetteln. Weißt du, welche Strafe darauf steht?“
„Ich kann mir das denken“, erwiderte O’Leary, als der Dolmetscher für ihn ins Englische übersetzte, was der Kommandant sagte. „Aber ich habe keine Meuterei anzetteln wollen. Das ist nicht wahr. Ich will nur meine Rechte geltend machen.“
„Rechte?“ wiederholte Don Lope höhnisch. „Was für Rechte hat ein gefangener Engländer auf spanischem Herrschaftsgebiet?“
„Das Recht, die Wahrheit über alle Hundesöhne und Piraten auszusagen, die diese Küsten bedrohen“, entgegnete O’Leary. „Dieser eine Kerl, den die Soldaten heute früh angeschleppt haben – ich hab’ in ihm einen Kumpan des Killigrew wiedererkannt, jawohl, des Seewolfs. Ich schwöre Stein und Bein, daß es die Wahrheit ist, Herr Kommandant.“
„Also ist er kein deutscher Handelsfahrer?“ fragte Don Lope.
„Daß ich nicht lache!“ stieß O’Leary höhnisch hervor. „Der und ein harmloser Kauffahrer? Ich werd’ nicht wieder! Er ist ein Galgenstrick, ein skrupelloser Pirat! Er ist sogar derjenige gewesen, der als Kapitän mit der gekaperten ‚Lady Anne‘, dem Schiff des erschossenen Sir John, davongesegelt ist, wahrscheinlich zum Schlupfwinkel dieser Piratenstrolche. Sie kennen ja unsere Geschichte, nicht wahr, Herr Kommandant?“
„Ja, ja, schon gut“, sagte Don Lope. Er hatte diese Geschichte der „Schiffbrüchigen und Versprengten“ der „Lady Anne“ ja oft genug vernommen, insbesondere aus dem Mund des Sir James. Er hatte keinerlei Interesse, sie schon wieder zu hören. „O’Leary“, sagte er. „Ich höre das sehr gern. Aber wo sind die Beweise? Behauptungen kann jeder aufstellen.“
„Es sind keine Behauptungen“, sagte O’Leary. „Es ist die reine Wahrheit, nichts als die Wahrheit.“
„Du lügst nicht, um Vorteile für dich herauszuschinden?“ fragte Don Lope lauernd.
„Das würde ich nie tun!“ stieß O’Leary empört hervor. „Ich weiß, was ich sage. Und jeder aus der Crew kann meine Aussage bestätigen! Selbst unter der Folter könnte ich nichts anderes aussagen!“
„Gut“, sagte Don Lope. Er hob die Hand und gab dem Teniente einen Wink. „Abführen. Er wird in den Nebenraum gesperrt und streng bewacht.“
„Ja, Señor“, sagte de Zavallo.
„Und Sie holen mir den anderen Mann“, sagte der Kommandant. „Diesen Ribo oder Rebau oder wie er heißt.“
O’Leary frohlockte, als die Wärter und Soldaten ihn in den fensterlosen Nebenraum sperrten. Don Lope glaubte ihm – er wollte ihm glauben. Und sehr schnell würde er herausfinden, daß er, O’Leary tatsächlich die Wahrheit gesprochen hatte. Dann war Ribault geliefert.
Und für O’Leary gab es vielleicht eine Vergünstigung. Vielleicht ließen die Spanier, diese Hunde, ihn sogar frei. Als Gegenleistung wäre das durchaus angemessen gewesen, denn über Ribault konnten die Spanier in Erfahrung bringen, wo sich der Schlupfwinkel des Seewolfs befand.
Und wenn Ribault auf der Folterbank nicht zu singen begann, sondern lieber verreckte, würde schon einer seiner Kumpane zwitschern – ganz gewiß sogar.
7.
Als die Soldaten und Wärter ihn aus seiner Einzelzelle holten, konnte Jean Ribault sich ausmalen, was jetzt geschah. Scharfsinn gehörte nicht dazu, das zu erraten. Er schritt zwischen seinen Bewachern zur Treppe und dann die Stufen hinauf.
Es gab keine Gelegenheit mehr, sich mit Renke Eggens und den anderen Kameraden zu verständigen. Aber was sollte er ihnen auch sagen? Daß er nichts verraten würde, war sicher, und mehr konnte ein Mann in seiner Lage nicht tun. Jeder Fluchtversuch war sinnlos. Aus der Festung St. Augustine kam keiner heraus.
Kurze Zeit darauf stand Jean Ribault vor Don Lope de Sanamonte. Er hielt dessen Blick stand und verzog keine Miene.
„Sie sind Jean Ribault“, sagte der Festungskommandant.
Sollte Ribault es leugnen, sich des deutschen Namens bedienen? Nein – etwas sagte ihm, daß es keinen Sinn hatte. Er verließ sich darauf, daß de Sanamonte ihn nicht kennen konnte, deswegen sagte ihm der Name nichts. Er mußte ihn von de Zavallo vernommen haben.
Es war nicht auszuschließen, daß de Zavallo „Jean Ribault“ und „Jan Rebauer“ durcheinanderwarf oder den Namen undeutlich wiedergegeben hatte. Wie auch immer – Ribault spürte instinktiv, daß es besser für ihn war, wenn er zumindest seine Herkunft preisgab.
„Ja“, antwortete er deshalb.
„Franzose?“ fragte Don Lope. „Sie haben doch einen französischen Namen.“
„Allerdings. Ich bin Franzose.“
„Und als solcher fahren Sie auf einem deutschen Schiff?“ fragte Don Lope höhnisch.
„Warum nicht?“
„Angeblich besteht die Mannschaft Ihres Schiffes nur aus Deutschen“, sagte Don Lope mit einem Blick zu Don José de Zavallo. „Was ist daran nun wahr oder unwahr?“
„Wir arbeiten alle für das deutsche Handelshaus von Manteuffel“, erwiderte Jean Ribault. „Unser Schiff, die ‚Goldene Henne‘, kommt aus Kolberg, unser Ziel ist Havanna.“
„Ja. Und Sie haben ein Indianerhalbblut bei sich“, sagte der Kommandant.
„Unser Lotse.“
„Ein Bastard?“
„Ich weiß nicht, was Sie mit diesem Wort bezwecken“, sagte Jean Ribault. „Wenn Sie es als spanischer Edelmann für nötig halten, unsere Leute zu beschimpfen – bitte.“
„Wie heißt der Lotse?“ wollte Don Lope wissen.
„Karl von Hutten.“
„Das ist ein deutscher Name“, stellte Don Lope fest. „Ein Mischling mit einem deutschen Namen. Kaum zu fassen. Übrigens sprechen Sie gut Spanisch, Señor Ribault.“
„Nicht sehr gut.“
„Besser, als ich angenommen habe“, sagte der Kommandant. „Also, ich stelle der Ordnung halber noch einmal fest: Die Mannschaft Ihres Schiffes ist gemischt und besteht nicht ausschließlich aus reinblütigen Deutschen. Einer der Nicht-Deutschen sind Sie, Señor, ein Franzose.“
„Stimmt“, sagte Ribault. „Ich bin Hugenotte.“
Don Lopes Miene verfinsterte sich. „Ein Ketzer!“ zischte er.
Ribault zuckte nur mit den Schultern. „Darüber habe ich eine andere Auffassung, Señor. Vor allem jedoch vertrete ich die Ansicht, daß es jedem selbst überlassen bleiben muß, welcher Religion oder welchem Glauben er anhängt.“
„Da irren Sie sich aber, Señor!“ stieß Don Lope leidenschaftlich hervor. „Es gibt nur einen Gott, und das ist der Gott der Katholischen Kirche.“
Jean Ribault lächelte dünn. „Daß es nur einen Gott gibt, ist durchaus richtig. Den Rest können Sie vergessen, Señor. Ihre Kirche kann nicht den Anspruch erheben, die allein gültige zu sein.“
„Sie versündigen sich!“ fuhr Don Lope ihn an.
„Noch etwas“, sagte Jean Ribault unbeirrt und gelassen. „Vor Gott sind alle Menschen gleich. Das scheinen Sie vergessen zu haben, als Sie von Bastarden gesprochen haben. Und auch Ihren Landsleuten scheint diese Tatsache zu entgehen.“ Er blickte zu Don José de Zavallo.
„Sie wissen ja nicht, was Sie sagen!“ schrie Don Lope de Sanamonte. Er ereiferte sich derart über die Aussagen seines Gefangenen, daß er das eigentliche Thema vergaß.
Genau das hatte Jean Ribault bezweckt. Don Lope war ein fanatischer Christ, für den der König von Spanien gleich nach dem lieben Gott kam – noch vor dem Papst. Er hatte seine ganz persönliche Art, die zehn Gebote und die Sakramente auszulegen, darin konnte ihn niemand beeinflussen. Wer es versuchte oder anderer Überzeugung war, das war entweder ein Ketzer oder ein Heide.
Es wurde eine richtige Diskussion aus dem „Verhör“.
Schließlich hieb Don Lope mit der Faust auf den Tisch und schrie: „Verdammt, Sie haben mir immer noch nicht erklärt, was Sie auf einem deutschen Schiff zu suchen haben!“
„Wie ich schon sagte, ich bin Hugenotte“, entgegnete Jean Ribault. „Ich bin nach Deutschland emigriert und habe dort, in Kolberg, bei den Manteuffels, angeheuert. Ich bin ein freier Mann, Señor.“
„Jetzt nicht mehr, Hugenotte“, sagte de Sanamonte. „Du bist unser Gefangener.“ Er spürte die geistige Überlegenheit dieses Mannes, und das stimmte ihn rasend. „O’Leary sagt, du seist ein Pirat.“
„Der Mann lügt.“
„Er schwört, daß es die Wahrheit sei.“
„Und Sie schenken ihm Glauben?“ fragte Jean Ribault. „Da hätte ich Ihnen aber mehr Verstand zugetraut.“
„Ich sehe keinen Grund, einem Engländer weniger zu trauen als einem ketzerischen Hugenotten“, erklärte der Festungskommandant kalt. „Hier steht Aussage gegen Aussage. Wer bist du, Franzose?“
„Jean Ribault.“
„Wo ist Killigrew?“
„John Killigrew? Der ist tot, haben die Kumpane dieses O’Leary gesagt.“
„Philip Hasard Killigrew!“ schrie Don Lope. „Der Seewolf.“
„Von dem Mann habe ich noch nie etwas gehört“, erwiderte Jean Ribault eisig. „Wer ist das?“
„Mein Erzfeind“, sagte Don Lope de Sanamonte. „Und ich werde ihn eines Tages stellen und am Hals aufhängen, das schwöre ich.“
„Wenn er ein Schnapphahn ist, wie Sie sagen, dürfte das wohl richtig sein“, erklärte Jean Ribault kaltschnäuzig.
„Señor“, sagte der Teniente. „Dieser Kerl hält uns zum Narren. Soll ich …“
„Ruhe!“ fuhr de Sanamonte ihn an. „Ich weiß selbst, was ich zu tun habe, Teniente!“
De Zavallo biß sich auf die Unterlippe und schwieg. Er hatte keineswegs vor, ins Fettnäpfchen zu treten. Aber warum, zur Hölle, unterzog Don Lope diesen Hurensohn von, einem Hugenotten nicht endlich dem peinlichen Verhör? Dort würde dem Kerl schon vergehen, freche Antworten zu geben.
Don Lope de Sanamonte dachte nach. Er mußte sich zügeln und durfte sich nicht zu sehr verausgaben. Der Mann war ihm geistig überlegen, aber es mußte trotzdem einen Weg geben, ihn zu brechen. Darauf war Don Lope jetzt aus – es diesem Franzosen zu zeigen, ihn weichzuklopfen.
Er wußte aber, daß die sofortige Folter bei einem Kerl wie diesem nicht das richtige Mittel war. Hugenotten waren unendlich stolz. Lieber starb dieser Mann, als auch nur einen Anflug von Schwäche zu zeigen.
Daher mußte man andere Mittel anwenden, um seinen Widerstand zu brechen. Es gab verschiedene Methoden, Don Lope brauchte sich nur eine davon auszusuchen. Das peinliche Verhör wollte er erst später einsetzen – wenn dieser Mann sowieso weich war.
„Gesteh endlich, daß du ein Pirat bist“, sagte Don Lope.
„Ich kann nichts gestehen, das nicht der Wahrheit entspricht“, erwiderte Ribault. „Ich bin Hugenotte und fahre als Erster Offizier auf einem deutschen Handelsschiff, das von Ihnen und Ihren Leuten völlig gesetzeswidrig beschlagnahmt worden ist.“
„Das reicht“, sagte Don Lope de Sanamonte zischend. „Abführen!“
„Wohin?“ fragte Don José de Zavallo. „Zurück in die Kerkerzelle?“
„Zum Grabenbau“, erwiderte de Sanamonte, und dann grinste er höhnisch. „Wir werden schon sehen, wer von uns beiden der Stärkere ist, Hugenotte.“
Ribault blickte ihn verächtlich an. „Geben Sie mir einen Degen, dann zeige ich es Ihnen sofort, Señor.“
„Raus!“ schrie Don Lope. „Weg mit dem Kerl! Ich will ihn nicht mehr sehen!“
Jean Ribault wurde dort eingesetzt, wo beim Grabenbau die stumpfsinnigste Arbeit zu leisten war – beim Ausschöpfen von Schlammwasser in einem abgeschotteten Teilstück. Da das Wasser ständig nachsickerte, wurde gewissermaßen ein großer Tümpel mit einem Sieb entleert. Mit anderen Worten: diese Arbeit würde Wochen, ja, sogar Monate in Anspruch nehmen.
Jean Ribault mußte sich seines Hemdes entledigen. Er arbeitete mit entblößtem Oberkörper. Die Aufseher, grobschlächtige Kerle wie die Gefängniswärter, ließen ihn keinen Moment aus den Augen. Wenn ihnen auch nur eine seiner Bewegungen nicht paßte, hieben sie mit der Peitsche zu.
Jean Ribault war nur ein weiterer Mann in der langen Reihe von Leidensgenossen. Es waren die Hafenstrolche, Langfinger und Beutelschneider, die in den benachbarten Zellen gesessen hatten. Sie sprachen kein Wort mit ihm und versahen schweigend ihre geistlose Tätigkeit. Jeder Mann trug zwei Eimer, die links und rechts an einem Schulterholz hingen.
Zu Beginn hatte es den Anschein, als laste das Holz nicht sonderlich schwer auf den Schultern, auch nicht mit vollen Eimern. Doch Jean Ribault sollte bald erfahren, daß dies nur der erste Eindruck war. Man mußte einmal stundenlang mit einer solchen Last hin und hergelaufen sein, um nachzuempfinden, wie das war: Bald hingen die Arme wie Bleigewichte an seinen Schultern.
Das ausgeschöpfte Wasser wurde in den großen Eimern zu einem breiten Graben getragen und dort hineingekippt. Der Graben befand sich dreihundert Yards ostwärts des zu schaffenden Wehrgrabens und floß in die See.
Die Eimer hatten Eichstriche, so daß von den Wächtern und Aufpassern sofort festgestellt werden konnte, ob Wasser beim Tragen übergeschwappt war. War dies der Fall, dann wurde der Wasserverlust als Sabotage angesehen. Da wurde die Peitsche eingesetzt – rücksichtslos und ohne Gnade.
Jean Ribault bekam es zu spüren. Kaum geriet er ein wenig ins Schaukeln und verlor auch nur einer seiner Eimer ein wenig Wasser, war ein Aufseher neben ihm, fluchte und hieb mit seiner Peitsche zu. Ribault verzog keine Miene. Er stöhnte nicht, beschwerte sich nicht. Er schöpfte Wasser, trug es zum Graben, kippte es aus, kehrte zu seinem Ausgangspunkt zurück und schöpfte erneut Schlammwasser.
Die Schikanen dieser Zwangsarbeit waren ungeheuerlich – aus einem besonderen Grund. Unter den Aufsehern gab es einige ausgesprochene Sadisten. Die legten es darauf an, die Wasserträger laufen zu lassen. Und dabei schwappte natürlich Wasser über, es ließ sich gar nicht vermeiden.
Klar war auch, daß der „Neue“ sonderbehandelt wurde – das hatte Don Lope de Sanamonte extra so angeordnet.
„Lauf!“ brüllte ihn einer dieser Kerle an, als er gerade wieder Schlammwasser schöpfte. „Hopp! Beeilung! Wird’s bald?“
Und Jean Ribault begann zu laufen. Er lief zu dem Graben, verschüttete eine ganze Menge von dem Wasser und empfing die Peitsche. Aber er begehrte nicht auf. Was hätte es ihm eingebracht? Nichts – vielleicht noch härtere Strafen, vielleicht den Tod. Er aber mußte durchhalten und durfte sich nicht aus der Reserve locken lassen. Und wenn er nicht lief? Nun, auch dann gab es die Peitsche.
Er biß die Zähne zusammen. Die Peitsche klatschte auf seinen Rücken, auf seine Schultern, in sein Gesicht. Er ging in die Knie, richtete sich aber sofort wieder auf und lief weiter. Er kippte das Wasser aus und kehrte an das abgeschottete Grabenteilstück zurück. Wieder füllte er die Eimer. Wieder mußte er laufen. Aber er lernte es, zu laufen, ohne Wasser zu verschütten. Die Aufseher staunten nicht schlecht. Jetzt mußten sie sich etwas anderes einfallen lassen, um ihn zu kujonieren.
Jean Ribault zeigte es ihnen, und er bewies es auch Don Lope de Sanamonte und dem bornierten Teniente Don José de Zavallo: Er war keineswegs so schnell kleinzukriegen, wie sie sich das vielleicht einbildeten. Da gehörte mehr dazu.
Außerdem war er in sehr guter körperlicher Verfassung, sehnig, hart und muskulös. Hart im Nehmen war er schon immer gewesen. Er hatte beschlossen, daß es seinen Gegnern nicht gelingen dürfte, ihn zu erniedrigen und seinen letzten Widerstand zu brechen. Eher würden sie sich die Zähne an ihm ausbeißen.
Während er Gallonen von Wasser schleppte und schleppte und die Peitschenhiebe der Aufseher einsteckte, dachte er immer wieder an Flucht. Er ließ keine Gelegenheit aus, die Bedingungen zu erkunden. Wo war eine Schwachstelle, wo konnte er entwischen?
Es schien keine Lücke zu geben, durch die er entweichen konnte. Alles war hermetisch abgeriegelt und von den Aufsehern und Soldaten bestens bewacht. Und bevor es dunkel wurde, rückte der Gefangenentrupp wieder ab in den Kerker, so daß auch in der Nacht keine Möglichkeit zur Flucht bestand.
Jean Ribault entdeckte seine Freunde. Sie arbeiteten an einem anderen Teilstück des Wehrgrabens. Mit Schaufeln mußten sie Schlammerde ausheben, die in Loren gekippt und nordwärts, außerhalb des Forts, abgeladen wurde. Das Schieben der Loren über die Schienen war dabei noch die leichteste Arbeit.
Renke, Karl, Hein und die anderen blickten immer wieder zu Jean Ribault herüber. Aber er konnte ihnen kein Zeichen geben, ihnen nichts zurufen. Die Arbeit ließ es nicht zu. Und die Peitschen der Wärter würden jedes Wort ersticken. Ribault hoffte aber, daß die Kameraden auch so begriffen, daß es ihm – den Umständen entsprechend – noch leidlich gutging.
Die Verpflegung, die es in dieser Hölle von Sklavendasein gab, war als Essen kaum zu bezeichnen. Morgens, mittags und abends gab es einen Fraß, der oft nicht zu definieren war.
Das aber wäre noch nicht am schlimmsten gewesen. Und auch die Peitschenhiebe und die hämischen Bemerkungen seiner Aufseher ertrug Jean Ribault. Er begann, sich an sie zu gewöhnen.
Doch beim Mittagessen gab es eine Überraschung besonders übler Art für ihn: O’Leary kreuzte bei den Wasserträgern auf.
Bei welcher Gruppe O’Leary arbeitete, hatte Jean Ribault bisher nicht feststellen können. Es spielte aber auch keine Rolle. Fatal war, daß er sich ziemlich frei bewegen durfte. Keiner der Aufseher hielt ihn auf, als er auf Ribault zuschritt. War auch das eine besondere Verordnung von Don Lope de Sanamonte?
Die Aufseher grinsten nur. Und O’Leary grinste zurück.
„Na, wie macht sich denn unser deutscher Franzose?“ fragte er.
„Er schleppt ganz schön“, sagte einer der Wächter.
„Wird er nie müde?“ fragte O’Leary.
„Was geht dich das an?“ fuhr ihn ein anderer Aufseher an. „Verschwinde, du hast hier nichts zu suchen.“
„Ich bin gleich wieder weg“, sagte O’Leary.
Er trat ganz dicht auf Jean Ribault zu.
„He!“ sagte er. „Ich hab’ noch Hunger. Gib mir deine Suppe. Und den Kanten Brot, den du in der Hand hast.“
Ribault hatte einen der Eimer umgedreht und sich darauf niedergelassen.
„Hau ab“, sagte er.
O’Leary lachte. „Du verstehst mich also, was? Hab’ ich’s doch gewußt. Aber lange kannst du die Dons nicht mehr täuschen.“
„Verzieh dich“, sagte Ribault.
O’Leary trat ihm mit dem Fuß in die Seite. Merkwürdigerweise war keiner der Aufpasser zur Stelle, um ihm seine Peitsche überzuziehen. Die Kerle blickten gerade alle in den Himmel – oder sonstwohin.
Sollen sie, dachte Jean Ribault.
Er war wie der Blitz auf den Beinen und schleuderte O’Leary die Suppe mitten ins Gesicht.
„Da!“ zischte er. „Sonst noch was?“
O’Leary wollte sich auf ihn stürzen, aber Ribault war auf der Hut. Er duckte sich, und seine nächste Aktion war ein Handkantenschlag an die Gurgel des O’Leary.
O’Leary hatte das Gefühl, von einem Pferd getreten worden zu sein. Er prallte zurück, wollte noch einen Fluch ausstoßen, brachte aber kein Wort mehr hervor. Er brach auf der Stelle zusammen und war bereits besinnungslos, bevor er zu Boden fiel.
Plötzlich waren die Aufseher da.
„Du dreckiger Hund!“ brüllte einer von ihnen. „Was machst du denn da?“
„Er hat mich angegriffen!“ rief Ribault, begriff aber im selben Augenblick, daß es überhaupt keinen Zweck hatte, sich zu verteidigen.
Die erste Peitsche zuckte auf ihn nieder. Der Hieb traf ihn voll, der Lederriemen schien seine Haut wie ein Messer aufzuritzen. Dann knallte die nächste Peitsche – und noch eine. Vier Kerle umstellten ihn und droschen mit ihren Peitschen auf ihn ein.
Jean Ribault ging zu Boden. Die Schmerzen drohten ihn zu übermannen, aber wieder hielt er stand. Er wurde nicht bewußtlos. Ihm war schwindlig und übel, und die Schmerzen waren wie glühende Eisen, die ihm zusetzten, aber er war bei Sinnen, als er zu Boden ging und die letzten Hiebe über sich ergehen ließ.