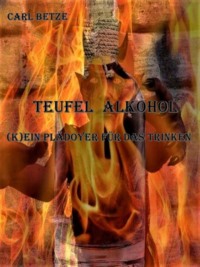Kitabı oku: «Teufel Alkohol»
Carl Betze
Teufel Alkohol
(k)ein Plädoyer für das Trinken
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Teufel Alkohol
Vorwort
01 – Hoch die Tassen - Alkohol in der Gesellschaft
02 - Alkohol in Fakten und Zahlen
03 – was passiert, wenn wir Alkohol trinken?
04 – warum trinken wir Alkohol?
05 – Sucht und Alkoholismus
06 - Die Phantomsucht
07 - Sein statt Haben – die Alkoholkrankheit
08 - Selbstreflektion schlägt Selbsttest – bin ich Alkoholiker?
09 - Vorbilder und tragische Helden
10 - Die Enttarnung der Trinkfestigkeit
11 – Gesundheit und … weitere Gründe, den Alkoholkonsum zu reduzieren
12 – Ansätze zur Reduktion des Alkoholkonsums
13 - Die Macht des Unterbewusstseins
14 – Der Prozess der Veränderung innerer Überzeugungen
15 - Der Placebo-Effekt des Alkohols
16 – Her mit dem Zeug: Das Suchtgedächtnis
17 – Oh, wie wohl ist mir am Morgen – das Abstinenzgedächtnis
18 – Wer rastet, den dürstet's
19 – Laufen statt saufen
20 „Teetotal hunting“ - Abstinenz als Sport?
21 – GGT, GOT, GPT – alles ok?
22 - Rote Bete & Co. machen die Leber froh
23 - Leber-Jogging
24 - „Fastenzeit“
25 - Bier und Wein – auch 'ohne' fein?
26 – Ersatzdrogen
27 - Neue Homöopathie – Heilende Zeichen gegen den Alkohol
28 - Schluckspecht aus der Zwischenwelt
29 - Die Gesellschaft als Gegenpol
30 - Social drinking
31 – Ein weiterer Trinkertyp - der bewusste Vieltrinker
32 - Glück kann man nicht trinken – die Story hinter der Story
33 - Gesucht: Das Gleichgewicht hinter dem Alkohol
34 Trinkregeln und abstinent gelebte Tage - Selbstkasteiung für inneres Wachstum
35 – Wenn Sie Probleme bekommen – begleitende Maßnahmen
36 – Trivial aber effektiv: Ein paar praktische Ratschläge „to go“
37 - HoHoHo – nur leicht besäuselt sind wir froh
38 - Deutschland im Corona-Rausch
39 – Absacker
40 - Brief an „Freund Alkohol“
41 - Bitte lesen!
Quellenverzeichnis
Impressum neobooks
Teufel Alkohol
(k)ein Plädoyer für das Trinken
von Carl Betze
Ausgabe 01, 2020
© / Copyright 2020 Carl Betze
Umschlaggestaltung, Illustration: Carl Betze
ISBN Paperback
Carl Betze
Poller Damm 26
51105 Köln
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung oder Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar
Inhaltsverzeichnis
Dieses Buch schreibe ich primär für mich selbst, zudem für einen meiner besten Freunde, der sicher weiß, dass er gemeint ist...und für all' die Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden.
Ich saach mir: „Nie mehr Alkohol“
(Ich sage mir: „Nie mehr Alkohol“)
Hey, wat häss du bloß met mir jemaat?
(Hey, was hast Du bloß mit mir gemacht?)
Mich hätt dä Düvvel anjelaach
(Mich hat der Teufel angelacht)
Ich han de Nas von dir jetz voll
(Ich habe die Nase von Dir jetzt voll)
Ich dunn et nie mieh widder - bes zom nächste Mol
(Ich tue es nie mehr wieder – bis zum nächsten Mal)
„Nie mehr Alkohol“
Sessionshit der Kölner Mundartgruppe
„Paveier“ aus dem Jahr 2019
Vorwort
„Wenn Sie mit dem Trinken aufhören wollen, ist die erste Voraussetzung, dass Sie aus voller Überzeugung sagen: Ich will keinen Alkohol mehr trinken“.
In nahezu jedem Fernsehbericht, jedem Ratgeber, jedem Zeitungsartikel über den übermäßigen Konsum von Alkohol ist das der Satz, an dem ich zumindest stocke, oft sogar die das TV-Programm oder die Lektüre beende.
Denn DAS würde ich nie sagen, zumindest würde ich, und das ist das Wesentliche, niemals so empfinden.
Auf den Alkohol, das heißt in meinem Fall auf mein heiß und innig geliebtes Bier, zudem auf ein Gläschen Wein ab und an, für den Rest meines Lebens verzichten – undenkbar. Weder auf den Geschmack noch auf die euphorisierende Wirkung, die ich in Grenzen immer genossen habe.
Viele Menschen neigen dazu, ihre Trinkgewohnheiten und die daraus resultierenden Probleme zu verharmlosen.
Dabei gehen Alkoholprobleme durch alle sozialen Schichten.
Der Arbeiter in der Fabrik kann genau so betroffen sein wie der Richter oder der Unternehmer, der Arzt und der Pilot, der Millionär und der Obdachlose, die Hausfrau oder die Chefsekretärin.
Denken Sie kurz an Ihr Umfeld, an Verwandte, Freunde, Bekannte, Kollegen, ...sich selbst?
Wie lange brauchen Sie, bis Ihnen jemand einfällt, der auffällig viel trinkt, der womöglich ein Alkoholproblem hat?
Alkohol entspannt, er hilft beim Einschlafen, er macht gelöster, optimistischer, euphorischer,…glücklicher.
Nur: da ist ja noch ein anderer Aspekt, die viel zitierte Kehrseite der Medaille.
Alkohol, in den Mengen, in den ich ihn konsumiere, ist, ohne Wenn und Aber, gerade der Vieltrinker neigt dazu, diesen Aspekt immer wieder zu verharmlosen, erwiesenermaßen extrem gesundheitsschädlich und kann zu gravierenden körperlichen Beeinträchtigungen führen.
Menschen wie mir, in der gängigen Literatur oft als „Vieltrinker“ und damit auch als „alkoholgefährdet“ bezeichnet, würde sicherlich beinahe jeder Arzt und noch mehr jeder Suchttherapeut unmissverständlich nahelegen, auf alkoholische Getränke konsequent zu verzichten.
Da es mir kaum möglich erscheint, Bier und Wein ein für alle Mal abzuschwören, ich mich jedoch ebenso wenig ganz meinem Gusto entsprechend und ohne Selbstbeschränkung dem Alkohol hingeben darf, muss es einen anderen Weg geben – und zwar den, nicht auf den Konsum von Alkohol zu verzichten, sondern mit ihm, im schlechtesten Fall im Grenzbereich zwischen „gerade noch vertretbar“ und „gesundheitsschädlich“, gesundheitsverträglich umgehen zu können.
Diesen will ich im Folgenden beschreiben.
„Teufel Alkohol – (k)ein Plädoyer für das Trinken“ richtet sich an all' diejenigen Alkoholkonsumenten, die wie ich irgendwo in der Mitte zwischen Vieltrinken und drohender Abhängigkeit stehen.
An Menschen, die nicht aufhören können, zu trinken, und an jene, die nicht mit dem Trinken aufhören wollen.
Die sich ein Leben ohne Alkohol gar nicht vorstellen möchten, aber abgesehen vom überhöhten Alkoholkonsum alles dafür zu tun bereit sind, ihre Leidenschaft für, Bier, Wein & Co. gesundheitlich unbeschadet zu überstehen.
Das Buch soll aufzeigen, wie mit einfachen, leicht verständlichen und doch wirkungsvollen Mitteln und Denkanstößen ein Weg gefunden werden kann, mit dem Alkohol womöglich gesundheitsverträglich umzugehen, ohne völlig auf ihn verzichten zu müssen.
Es beinhaltet eine Kombination aus theoretisch-wissenschaftlichem Hintergrund zum Thema Alkohol, Episoden aus der Alkoholkarriere des Autors und dem daraus entwickelten möglichen Ausweg in Richtung eines gesundheitsverträglichen Trinkens.
Oft werden Menschen, die wie ich in anhaltender Regelmäßigkeit größere Mengen Alkohol zu sich nehmen, als Alkoholiker bezeichnet.
Eine eindeutige Definition dieses Begriffes erscheint schwer möglich, an anderer Stelle gehe ich ausführlich auf dieses Thema ein.
Fakt ist: selbst mit meinen nunmehr gemäßigten Trinkgewohnheiten gehöre ich nach wie vor zum stark suchtgefährdeten Personenkreis, für den gesundheitliche Beeinträchtigungen infolge des Alkoholkonsums nicht auszuschließen sind. Dessen bin ich mir vollends bewusst.
Für Menschen wie mich jedoch, die schon Phasen erlebt haben, in denen sie wesentlich öfter und deutlich mehr getrunken haben, stellt die mit dem in diesem Buch dargestellten Ansatz erreichbare Situation unzweifelhaft einen großen Fortschritt dar, mit dem die Trinkmengen deutlich reduziert werden können und eine Kontrolle über den Alkoholkonsum in Form eines womöglich noch gesundheitsverträglichen Trinkens erreicht werden kann.
Zudem kann das von mir im Folgenden beschriebene Trinkkonzept auch als Zwischenschritt auf dem Weg zur Erreichung der weiteren Reduzierung der Trinkmengen oder auch des Totalverzichts auf alkoholische Getränke genutzt werden.
Sie werden feststellen, dass, sobald eine Stabilisierung der Trinkgewohnheiten erst einmal erreicht ist, der Weg hin zu weiter sinkenden Trinkmengen durchaus möglich und darüber weniger steinig als angenommen erscheint.
Manch' ein Leser mag es für unverantwortlich halten, kontinuierlichen Alkoholkonsum zu befürworten, manch' einer wird mir vorwerfen, dass ich mir und meinen Lesern mit meinem Buch einen Freifahrtschein zum Alkoholkonsum ausstelle - dies ist mitnichten meine Intention.
Ich rate jedem Betroffenen, wenn möglich komplett auf den Alkohol zu verzichten oder aber den Genuss von Bier, Wein und Schnaps auf ein absolutes Minimum zu reduzieren.
Ich plädiere keinesfalls für das Trinken als solches, sondern stelle mit meinem Ansatz lediglich eine „second-best-Lösung“ für diejenigen suchtgefährdeten Menschen vor, die nicht völlig auf den Konsum alkoholischer Getränke verzichten können oder wollen.
Eine Lösung, die immer noch besser ist als tagtäglich unkontrolliert Alkohol zu trinken und darüber hinaus die Rahmenbedingungen für ein mit der Gesundheit kompatibles Trinken zu vernachlässigen.
Mir ist dabei durchaus bewusst, dass mein Konzept zum gesundheitsverträglichen Trinken funktionieren kann, aber keinesfalls muss!
Ich habe mich nach langem Hin und Her dafür entschieden, dieses Werk unter einem Pseudonym zu veröffentlichen.
Weil die intimen Details, die ich an manchen Stellen über mein Trinkverhalten preisgebe, den ein' oder anderen lieben Menschen in meinem Umfeld höchst irritieren würden.
Und weil auch das Kontrollierte Vieltrinken immer noch ein Tabuthema ist, in der Gesellschaft eher missbilligt als akzeptiert. Es wäre schön, wenn mein Werk daran etwas ändern könnte.
Für mich ist dieses Buch das Ergebnis meiner erfolgreichen Selbsttherapie.
Denn die umfangreiche Recherche zum Thema Alkohol und die Entwicklung meiner Verhaltensregeln im Umgang mit der Droge haben es mir ermöglicht, auch weiterhin gemäßigt und das in bisher gesundheitsverträglicher Form Alkohol zu trinken.
Ich will MIT Alkohol leben – und das möglich lange.
Ich wünsche meinen Lesern, dass Ihnen dies auch gelingen möge!
Köln, im März 2020
Peter Wolff
01 – Hoch die Tassen - Alkohol in der Gesellschaft
„Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut wird, betrinken wir uns einfach“
Der Genuss von Alkohol hat in vielen Kulturen einen festen Platz. Kein Wunder, war doch der Umgang mit Alkohol bereits in früheren Zeiten etwas völlig Normales. Eine Art Ur-Bier soll es zum Beispiel schon vor mehr als 8.000 Jahren gegeben haben, als Nebenprodukt des Getreideanbaus. Vermischt man Getreide nämlich mit Wasser, beginnt die Flüssigkeit schon kurze Zeit später zu gären und erreicht bis zu 2% Alkoholgehalt.
Auch der Weinbau wird bereits seit mehreren Tausend Jahren betrieben. Das antike Griechenland und das Römische Reich waren Weinkulturen. Hochprozentiges gibt es wahrscheinlich seit etwa 1.000 Jahren. Wegen der komplizierten Herstellung war es aber lange Zeit den Reichen vorbehalten. Die Ursprünge der heute bekannten Spirituosen liegen im Europa des 16. Jahrhunderts.
Die berauschende Wirkung des Alkohols konnten auch die ersten Konsumenten erleben. Wie und warum Alkohol wirkt, wussten sie nicht. So gab es viele Mythen rund um Alkohol und ihm wurden sowohl positive als auch negative Eigenschaften zugeschrieben.
Negative gesundheitliche Folgen waren dabei allerdings lange kein Thema. Biersuppe galt im Mittelalter als gesund und Hochprozentiges wurde gegen die Pest eingesetzt. Bis ins letzte Jahrhundert waren sich Ärzte und Wissenschaftler uneinig darüber, ob Alkohol eher hilft oder doch schadet. Einerseits vermutete man eine stärkende, sogar heilende Wirkung und andererseits beobachtete man die Folgeschäden. Und noch heute trinken wir auf unsere Gesundheit, obwohl wir die Risiken längst kennen.
Den Menschen in der Antike und im Mittelalter hat Alkohol sicher genauso geschadet wie uns, und zu jeder Zeit gab es Alkoholgegner. Ab dem 16. Jahrhundert entwickelte sich aber die Mäßigkeits- und Abstinenzbewegung. Übermäßiger Alkoholkonsum wurde in den folgenden Jahrhunderten immer mehr als Gefahr für die Gesellschaft wahrgenommen. Teilweise wurden Alkoholiker zu Verbrechern erklärt und in Zuchthäusern weggesperrt.
Mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert verbreitete sich der sogenannte „Elendsalkoholismus“, der große Teile der armen Bevölkerung betraf. Der Umgang mit Alkohol wurde zu einem massiven Problem. Berauscht waren die die langen und anstrengenden Arbeitstage in der Fabrik für viele besser zu ertragen. Die meisten Arbeitgeber erlaubten nicht nur Alkohol am Arbeitsplatz, sondern gaben sogar einen Teil des Lohns in Form von Hochprozentigem aus. Die Gewerkschaften erkannten die Gefahr für die Arbeiterschaft und entwarfen bald Beschlüsse gegen den Verkauf von Alkohol am Arbeitsplatz.
Inzwischen hatte man auch die gesundheitlichen Folgeschäden andauernden Alkoholkonsums entdeckt. Unter Medizinern reifte die Auffassung, dass Alkoholismus eine Krankheit ist. Offiziell ist er das in Deutschland allerdings erst seit einem Beschluss des Bundessozialgerichts im Jahr 1968. Seitdem werden die Kosten für eine Behandlung von der Kranken- oder Rentenversicherung getragen.
Der gesellschaftliche Umgang mit Alkohol hat sich in den vergangenen Jahrhunderten und wahrscheinlich Jahrtausenden immer wieder geändert. Das Thema wurde ignoriert, erforscht, alkoholkranke Menschen wurden als Sünder oder Verbrecher abgestempelt und immer wieder wurde postuliert, dass weniger Alkohol uns guttun würde (01).
Trotzdem sind viele gesellschaftliche Rituale bis heute eng mit dem Konsum alkoholischer Getränke verbunden: Geburtstage, Hochzeiten, sportliche Siege und berufliche Erfolge – wo gefeiert wird, gehört Alkohol oft selbstverständlich dazu.
Alkohol steht für Lebensfreude – auch, wenn sein Konsum noch so viele Gefahren birgt.
Auch die zunehmende Aufklärung der Bevölkerung über Risiken und mögliche Folgen eines regelmäßigen Alkoholkonsums tut der Begeisterung für alkoholische Getränke in der Gesellschaft kaum einen Abbruch.
„Man gönnt sich ja sonst nichts“ - in Maßen genossen, ist gegen den Genuss alkoholischer Getränke nichts einzuwenden.
Leider jedoch ist das Maßhalten in puncto Alkohol nicht des Deutschen liebstes Kind, wie wir bei der Betrachtung von Zahlen und Fakten rund um den Alkoholkonsum in diesem unserem Lande im nächsten Kapitel unschwer feststellen werden.
02 - Alkohol in Fakten und Zahlen
„Alkohol trinke ich nur an Tagen, die mit -g aufhören. Und mittwochs“
Im Jahr 2016 trank ein Drittel der Weltbevölkerung gelegentlich oder regelmäßig Alkohol, der Anteil bei den Frauen betrug 25 Prozent, bei den Männern 39 Prozent.
Am weitesten verbreitet ist der Alkoholkonsum in Dänemark mit 97 Prozent bei Männern und 95 Prozent unter Frauen. Dagegen sind erwartungsgemäß in islamischen Ländern die allermeisten Menschen abstinent.
Deutschland belegt mit einer Prävalenz von 94 Prozent (Männer) und 90 Prozent (Frauen) jeweils den vierten und dritten Platz.
Am höchsten ist der Konsum unter Männern in Rumänien mit 82 Gramm am Tag gefolgt von Portugal (72 g/d), Luxemburg, Litauen, Ukraine, Bosnien, Weißrussland, Estland, Spanien und Ungarn (siehe nachfolgende Grafik).
Frauen trinken am meisten in der Ukraine mit 42 g pro Tag, auf den weiteren Plätzen folgen Andorra, Luxemburg, Weißrussland, Schweden, Dänemark, Irland und Großbritannien.
Hierzulande trinken Männer im Schnitt 40 g Alkohol pro Tag, also umgerechnet zwei Flaschen Bier. Damit schaffen sie es nicht mehr unter die Top-Ten beim weltweiten Konsum. Frauen hierzulande belegen mit einer durchschnittlichen Menge von 29 g weltweit Platz 9 (02).
Trotzdem ist Deutschland nach wie vor ein sogenanntes Hochkonsumland.
Im internationalen Vergleich bewegen wir uns im oberen Drittel, konsumieren wir doch jährlich 105,9 Liter Bier, 20,5 Liter Wein, 5,4 Liter Spirituosen und 3,7 Liter Sekt.
Der Pro-Kopf-Konsum an alkoholischen Getränken in der Bundesrepublik betrug im Jahr 2016 133,8 Liter. Eine Badewanne voll alkoholischer Getränke...
Das entspricht 9,5 Liter reinem Alkohol.
Stolze 96,4 Prozent der Bevölkerung im Alter zwischen 18 und 64 Jahren trinken Alkohol.
Etwas älter als 16 Jahre sind Jugendliche in Deutschland, wenn sie ihren ersten Alkoholrausch erleben, der Schnitt ist in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich gestiegen. Den ersten Alkohol gibt es durchschnittlich etwa ein Jahr früher.
Statistiken zeigen dabei deutlich: Männer trinken mehr und riskanter Alkohol als Frauen.
Der riskantere Umgang von Männern mit Alkohol lässt sich unter anderem mit gesellschaftlichen Rollenbildern erklären: Die Verknüpfung zwischen hohem Alkoholkonsum und Männlichkeit ist tief in unserer Kultur verwurzelt. Der Konsum von Spirituosen war beispielsweise lange Zeit Männern vorbehalten.
Der alte Spruch „Ein richtiger Mann muss schon ein paar Gläser vertragen können“ hält sich beharrlich, allen warnenden Zeigefingern zum Trotz. „Trinkfest“ zu sein gilt bei vielen immer noch als Statussymbol. Wenig oder keinen Alkohol zu trinken wird dagegen oft als „unmännlich“ bewertet.
Alkohol hat in Männergruppen oft die Funktion, eine Gemeinsamkeit zu schaffen: Es werden die gleichen Getränke bestellt und gemeinsam bis zum Rausch getrunken. Männer neigen stärker als Frauen im Rausch dazu, „Macht“ zu demonstrieren, zum Beispiel indem sie sich mit anderen in Trinkspielen und Mutproben messen oder gegen Regeln verstoßen. Das ist auch eine Erklärung dafür, dass Männer häufiger unter Alkoholeinfluss Unfälle verursachen oder Schlägereien anzetteln.
Auch in der Werbung werden häufig männliche Rollenbilder aufgegriffen, attraktiv in Szene gesetzt und mit dem Produkt Alkohol verknüpft. Ein gewaltiges Werbebudget sorgt hier dafür, dass die gedankliche Verbindung zwischen Männern und Alkohol gestärkt wird. Eine Studie über Alkoholwerbung im deutschen Fernsehen ergab, dass ein Großteil der Darsteller in der Werbung für alkoholische Getränke männlich ist. Vor allem in der Bierwerbung setzt die Industrie auf Männer.
Alkohol reduziert Hemmungen, dämpft Ängste und erhöht die Risikobereitschaft – kein Wunder also, dass manche sich stärker fühlen, wenn sie etwas getrunken haben. Auch das gemeinsame Trinken in der Gruppe trägt zu diesem „Machtgefühl“ bei.
Frauen trinken anders als Männer, auch wenn sich Männer und Frauen in vielen gesellschaftlichen Bereichen einander angenähert haben. Statistiken zeigen, dass Frauen seltener zu alkoholischen Getränken greifen und auch geringere Mengen konsumieren.
Dass Frauen beim Thema Alkohol zurückhaltender sind als Männer, hat auch etwas mit gesellschaftlichen Rollenbildern zu tun. Lange war es vor allem in der Öffentlichkeit verpönt, als Frau Alkohol zu trinken. Auch Spirituosen tranken früher fast ausschließlich Männer. Frauen konsumierten hochprozentigen Alkohol vor allem in Form von „Hausmitteln“ („Kräuterschnaps“), denen eine medizinische Wirkung zugeschrieben wurde.
Während hohe Trinkmengen bei Männern oft männlich und damit positiv bewertet werden oder weniger auffallen, gelten viel trinkende Frauen schnell als „unweiblich“ oder „billig“. Daher ist es verständlich, dass sich viele Frauen beim Alkohol stärker kontrollieren als Männer.
Für Frauen gibt es gute Gründe dafür, sich beim Alkoholkonsum nicht am Verhalten von Männern zu orientieren, denn die gleiche Menge Alkohol lässt bei Frauen den Promillewert stärker ansteigen als bei Männern. Denn Frauen sind im Allgemeinen leichter und ihr
Körperflüssigkeitsanteil ist niedriger.
Außerdem bauen Frauen Alkohol langsamer ab. Deshalb sind Frauen schneller und wegen des verlangsamten Abbaus auch länger in einem für sie riskanten Bereich.
Viele wissenschaftliche Studien haben zudem ergeben, dass Frauen sensibler auf das Zellgift Alkohol reagieren. Deshalb liegen bei ihnen die Grenzen für risikoarmen Alkoholkonsum niedriger als bei Männern (03).
Alkohol ist ein prosperierender Wirtschaftsfaktor.
Im Jahr 2016 betrugen die staatlichen Einnahmen aus Bier-, Schaumwein- und Spirituosensteuer 3,165 Milliarden Euro. Auf Wein wird in Deutschland keine Steuer erhoben.
Die Werbeaufwendungen für alkoholische Getränke in TV, Rundfunk, Plakatwerbung und Zeitungen/Zeitschriften betrugen 2016 rund 557 Millionen Euro.
Es wird immer günstiger, sich in einen Rauschzustand zu versetzen: Innerhalb der letzten 40 Jahre sind alkoholische Getränke im Vergleich zur sonstigen Lebenshaltung um 30 Prozent billiger geworden. Dabei sanken die Verbraucherpreise für Wein um 38 Prozent, für Spirituosen um 33 Prozent und für Bier um 26 Prozent.
Über 90% der deutschen Bevölkerung trinken Alkohol (04).
Jeder siebte Erwachsene trinkt dabei des Guten zu viel (05).
Die Folgen des hohen Alkoholkonsums in der deutschen Bevölkerung schlagen sich dabei leider auch in Statistiken nieder, die man gern vernachlässigt, wenn man über Alkohol spricht.
Jährliche Schätzungen für Deutschland belaufen sich auf etwa 74.000 Todesfälle, die durch riskanten Alkoholkonsum oder durch den kombinierten Konsum von Alkohol und Tabak verursacht werden.
Rund 1,77 Millionen Männer und Frauen im Alter zwischen 18 und 64 Jahren sind alkoholabhängig.
Beinahe ebenso viele, nämlich 1,61 Millionen Männer und Frauen in derselben Altersgruppe trinken missbräuchlich Alkohol und stehen damit oft kurz vor der Abhängigkeit.
Die direkten und indirekten Kosten alkoholbedingter Krankheiten werden pro Jahr auf 40 Milliarden Euro geschätzt.
Die WHO bringt rund 200 Krankheiten mit Alkoholkonsum in Verbindung, darunter Leberzirrhose und einige Krebsarten. In dem 500-seitigen Bericht heißt es zudem, Alkoholkonsum mache Menschen anfälliger für Krankheiten wie Tuberkulose, HIV und Lungenentzündungen (06).
Überhöhter Alkoholkonsum wirkt sich zudem auch auf andere Statistiken negativ aus.
So ereigneten sich in 2016 insgesamt 13.403 Alkoholunfälle mit Personenschaden in Deutschland. Bei diesen Unfällen starben 225 Menschen, 16.770 Personen wurden verletzt.
Und die Kriminalstatistik sagt aus, dass anno 2016 insgesamt 242.494 Tatverdächtige ihre Tat unter Alkoholeinfluss begangen. Das sind stolze 10,3 Prozent aller Tatverdächtigen (07).
Laut WHO trinken 2,3 Milliarden Menschen weltweit Alkohol – in Amerika, Europa und im Westpazifik sind es mehr als die Hälfte der Einwohner. Europa weist die höchste Zahl der Alkoholkonsumenten auf.
Mit Blick auf den weltweiten Alkoholkonsum rechnet die WHO mit einem Anstieg in den kommenden zehn Jahren, insbesondere in Südostasien, im Westpazifik und auf dem amerikanischen Kontinent.
Damit einhergehen werde vermutlich auch ein Anstieg der alkoholbedingten Krankheiten und Todesfälle (08).