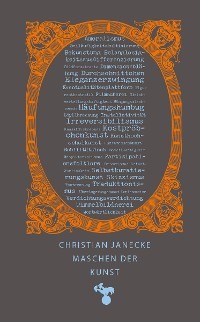Kitabı oku: «Maschen der Kunst», sayfa 2
Amoralismus
Nicht alles Amoralische in der Kunst huldigt sogleich dem Amoralismus. Wie Christoph Menke zuletzt in seiner Erörterung der Kraft zeigte, gehört zum Künstlertum eine gewisse Hinwegsetzung über wertbezogene Vereinbarungskataloge einer Gesellschaft, so dass ohne letztlich asoziale und amoralische Momente eine experimentelle Haltung des Künstlers nicht zu haben ist. So projektiert Menke einen Künstler (ziemlich ähnlich einem einst von Rorty projektierten Denker), der sich jenseits der marodierenden Unreife nietzscheanischen Ästhetizismus und diesseits der Langeweile eines habermasianisch gezähmten Staatsbürgers bewegt.
Etwas ganz anderes als derartige Legitimationen eines, sagen wir: moralindifferenten Spielraums der Künstler als auftretender Personen ist die offensiv eingenommene Haltung des Amoralismus in der Kunst selbst. Implizit beanspruchen Vertreter dieser Haltung Oscar Wildes Einsicht, jede Kunst sei amoralisch, außer jener, die zum Handeln anstacheln, also aufs Ethische hinauswolle. Und in der Schmähung dieser Allianz machen die neuen Amoralisten deutlich, gegen welche Art von zugemuteter Weltverbesserung sie sich als Künstler bereits erfolgreich immunisiert haben. Lesbar werden an dieser Aversion gegen außerästhetische Konsequenz von Kunst auch die historischen Konjunkturen des künstlerischen Amoralismus, die sich dementsprechend dann als Antidot zu zeitgleich unterschwelligen moralischen Instrumentalisierungen begreifen lassen. Zu denken wäre hier an die von Helmut Lethen so eindrucksvoll untersuchten Ästhetiken der Kälte in der Weimarer Zeit, die sich gegen Ausläufer des Expressionismus stemmten, und ebenso an die 1990er Jahre, als eine auf den Zusammenbruch sowohl des Kunstmarktes als auch einer überschaubaren Westkunst antwortende Hinwendung der Künstler und insbesondere der maßgeblichen Kuratoren zu interventionistischen und sozialen Kunstpraktiken ihrerseits Allergien hervorrief: In diesen Dunstkreis gehören die pittoresken Tierfallen Andreas Slominskis und jene wohlkalkulierten Geschmacklosigkeiten Carsten Höllers, die beispielsweise im Gewande der Verlockung oder des Spielzeughaften eine tödliche Gefahr für nichtsahnende Kinder bereitstellten oder auch bloß mimten. Das augenzwinkernd Perfide nach dem kalauernden Motto »Wer keine kleinen Kinder oder Hunde mag, kann kein ganz schlechter Mensch sein« wusste jene vom Sozialeudämonismus Kurierten auf seiner Seite, die einem nun auch in der Kunst allseits verlangten Gutmenschentum eine zynisch skandalöse Haltung gegenüberstellten.
Ungeachtet solch historischer Anbindungen bleibt Amoralismus eine Haltung überspielter Resignation, in der, seltsam genug, ausgerechnet die Künstler, also die im Ernstfalle als Erste zum Opfer Prädestinierten, großspurig nun Täterschaft wertschätzen.
Übertriebenes Amoralisieren (das, wie Brecht in seinen Baudelaire-Notizen argumentiert, als Kehrseite eines moralischen Rigorismus reüssiert) findet seine heutige Entsprechung im süßen Gift schmollender Begründungsfreiheit, von dem sich Kuratoren in der Unerfindlichkeit der von ihnen bei der Wahl ›ihrer‹ Künstler praktizierten Ein- und Ausschlüsse gerne einmal eine Prise genehmigen. Auch in den Legitimationsdiskursen gewisser Großkünstler gehört es seit Gerhard Merz immer wieder zum guten Ton, das archaische Register des Voluntarismus zu ziehen. Innerhalb eines dicht verwobenen, befriedeten Sozialgefüges sorgfältig gewahrter Partikularinteressen, in dem mit Argusaugen jene drohenden Asymmetrien überwacht werden, als welche amoralische Avancen auf den Plan treten müssten, scheint es allein die Enklave der Kunst zu sein, die noch Raum für sanktionsfreie Atavismen bietet (→ Kunsthochschulkunst).
Beiläufigkeitskultivierung
In der Beiläufigkeitskultivierung inszeniert Kunst aufmerksamkeitsheischend ihr eigenes Übersehenwerden. Sehr alte Figuren oder Vorformen der Beiläufigkeitskultivierung, die malerische oder habituelle Lässigkeit (sprezzatura) des dem Höfling nacheifernden Künstlers, ebenso dandyistische Attitüden habituellen oder vestimentären Understatements erklären Anteile des Phänomens. Bürgerlich, und das heißt modern, ist der Kunst indes Ambitioniertheit nicht nur beigesellt, sondern unverzichtbar – umso antibürgerlicher und mithin distinktionssteigernder nimmt sich Beiläufigkeitskultivierung aus (→ Eleganzerzwingung). Sie hebt sich günstig ab von jenem drängenden Konsequenzialismus der Moderne, dessen gesellschaftsaversive und gemeinschaftsverliebte Haltung Plessner ein halbes Jahrhundert vor Sennett durchschaut hatte. All die expressionistischen ›Notwendigkeiten‹, denen sich das Künstlersubjekt allein durch innere Vorgabe, keinesfalls durch Wahl konfrontiert sah, raunten ihm zu: »Einerlei was du machst, mache es ernst, konsequent, bringe es zu Ende!« Das heißt aber, dass die Künstler, falls sie stattdessen Beiläufigkeitskultivierung betrieben, nicht allein gegenüber Nichtkünstlern unorthodox auftreten konnten, sondern ebenso gegenüber dem ordo ihres eigenen Feldes.
Zur M. d. K. gerät Beiläufigkeitskultivierung, wo sie selbst noch in dieser Opposition gegen das übrige Lager der Künstler topisch wird. Nichtinvolviertheit als Variante eines Kults der Coolness wird hier zum Credo der Abgeklärten: »Das sehe ich ganz leidenschaftslos«, sagen sie heute mit den professionell gelangweilten Mienen der Gesichter von Figuren Stephan Balkenhols. Jedoch nicht aufrichtig, denn der Künstler muss gesehen werden. Timm Ulrichs’ altvorderer Kalauer: »Denken Sie immer daran, mich zu vergessen!« (1969) pointiert mit seiner unweigerlich einprogrammierten Selbstwiderlegung insofern die Crux jeglicher Beiläufigkeitskultivierung.
Auf der documenta X (1997) bemühten sich Künstler wie Carsten Nicolai derart um die Unauffälligkeit ihres Ausstellungsbereiches, dass tatsächlich ein Großteil des Besucherfußvolks daran vorbeizog. Natürlich steckt immense Eitelkeit darin, noch dort und noch in jener Geste Aufmerksamkeit ernten zu wollen, da man um diese nicht nur nicht buhlte (man also in den Worten Michael Frieds der ›absorption‹ huldigte), sondern wo man die Adressaten regelrecht damit überraschte, dass sie die wahre Kunst schon längst ahnungslos passiert hatten. So wie pfiffige Sozialpsychologen einen Test nicht im Labor, sondern bereits im Wartezimmer mit den Probanden (die glauben, ihn noch vor sich zu haben) vornehmen und dabei Authentizitätsgewinne für ihr Experiment einstreichen wollen, genauso steckt in der künstlerischen Beiläufigkeitskultivierung die stille Hoffnung, das zunächst gar nicht unter Auspizien der Kunst Wahrgenommene möge desto nachhaltiger und irgendwie ehrlicher seine Wirkung entfalten. Lernen könnten die Ritter der Beiläufigkeitskultivierung von der modernen Zoopädagogik, die – ihrerseits inspiriert von kalkulierten Sichtbarrieren des älteren Englischen Gartens – schon in den frühen 1970er Jahren empfahl, Büsche und andere sichtversperrende Requisiten derart im Vordergrund der Gehege einzelgängerischer Tiere zu drapieren, dass es den Besuchern erst nach einer Weile gelänge, das ersehnte Objekt ihrer Schaulust zu erspähen.
Neben kalkulierten und erfolgserpichten gibt es freilich auch regressive und selbstmitleidige Varianten des Prinzips, so wenn verinnerlichtes Scheitern bei Protagonisten einer → Kunsthochschulkunst dazu führt, dass sie, das Establishment fliehend, eine Schmollecke in der Peripherie der Ausstellung vorziehen, um dort wenigstens unter ihresgleichen als heroischer Verweigerer abgefeiert zu werden.
Die Beiläufigkeitskultivierung als ostentatives Antistrebertum in der Kunst kann sich in der Dürftigkeit oder im Billiglook verwendeter Materialien ausdrücken wie beispielsweise Gerwald Rockenschaubs monochrom von der Rolle entnommene, gekettelte Teppichstücke in schäbiger, kompositorisch bewusst sinnloser Überlagerung, die anderthalb Jahrzehnte nach ihrer Entstehung nochmals zur documenta 12 (2007) in der Kasseler Neuen Galerie gezeigt wurden. Rockenschaubs Arbeit erinnerte nicht zufällig an die sogenannte Realkunst der späten 1970er und 1980er Jahre. Denn dort gab es sowohl die franziskanische Geste demütigen Anerkennens protokünstlerischer Qualitäten im Alltäglichen, als auch die virtuose Haltung dessen, der – wie Leonardo aus Spuren des an die Wand geworfenen Schwamms – es versteht, dem Ungefähren, Ungestalteten durch winzige Eingriffe, Markierungen oder Kontextverschiebungen listig Sinn abzuringen.
Häufig ist Beiläufigkeitskultivierung nicht so sehr den Werken an sich, als vielmehr ihrer Darbietung inhärent, entweder direkt als kuratorische Strategie oder indirekt, wenn die Künstler zur → Selbstkuratierung schreiten, indem sie ihrem Werk mittels randseiterischer Lokalisierung etwas Lauerndes verleihen, so als drohe es uns mit den Worten: »Zieh’ nur an mir vorüber, wirst schon sehen, was du dabei verpasst!« Diese provozierte ›Unbeachtetheit‹ fügt sich, wie ich finde, trefflich zur immer noch grassierenden, jedoch langsam verebbenden Mode des Performativen auch in nicht explizit performativen Künsten. Denn Weniges kommt dieser Denkmode (und ihrem Hang zur Überschätzung einer werkkonstitutiven Rolle der Begegnung eben mit dem Werk) so entgegen wie das vermeintlich Liegengelassene oder das en passant Erwirkte.
In der Beiläufigkeitskultivierung wiederholt sich jene Situativität, die man der Minimal Art als regelrechtes Aufwarten gegenüber dem Betrachter vorgeworfen hatte. Nur gestaltet sie sich jetzt nicht mehr als unmittelbar vom Werk veranlasst, sondern als ein auf Begegnungsverzögerung angelegtes Arrangement des Werkes. Indem es uns nicht direkt in Empfang nimmt, sondern sich mit Bedacht ein wenig ins Abseits begibt, erzielt es im Nachhinein desto mehr Effekt. Offenkundig schmeichelt es manchen Betrachtern, sich Audienz bei einem nicht für jedermann erreichbaren Werk verschafft zu haben.
Nicht zu vergessen ist die Option, Beiläufigkeitskultivierung werkinhärent einzubauen, als eine Art eingeplanten Übersehenwerdens nun nicht eines ganzen Werkes, sondern nur einiger seiner Facetten. Niemand beherrscht die Klaviatur solch parergonaler Geschwätzigkeit besser als Manfred Pernice mit seinen betulich auf kaputt getrimmten Skulpturen – vielleicht sollte man sagen: Skulptur-Gelagen. Er hat es geschafft, das den 1990er Jahren verhaftete Berlin Gefühl eines Billiglooks zu überführen in eine Notorik des immer schon zu spät, des noch nicht Angekommenen oder auch des sich ›wie im falschen Film‹ Befindlichen. Die heute gerne in Talkshows zum Besten gegebene dämlichste Entschuldigung für mangelnde Geistesgegenwärtigkeit: Da habe jemand neben sich gestanden, wird zur Maxime solcher Bildhauerei, führt aber auch zu den sorgfältig verzagt inszenierten Ausstellungen des Malers Michael Krebber. Die Nähe zu kalkuliertem Dilettantismus, auch zu einem Bad Painting Good Art ist unübersehbar, doch es bleibt der Unterschied: Wer Beiläufigkeitskultivierung betreibt, sucht nicht die Transsubstantiation des charismatisch Schlechten ins Gute, sondern des Übersehenen ins Vielbeachtete.
Bekunstung
In der Neuwortschöpfung ›Bekunstung‹ wird das zu ›Kunst‹ denkbare Verb ›kunsten‹ transitiviert, also zu ›bekunsten‹– das heißt, es zielt oder bezieht sich auf etwas –, um dann resubstantiviert zu werden in den Allgemeinbegriff. Man kann sich das ungefähr so vorstellen wie bei dem neuerlich in Mode gekommenen (allerdings aus einem Adjektiv entwickelten) Begriff ›Behübschung‹. Wenn Journalisten ihn verwenden, versteht man sofort, dass einer bereits bestehenden Sache etwas widerfährt: Sie wird hübsch gemacht oder um es genauer und so abschätzig auszudrücken, wie es seitens der Journalisten gemeint sein dürfte: Sie wird mit als hübsch geltenden Merkmalen nur auf akzidentelle Weise umlagert oder überdeckt.
Durch Bekunstung wird Kunst also nicht neu geschaffen – und ebenso wenig wird etwas nur zur Kunst erklärt. Stattdessen werden Situationen oder Gegebenheiten von Kunst ummäntelt oder in Beschlag genommen. Die künstlerische Initiative, der künstlerische Eingriff, den eine Sache, ein Mensch oder ein Raum über sich ergehen lassen, müsste allerdings, damit von Bekunstung die Rede sein könnte, derart äußerlich und oktroyierend sein, dass ästhetische Verwandlung nicht zum Zuge käme. Nehmen wir dazu an, ein Künstler würde die Balkontür eines Kunstvereins oder Museums, die sonst aus konservatorischen und sicherheitstechnischen Gründen stets verschlossen gehalten wird, nun auf einmal für das Publikum öffnen, woraufhin sich Besucher der Ausstellung gegenüber Passanten unten auf der Straße nolens volens selbst als eine Art lebender Exponate darböten. Bei einer solchen Intervention wäre die ästhetische Verwandlung tatsächlich vergleichsweise schwach – doch auch schwach genug? Dies wäre erst der Fall, wenn der künstlerische Impuls derart unvorbereitet und dauerhaft zusammenhanglos auf Nichtkünstlerisches träfe, wie sonst vielleicht nur drop sculpture im öffentlichen Raum auf ihren Aufstellungsort. Dieser neuerlichen Zusammenhanglosigkeit als Tugend, auf die eine Künstlerin wie Katharina Grosse stolz ist – weil es in ihren Augen Nichtkorrumpierbarkeit indiziert, wenn sie über mehrere Räume hinweg Farbe sprüht und dabei bewusst ihre ›Bildträger‹ ignoriert –, begegnet man nun häufiger. Invasiv werden Gebäude auf eine Weise in Beschlag genommen, dass die Unangemeldetheit der Bekunstung zur Großherrenart neigt. Das künstlerisch dem Bekunsteten Inkommensurable, aber eben Oktroyierte wird zu einer besonders kühnen Autarkie stilisiert, liebäugelnd mit dem → Amoralismus eines acte gratuit.
In der latent ordinären Begeisterung einer großspurig gewordenen Kunstwelt für das Unverhoffte, das sich eines Ortes oder einer Person oder einer Gruppe bemächtigt hat, in der Bewunderung der asozialen Geste des Überfalls durch Kunst (»Wow!«) steckt der Glaube, diejenigen, die durch Kunst nicht mehr zu erreichen sind, durch Bekunstung wenigstens noch ereilen zu können.
Neben der markigen gibt es übrigens auch eine leisetreterische Variante der Bekunstung. Das wäre jene Art künstlerischer Geste, die nach dem Vorbild neuerer Werbung viral oder parasitär über den öffentlichen Raum, über das Bewusstsein der vielen Einzelnen sich auszubreiten gedenkt. Die Betrachter bzw. Kunstkonsumenten werden dabei als unfreiwillige Erfüllungsgehilfen gedacht, etwa indem sie unwissentlich einen bestimmten Duft oder einen Aufkleber weitertragen. Diese Variante der Bekunstung versucht den vollmundigen Messianismus der frühen Avantgarden durch Rollenumverteilung geläutert fortzusetzen. Das Publikum ist nicht länger nur Empfänger der frohen Botschaft, sondern unfreiwillig deren Agent – unübersehbar dabei die Tendenz zur → Partizipationsfolklore.
Belanglosigkeitsausdifferenzierung
Normalerweise stellen wir uns die Reihenfolge so vor: Weil etwas interessant, wichtig oder schön ist, wird es nicht nur Gegenstand der Kunst, sondern es kann in ausgewählten, die Besonderheit dieses Gegenstandes unterstreichenden Fällen auch zu regelrechter Serien- und Variationsbildung, zu Ausschmückung und Ausdifferenzierung kommen. Die Geschichte der Kunst liefert dafür zahllose Beispiele, etwa im Hinblick auf die Verbreitung und Abwandlung beliebter Motive und gelungener Kompositionen durch Stiche.
In der jüngeren Kunst verläuft es mitunter jedoch genau umgekehrt: Bloß weil eine Sache, und sei sie auch noch so belanglos, nicht nur einmal, sondern sogleich vielfach in Variation dargeboten wird, gewinnt und bindet sie überhaupt erst Aufmerksamkeit, die ihr andernfalls nie zuteilgeworden wäre. Dabei ist wohlgemerkt weder die Rede von identischer Reproduktion (Warhol-Effekt) noch von jenem Omnipräsenzzwang, der heute zum Künstlertum nicht anders als zu Produkten der Wirtschaft gehört und demzufolge die einem Künstler gezollte Anerkennung wesentlich davon mitbestimmt wird, wie häufig er als Name oder Marke auf den Plan tritt.
Um den hier greifenden Mechanismus zu erörtern, stellen wir uns zunächst den Blick in die geöffnete Garage irgendeiner Wohngegend vor – ein selbst für unverbesserliche Verfechter optischer Selbstkasteiung wohl nicht sonderlich attraktives Sujet, das meines Wissens bislang noch nicht sein Debüt in der Fotokunst erlebt hat. Denken wir uns jetzt aber diesen Einzelfall als Teil einer ganzen Serie von Ausgaben dieses Motivs, so stehen die Chancen auf Akzeptanz im heutigen Kunstkontext sogleich um einiges besser. Warum ist das so? Schon bevor wir uns auf wirkliche Fotosafari machen, fallen uns herrliche Beispiele ein von entsprechenden Garagen, die wohl vor Jahrzehnten mal so klein wie möglich und so groß wie nötig errichtet worden waren. Und die Hausherren, die diese Garagen einst erbaut hatten, konnten später entdecken, dass sich neben dem Auto auch noch allerhand andere Dinge darin würden unterbringen lassen. Und zwar etliche, nach Möglichkeit nicht allzu sperrige Güter, denen ein unbeheizter, von dicken Spinnen bewohnter, nach Benzin müffelnder Raum nichts würde anhaben können. Und irgendwann war dieser Kompromiss zu einer Inneneinrichtungsform sui generis geworden, weil die schlanken Autos, für die man solche Garagen ursprünglich gebaut hatte, nach und nach ersetzt wurden durch dickere geländegängige Fahrzeuge, die deshalb auch meistens draußen auf der Straße parken. Jedenfalls schweift nun unser Auge über all die halbprofessionellen Hilfskonstruktionen, Aufhängungen, Schichtungen usw., die recht auskunftsfreudig sind in Bezug auf die Bewohner des dazugehörigen Hauses, unter Umständen sogar im Hinblick auf die geringe bis große Nähe oder gar den baulichen Übergang zu diesem Hause. Die Art der Unterbringung dort befindlicher Geräte, ihres Verstelltseins oder ihrer Erreichbarkeit zeugt von ihrem Wert, kündet davon, wie lieb oder unwichtig sie ihren Besitzern im Laufe der Zeit wurden. Unschwer ließen sich hier Debatten über Architektur, über eine Soziologie des mittelständischen Wohnens anschließen, über Garagen als Refugien einer bürgerlicherseits sonst vermaledeiten Mentalität der Bricollage, über Hinterbühnen des Lebens, die nun auf einmal in helles Licht getaucht sind, usw. usf. – man ahnt schon, was Kunstkritiker oder Katalogautoren alles aufbieten könnten, um die entsprechende Serie eines Fotokünstlers, der, wie man so sagt, ›einfach nur draufhielt‹, über den grünen Klee zu loben. Doch zu behaupten, es sei die Leistung dieses Künstlers, die oben getätigten Überlegungen angestoßen zu haben, wäre ungefähr so vermessen, als würde man jemandem, der sich kriminell mit einer Reihe jeweils einander ähnlicher Einbrüche hervortat, nun kriminologische Verdienste bescheinigen. Denn tatsächlich hatte uns das Thema ›geöffnete Garagen in Vorstadtsiedlungen‹ eingangs nicht tangiert. Es wurde daher also auch nicht breitgetreten bzw. diversifiziert, weil es so interessant war, sondern umgekehrt: Es wurde interessant, weil es breitgetreten bzw. diversifiziert wurde!
Zynische Apologeten könnten vorbringen, die Künstler wiederholten damit doch nur intragenerativ, was die Evolution intergenerativ vorgemacht habe: Dort seien der emergenten Phänomene und der Variationen einzelner Entwicklungen zuhauf; und Künstler, die sich als Belanglosigkeitsausdifferenzierer betätigten, stünden sozusagen im stillen Einklang mit der Schöpfung (was freilich bereits auf evolutionstheoretischem Gebiet nicht stichhaltig wäre, weil es die Selektion unterschlüge).
Doch wie kommt die Wirksamkeit des Prinzips Belanglosigkeitsausdifferenzierung zustande? Man könnte zunächst an sogenannte noncontingent reward experiments denken, bei denen zum Beispiel im Zuge einer Zusammenstellung völlig willkürlicher Zahlenpaare der die Passung beurteilenden Versuchsperson eine steigende Trefferquote vorgegaukelt wird, woraufhin es zur Hypothesenbildung durch die Versuchsperson und zur Aufrechterhaltung entsprechender Hypothesen sogar noch nach Aufklärung über den Versuchsaufbau kommt. Solche Experimente veranschaulichen unsere Bereitschaft, auch Sinnloses auf latenten Sinn hin abzusuchen und bereits dürftigsten Anhaltspunkten für etwaige Zusammenhänge großes Gewicht beizumessen. So gesehen ist es fast sicher, dass geistig bewegliche Betrachter angesichts einer Zusammenstellung ähnlicher und zugleich unkonventioneller Motivgruppen wacker zur Thesenbildung schreiten werden.
Eine pfiffige Antwort auf die Frage nach der Wirksamkeit des Prinzips Belanglosigkeitsausdifferenzierung könnte darauf hinauslaufen, es profitiere davon, dass es immer schon, also auch in außerkünstlerischen Zusammenhängen, wichtige, jedenfalls erfolgreiche Dinge sind, die überhaupt einer Ausdifferenzierung für Wert erachtet werden bzw. eine solche nach sich ziehen: Ausdifferenziertes muss sich bereits irgendwie bewährt haben! Folglich heißt es für die Künstler, nach Kräften Ursache und Wirkung verkehren, auf dass das nur genügend ausdifferenziert Dargebotene schon per se Bedeutsamkeit generiere.
Hinzuzurechnen wäre der rezeptionsstimulierende Aspekt des Verfahrens ›Variation‹: Denn Variationen (mit denen wir es bei dieser M. d. K. ja mehr oder weniger zu tun haben) sind nicht einfach irgendwelche Änderungen oder Wechsel, sondern ihnen liegt eine nachdrückliche Konstante zugrunde, gegenüber der die oft geringfügigen Unterschiede deutlich hervortreten. Das Betrachten und das Nachvollziehen einer Variation erheben uns also stets zum Experten; Variationen geben uns Gelegenheit, über die Nichtigkeit des Anlasses hinaus uns selbst in unserer Fähigkeit zur Nuancierung zu spüren. Dies wohl begründet den andernfalls unerklärlichen Ernst, mit dem sich Jury-Mitglieder Jahr für Jahr allen möglichen Beispielen für Belanglosigkeitsausdifferenzierung in Reinkultur zuwenden, ohne dass einer der Anwesenden auch nur eine Miene verziehen würde. Fragt sich anfangs manch einer durchaus, warum diese oder jene Belanglosigkeit seine Aufmerksamkeit verdienen sollte, so folgt doch das unausbleibliche Wunder: Die ausgebreiteten Variationen wecken tief in seinem Innern den Ordner, den Weltversteher und Wissenschaftler, vielleicht den Visuellen Soziologen oder den Kulturwissenschaftler mit Faible für Alltäglichkeiten, der er nie war. Und zu diesem Zeitpunkt hat die Falle längst zugeschnappt! Der Betreffende befindet sich nämlich bereits in einer Binnendiskussion, etwa darüber, ob der junge Künstler (um das Beispiel mit den ›geöffneten Garagen in Vorstadtsiedlungen‹ aufzugreifen) nicht auch das jeweilige soziale Milieu der Garagenbesitzer hätte dokumentieren oder das Ganze doch besser zu einer bestimmten Jahreszeit hätte fotografieren sollen usw.
Von der Belanglosigkeitsausdifferenzierung gibt es fließende Übergänge hin zu dem, was man landläufig als ›Spezialität‹, ›Monopol‹ oder ›Individualmasche‹ (→ Einleitung) eines Künstlers überhaupt bezeichnet und was sich in respektlosen Epitheta wie zum Beispiel ›Nagel-Uecker‹ niederschlägt. Letzteres trägt zweifellos zwei Dingen Rechnung: dem Zwang zur Spezialisierung, ohne die der Einzelne auch auf künstlerischem Gebiet dilettieren müsste; und dem Zwang, eine Marke, etwas Wiedererkennbares auf dem großen und unüberschaubaren Kunstmarkt zu werden. Zu behaupten, die Belanglosigkeitsausdifferenzierer machten doch nur im Kleinen, nämlich im einzelnen Werk, was etliche berühmte Künstler lebenslang täten (Individualstil), unterschlüge indes, dass es im letzten Falle genau umgekehrt verlief: Ein zunächst einmal solitär interessanter Einfall hatte Durchsetzungskraft entwickelt und war daraufhin erst zum Dauerbrenner geworden.
Ein regelrechter Infektionsherd der Belanglosigkeitsausdifferenzierung liegt seit den 1970er Jahren dort, wo das Sammeln als Kunst auftritt – wenngleich das Sammeln eher retrospektiv und Belanglosigkeitsausdifferenzierung eher prospektiv auffächernd wirkt. Unbestreitbar macht es Freude, irgendwelche auch noch so trivialen Dinge zu sammeln, weil es, wie sich aus dem bereits Dargelegten ergibt, bei genügend großer Variationsbreite den Experten in uns aufruft – im Sammelnden wie auch im gegebenenfalls interessierten Betrachter. Dass dies allein bereits genug der Leistung wäre, die man innerhalb bestimmter Sparten dem Künstler abverlangen würde, konnte zunächst niemand voraussehen. Beispielsweise hat Arthur C. Danto in seiner »Verklärung des Gewöhnlichen« den Kontext verantwortlich gemacht für die Aufwertung etlicher Banalitäten, während es doch (übrigens seit ziemlich genau der Zeit, da Dantos Studie erschien) viel häufiger vorkommt, dass schlichte Belanglosigkeitsausdifferenzierung diese Verwandlung besorgt.
Aufschlussreich – und als künstlerischerseits gratis gelieferte Bestätigung meiner Ansichten über diese M. d. K. – erscheint mir, dass Künstler auch bereits dazu übergegangen sind, Belanglosigkeitsausdifferenzierung ganz unverhohlen zu thematisieren, statt dass sie ihnen bloß unterliefe. Nämlich wenn zum Beispiel sorgsam zum Raster gehängte Fotografien eines aus vermeintlich mannigfachen Blickwinkeln erfassten Objekts bewusst eine falsche Fährte legen, indem sie in uns die Vermutung anstacheln, hier sei ein Naturphänomen minutiös erkundet worden, es sich in Wahrheit aber um bloße Konstruktion eines Modells handelt – und eben diese Konstruiertheit durch die Betrachter erfahrbar werden soll.
Übrigens weisen auch die Fotosammlungen des Hamburgers Peter Piller in diese Richtung: Von Kunstliebhabern hochgeschätzt ob seiner Fähigkeit, den absurdesten und trivialsten Themen gerade dadurch Komik und Relevanz zu entlocken, dass er unbeirrbar umfangreiche Bildsammlungen dazu anlegt, könnte seine Arbeit doch auch als ironischer Reflex auf den dank Belanglosigkeitsausdifferenzierung gleichsam automatisch sich einstellenden Aufwertungseffekt gelesen werden.
Postskriptum:
Monate nach Fertigstellung dieses Artikels, ich hatte im Rahmen einer Vorlesung zu M. d. K. auch das Thema »Belanglosigkeitsausdifferenzierung« behandelt, machte mich eine meiner Studentinnen aufmerksam auf das von mir für nicht möglich Gehaltene: Es gibt da tatsächlich Simone Demandts Serie Freude am Leben (seit 2001), quadratische »Color-Prints hinter Plexiglas, die die autolose Innenansicht von Garagen« zeigen. Die Selbstbeschreibung der Fotografin und die instruktiven Erläuterungen eines Kunsthistorikers zu dieser Serie liefern denn auch eine gleichermaßen belustigende wie gespenstische Bestätigung meiner Überlegungen, weil die Künstlerin und ihr Autor zwar etliches von dem erfassen, was auch in meinem Text zu finden ist. Mit dem gravierenden Unterschied freilich, dass ich mir eine Serie über dieses Sujet samt Deutungen dazu eben wirklich nur ausgedacht hatte – was ja gerade deshalb funktionierte, weil es dazu in der Hauptsache deutungshungriger Betrachter und nur in der Nebensache inspirierender Fotografien bedurfte! Über die wirklich in Angriff genommenen Garagenbilder heißt es dann im Katalog des Museums Ritterhaus, Offenburg, (2003) in aller Ernsthaftigkeit:
»Das Sujet der Serie ›Freude am Leben‹ (…) ist auf den ersten Blick ungeheuer banal: Garagen. Dadurch jedoch, dass die Photographin einen systematischen, streng geregelten photographischen Blick auf dieses scheinbar banale Sujet richtet, dass sie eine weitgehend neutrale, in ihren äußerlichen Determinationen festgelegte Reihe erzeugt, in welcher sie eine Art typologischer Aufzeichnung unternimmt, beginnt dieses scheinbar banale Sujet, eine erstaunliche Vieldeutigkeit und Unlesbarkeit zu enthüllen … «