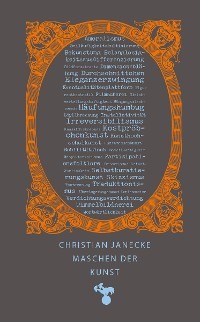Kitabı oku: «Maschen der Kunst», sayfa 3
Bildformatrente
Wenn ›Prestigerente‹ die schmeichelhafte Nachwirkung ehemaligen Ansehens meint, dann könnte gelten: Wer Bildformatrente kassiert, der profitiert von Effekten bildformattypischer Eigenschaften auch noch jenseits des tatsächlichen Mediums ›Bild‹. Voraussetzung dafür wäre natürlich die Ablösbarkeit solcher Eigenschaften vom Bild selbst – sie würden im Ensemble zum stabilen Schema.
Nun könnte bildformattypisch ja vieles sein: das Zentrierende einer bildbegrenzenden Quadrat- oder Kreisform, das den Umriss einer Sache Bekräftigende eines Versatzstücks, das Additive eines Panoramas, das modular Gefügte oder das von innen nach außen Entwickelte eines Shaped Canvas, das Fortlaufende eines Frieses oder das Vielzellige eines Polyptychons. Doch sind dies sämtlich Spezialfälle, Ausnahmen von einer Regel, die auf das rechtwinklige Format in maßvollem Verhältnis von Höhe zu Breite hinauswill, eines Formates, das die Wände eines jeden gut sortierten Museums der Malerei füllt, und zwar mindestens die Abteilungen vom 16. Jahrhundert bis in unsere Zeit.
Zu den Ursachen für den unerhörten Erfolg dieses Modells gehören historisch gesehen gewisse Konventionen. Es ist nicht übertrieben, mittlerweile sogar von regelrechten Instituierungen auszugehen – bis hin zu entsprechend vorformatiert aufgezogenen Leinwänden des Malereibedarfshandels. Aber es kommt auch ein Faktor ins Spiel, den jeder Kulturalist am liebsten ausblenden würde: das Naturgesetz der Schwerkraft. Ihm antwortet auf unserem Planeten ein aufrechtes Stehen, sprich ein rechter Winkel sowohl des Menschen als auch vieler Tiere und Bäume zur Horizontale der Erdoberfläche, in der Folge aber auch all der Bauten und unzähligen Dinge, mit denen der Mensch sich umgibt. Diese gewissermaßen von Natur aus vorbereitete, per Kultur fortgesetzte Vorstrukturierung findet im rechtwinkligen, lotrecht auf horizontal zu denkenden Bildformat nicht einfach nur Widerhall, sondern eine starke Entsprechung. Denn dieses Format gewährleistet eine von Inkaufnahmen verschonte Darstellung ohne verunklärende Wegschnitte weitaus besser, als alle Alternativen es vermöchten (was übrigens eine ganz ähnliche Beharrungskraft der typischen Bühnenportalform im Theater seit der Renaissance sowie die weitaus späteren, konventionalisierten Übernahmen dieses Formates in Bewegtbildmedien bis hin zu sämtlichen digitalen Displays unserer Tage erklärt).
Die bislang noch außer Acht gelassene maßvolle Längung der rechtwinkligen Bildform wiederum ergab sich im Typus des Hochformats historisch aus der Aufgabe der Personendarstellung, insbesondere im Porträt, hingegen beim Querformat aus einem plausiblen Kompromiss: zwischen raumzeitlicher Punktualität des Bildlichen (wie beim Tondo oder Quadrat) und dessen raumzeitlicher Nebeneinanderordnung bzw. Reihung (wie beim Panorama oder Fries). Über die Feinabstimmung dieses Verhältnisses genauso wie über die von ihnen jeweils favorisierte Bildgröße geben denn auch heutige Künstler bereitwillig Auskunft – und denken nicht einmal daran, die Hauptsache zu erklären, warum sie ausgerechnet ein rechtwinkliges Format verwenden. Darin erblicken sie bloß eine Selbstverständlichkeit, die noch den unschätzbaren Vorteil hat, neutral zu wirken, wie eine Matrix, relativ zu der abweichende Lösungen erst Kontur gewinnen.
Wie viel Berechtigung oder vielleicht sollte man sagen, wie viel Gewohnheitsrecht darin steckt, wird man anerkennen, sobald man festgestellt hat, dass die Ablösbarkeit der Bildformateffekte vom Bild – also genau das, was wir als Bildformatrente verfolgen – interessanterweise bereits im Bild selbst beginnt: Während man nämlich bei abstrakter Malerei des frühen 20. Jahrhunderts eine entsprechende Formattreue noch ganz gut mit Verweis auf die Ableitung und Entfaltung der Abstraktion aus ehemals gegenständlichen Zusammenhängen oder Szenerien erklären könnte, kommt man bei späteren, gänzlich monochromen Bildern oder der Allover Structure eines Jackson Pollock kaum an dem Verdacht vorbei, es spiele eben doch Anciennität eine Rolle: so, als wäre die Althergebrachtheit des typischen Bildformats stark genug, den Bildern an Rückhalt zu geben, was die Maler ihnen innerbildlich auch immer austreiben mochten – und verkäuflicher blieben die Sachen im probaten Bildschema allemal.
Die zweite Stufe einer Ablösung der Bildformateffekte vom Bild ist dort erreicht, wo faktisch gar kein Bild mehr vorhanden ist, aber nach Kräften daran erinnert wird: Seien es aufgehängte Keilrahmen von Imi Knoebel oder Bildabnahmen von Timm Ulrichs mit zurückbleibenden Wandspuren – stets reicht die Aufbietung der Eckdaten des typischen Bildgevierts schon hin, um zu evozieren, was faktisch fehlt. Solche von Ulrike Lehmann und Peter Weibel einst unter »Ästhetik der Absenz« verbuchten Fälle profitieren zwar vom Nachwirken des Bildes im Modus des Stumpfschmerzes, loten diesen Effekt aber durchaus bewusst aus, weshalb es ihnen nicht als M. d. K., sondern nur als mäßige Originalität angekreidet sei.
Die dritte Stufe ist erreicht, wenn ein künstlerisches Medium offiziell mit bildindifferentem Anspruch – sei es auf Weltverbesserung, auf Sammlung von Fakten oder Dingen, sei es auf konzeptuell motivierter Darbietung oder auch Partizipation – antritt, ohne dass doch verzichtet würde auf die unterschwellige Wirkung des Bildes, nämlich vermittels seines hier als typisch explizierten Formates. Man denke bloß an die räumlich dispositiven Lösungen institutionskritischer oder anderweitig politisch ambitionierter Kunst, wie sie seit den 1990er Jahren vorzugsweise in Einrichtungen wie der Wiener Generali Foundation oder der Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig dargeboten werden: Schautafeln, Diagramme oder noch drögere Kost hält sich an der Wand, während davor in Vitrinen oder auch lose auf Tischen Informations- oder Betätigungsmaterial ausgelegt wird, vielleicht noch irgendwelche Formulare, die der Besucher ausfüllen darf. Auch die sogenannte Dienstleistungskunst der 1990er Jahre und der installativ vorgehende Dokumentarismus unserer Tage, schließlich etliche im Bildformat ausgelegte Bodenarbeiten kassieren Bildformatrente, indem sie vordergründig die Entsublimierung eines politisch oder anderweitig motivierten Anliegens betreiben oder sich darstellungsabstinent und literalistisch gerieren, unterschwellig aber bildliche Absolution suchen.
Die allgemeine Verbreitung des Prinzips Bildformatrente könnte zu der Einsicht verleiten, alle historischen Fluchtversuche aus dem als kontaminiert erachteten Bild landeten nach Umwegen über bildindifferente und antibildliche Ausdrucksweisen früher oder später wieder genau dort – wenn schon nicht explizit, so doch implizit (eine Einsicht, die betrüblich ohnehin nur für diejenigen wäre, die von außerkünstlerischer Praxisrelevanz der Kunst träumten). Bedeutsamer erscheint mir, dass uns mit dem Konzept der Bildformatrente ein Mittel wenn schon nicht der Analyse, so doch wenigstens der Dingfestmachung jener andernfalls opak oder idiosynkratisch bleibenden Entscheidungen heutiger Starkünstler für diese oder jene Dimensionierung einer Stellwand, eines Durchganges oder vielleicht auch nur eines Vorhanges an die Hand gegeben ist. All diese Details und Epiphänomene in großen, gern installativen Arbeiten auf einer Biennale, die dem Laien undurchschaubar, dem Kunstfeind geschmäcklerisch und dem Kunsthistoriker als Undeutbarkeitsrest anmuten dürften, würden sich wohl oftmals durch solche Effekte nachzeichnen lassen. Die unentwirrbare Überlagerung solch künstlerischerseits habitualisierter, den Künstlern aber nicht stets voll bewusster Kunstgriffe erzeugt, wie ich finde, jenen schwer sprachfähig zu machenden ›Look von Kunst‹ mit, der längst Teil von Kunst wurde. Das heißt aber, dass bestimmte Partien heutiger, zumal komplexer und vorderhand gar nicht als Bild auftretender Werke in dem Sinne ›spuken‹, als in ihnen entleerte Schemata ereignisverdichtenden Erzählens oder auch ›hoch auf quer‹ dimensionierte Figurationen potentiell sinnhaften Zeigens irrlichtern. Die mit sich zufriedenen Künstler können dann die Arme in die Hüfte stemmend tönen, dass ihre Arbeit so – und nur so – stimme. So wenig wie die meisten ihrer Betrachter ahnen sie, inwieweit ihr Werk dabei von gewissen Eigenschaften des Bildes zehrt, die längst in den Untergrund gegangen sind.
Dimensionsblähung
Normalerweise unterliegen visuell dargestellte Dinge einer dimensionalen Verringerung. Auf dem Zeichenblatt wird, vereinfacht gesagt, der Ball zur Kreisscheibe, der Stab zum Strich. Auch Skulptur suspendiert eine Dimension, und zwar die der Zeit, die sich ja an den Dingen und an dem, was lebt, viel aufdringlicher bemerkbar macht.
Doch was wäre eigentlich das exakte Gegenstück, also dimensionale Erweiterung? Ehrgeiziger Illusionismus oder sogar vollendete Täuschung sind es jedenfalls kaum, obwohl solche sehr extremen Darstellungsabsichten durchaus darauf bauen, dimensionale Verringerung auszugleichen oder sie uns gar nicht erst merken zu lassen. Also müsste man wohl eher an gewisse Animationen denken: An flache und noch dazu unbewegte Dinge der Wirklichkeit, vielleicht Briefmarken eines Albums, die dank eines Zeichentrickfilms aber vor unseren Augen zu tanzen beginnen; oder wir erinnern uns an den Steinernen Gast aus Mozarts Don Giovanni, als der der getötete Commendatore gleichsam aus der ihn darstellenden Statue anklagend spricht. Gerade an solchen und weiteren pygmalionischen Beispielen ersieht man, dass dimensionale Erweiterung die seltene Ausnahme ist, dass sie in alter Zeit eher einer Laune der Götter und modernerweise einer Laune der Technik gehorcht; dass sie zwar denselben Weg wie die Darstellung nutzt, auf diesem Weg aber die genau entgegengesetzte Richtung einschlägt – nämlich nach gut dilettantischer Art nicht vom Leben zur Darstellung, sondern von dieser zu jenem.
Nun gibt es eine Unterart der dimensionalen Erweiterung, die ich lieber mit dem abschätzig klingenden, aber viel genaueren Ausdruck der Dimensionsblähung bezeichnen würde, weil man sich die Ausdehnung in die dritte Dimension hierbei völlig mechanisch vorstellen muss, so als wollte man auf einer flach aufliegenden Münze mit einem Mal einen ganzen Stapel von Münzen türmen, ohne dass auch nur eine von ihnen aus dieser zylindrischen Formation ausbräche. Oder als würde aus der schmalen Laubsägearbeit einer Kuh-Silhouette ein im Querschnitt kuhförmig gearbeiteter Holzring, ganz so wie ihn erzgebirgische Spielzeughersteller beim Reifendrehen erarbeiten, um davon jede Menge Scheiben in Kuhform absägen zu können – bloß dass wir uns diesen Holzring nun als reinen Selbstzweck vorstellen müssten. Oder man denke an das Relief, das ein Steinmetz den Buchstaben einer Grabplatte oder ein heutiger Typograf am Computer irgendwelchen Fonts verleiht: nur eben nicht länger in maßvollem Verhältnis zur Flächenausdehnung der Buchstaben, um der besseren Lesbarkeit willen als moderate Hervorhebung, sondern als vektoriell entfesselter Aufwuchs, wodurch alles an ihnen gründlich auseinandertritt. Denn die flachen Buchstaben werden jetzt zwar etwas, sie materialisieren sich, zugleich aber sind sie sozusagen nur noch eine Eigenschaft jener monströsen Stapelungen, zu denen sie wurden. Das Plakat zu dem TV-Mehrteiler nach Ken Folletts Die Säulen der Erde gibt dafür ein anschauliches Beispiel: Obwohl jeder einzelne Buchstabe des Filmtitels einem Turmbau zu Babel gleich die Wolken überragt, bleiben die einzelnen Buchstaben für diese Türme und für die Menschlein, die sich den gotisierenden Fassaden dieser Türme gegenübersähen, nichts weiter als eine inwendige, nicht entzifferbare, ja unüberschaubare Prägung – überschaubar und lesbar werden sie nur für uns als Plakatbetrachter, die wir aus dem Himmel hinabschauen auf die Buchstabendächer in ihrer semantischen Anordnung.
Dank diverser, immer ausgefeilterer Typografie- und Grafikprogramme wird es heute zusehends unaufwendiger und daher verlockender, alles Mögliche einfach mal sinnfrei in die Höhe schnellen zu lassen: Nicht nur Buchstaben oder Ziffern, prinzipiell alles lässt sich wie auf Knopfdruck aus der Zweidimensionalität herausstülpen oder ebenso akkurat und ohne Erosionsverlust in sie hineinsenken. Es ergibt sich dabei, wie meine Beispiele schon andeuteten, keineswegs nur eine quantitative Veränderung, wie es das Bild des an die Stelle der einen Münze tretenden Münzstapels nahelegen könnte. Vielmehr wird die Perspektive des Betrachters mit verschoben: von der ursprünglichen Aufsicht (auf die eine Münze) zur Ansicht (des Münzstapels). Der Stapel gibt dann das, woraus er gestapelt wurde, gar nicht mehr preis, hat es inkorporiert. Die solcherart ersetzende und verwandelnde Wirkung der Dimensionsblähung ist eine veritable Waffe in der Hand einfallsloser Gestalter. Denn aus jeder Null – im buchstäblichen wie im übertragenen Sinne – ist ja jetzt noch etwas herauszuholen.
Was hat die Kunst damit zu tun? Dass es auch hier Beispiele gibt – erinnert sei an Thomas Scheibitz’ farbige Plastiken spitziger, dimensionsgeblähter Zahlen oder an Pietro Sanguinetis piekfeine Buchstabenwelten, in denen Worte wie ›super‹ ein entsprechend aufgepepptes Eigenleben führen – erscheint eher harmlos und nimmt es mit den aus dem Ruder laufenden Entwicklungen in Grafikdesign und Motion Graphics in keiner Weise auf. Doch nun heißt es abwarten. Es wäre nicht das erste Mal, dass in den technisch aufgerüsteten Fabrikationen der Bild- und Schriftbildkommunikation Entwicklungen offenbar werden, die sich in der Kunst erst nach und nach manifestieren.
Durchschnittchen
Vom Durchschnitt lassen wir uns heute kaum mehr gängeln: Alexander Kluges Filmtitel In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod wurde fast geflügeltes Wort. Und unsere Erheiterung ob des Kalauers, dass, wer morgens Erfrierungen und abends Verbrennungen erleide, sich hinsichtlich der Temperatur ›durchschnittlich wohlgefühlt‹ haben müsse, zeigt bereits, wie weit man heute von einer Statistikgläubigkeit der Spätmoderne abgerückt ist.
Diese Skepsis konnten bereits Komar & Melamid voraussetzen, als sie ihr Projekt The most wanted and the most unwanted painting (1995 – 97) starteten mit einer nach Ländern aufgeteilten Erfragung der Betrachterpräferenzen hinsichtlich Farbe, Bildgröße, bevorzugten Themen, prozentualem Naturanteil am Sujet und anderem mehr. Dass die Kumulation durchschnittlicher Einzelparameter zu etwas führte, was so ganz sicher niemand gewünscht hätte, wurde damals von Arthur C. Danto hervorgehoben, aber man hätte es auch sonst gewusst.
Und dennoch scheinen viele nur auf eine Gelegenheit zu warten, dem Durchschnitt die Reverenz zu erweisen. Beispielsweise, wenn Journalisten wieder einmal über Ergebnisse der empirischen Attraktivitätsforschung berichten und halb ungläubig, halb verschmitzt herausposaunen, ausgerechnet der Durchschnitt bringe das schönste Gesicht hervor! Konkret bestaunen sie in diesem Zusammenhang, dass die Überlagerung etlicher kaum bemerkenswerter Gesichter zu beachtlicher Schönheit eines Gesichtshybrids führe. Dass es sich bei solcher Überlagerung tatsächlich um eine alles andere als durchschnittliche, vielmehr hoch unwahrscheinliche Häufung von Einzeldurchschnittswerten handelt, kümmert die Berichterstatter dann wenig. Sie haben genug gehört und wollen partout glauben, Durchschnitt, wahrer Durchschnitt eben, sei etwas, das vom Mediokren nur umzingelt werde, dieses aber beizeiten überstrahle.
Woraus sich diese insgeheime Gunst speist, mag ein beliebiges Beispiel verdeutlichen. Denken wir uns dazu hundert Menschen unterschiedlichster Körpergröße beisammen. Ein jeder von ihnen würde jetzt zu jenem Durchschnitt sämtlicher Körpergrößen beitragen, dessen Wert auf keinen einzigen der Versammelten zutreffen müsste. Die Autorität des resultierenden Durchschnitts würde deshalb gerade dem Verzicht auf subjektive Wahl, ja überhaupt auf Auswahl entspringen, wie sogar eine Stichprobe sie noch vorausgesetzt hätte. Nicht diese oder jene Körpergröße wäre in diesem Beispiel maßgeblich, sondern alle zugleich, die nun addiert und durch die Anzahl aller geteilt würden. Aus sämtlichen konkreten Einzeldaten würde ein Datum, eine Gegebenheit, die doch gar nicht ›gegeben‹ wäre, sondern als körperlose, imaginäre, aber höchst präzise Demarkation alles durchzöge.
Obwohl der Durchschnitt die Gegebenheiten achtet, sie am Ende verrechnet und er insofern als redliche Nachträglichkeit auftritt, scheint er aus der Warte des Einzelnen, der, ob er will oder nicht, zu ihm beiträgt respektive als Datum in ihn einfließt, doch auch etwas Vorausgehendes zu verkörpern, indem er diesem Einzelnen vor Augen führt, wie geringfügig sich jedwede seiner Eskapaden auf den Durchschnitt aller auswirken müsste. Aus diesem Grund erinnert er uns immer auch an das Unbeirrbare uralter mächtiger Institutionen, das jeden Häretiker einzuschüchtern vermag. So ist der Durchschnitt zwar Ergebnis einer vom Menschen vorgenommenen Prozedur, steht ihm, indem er seine Fabriziertheit vergessen zu machen versteht, aber rechthaberisch, ja allwissend gegenüber. Und etwas davon meinen wir auch in dem leicht leeren Blick des noch jungen Timm Ulrichs zu lesen, wie er seinerzeit für ein Foto die Pose des ›personifizierten statistischen Durchschnittsmenschen‹ einnimmt: in Hand und Mund sechseinhalb Zigaretten und vor sich ausgebreitet allerhand Konsumartikel, die täglich in Deutschland pro Nase – im Durchschnitt – angeblich verbraucht wurden.
Der gleichermaßen objektivistische wie auch leicht numinose Zug des künstlerisch visualisierten Durchschnitts – wir nennen es Durchschnittchen – prädestiniert ihn heute für gefühlt linke Positionen, weil sich damit ein Moment des Realismus ohne Kleineleutegeruch halten lässt. Das bloß Durchschnittliche, für das sich freilich niemand interessiert, wurde ja purgiert zum Durchschnitt! Nichts anderes raunt uns jene Ästhetik einer wieder einmal fotografischen Unschärfe entgegen, die mit der transparenten Überlagerung von Bildern im Internet hantiert: Sei es, dass Meggan Gould zu einem Suchbegriff wie vielleicht »Mona Lisa« oder »Coke + Can« die jeweils genau einhundert zuerst sich auftuenden Google-Bildeinträge digital verschmiegt oder dass Corinne Vionnet unzählige im Netz kursierende touristische Schnappschüsse des Eiffelturms oder des Brüssler Atomiums problemlos zu bestens wiedererkennbaren ›Durchschnittsbildern‹ überlagern kann – nur vordergründig geht es dabei um jene Stereotypenbildung, die sich hämisch an ihnen diagnostizieren lässt. Mindestens ebenso wichtig erscheint mir, dass hier wie dort der Durchschnitt der Bilder vieler namenloser Urheber eine gleichsam höhere Autorität verheißt, so als würde aus einhundert Cola-Dosen ihr Inbegriff oder als läutere sich das nur genügend oft abgelichtete schnöde touristische wieder zum buchstäblichen Wahrzeichen.
Im Durchschnittchen rührt die Kunst an das Problem von Darstellung. Die Fotografie, die einen genau 82,6 Jahre alten Mann auf dem Sterbebett zeigt, kann ja die durchschnittlich 82,6 Jahre währende Lebenserwartung von Männern in einem bestimmten Land zu einer bestimmten Zeit gar nicht ›darstellen‹. Denn weder ist aus diesem Durchschnittswert abzuleiten, dass alle mit Erreichen dieses Alters tot umfallen, weil es die weitaus meisten früher oder später tun werden, noch erscheint es nur entfernt sinnvoll, einer einzigen Person (bzw. im Bild nun einer einzigen Figur) eine derartige Repräsentation aufzubürden. Diese Repräsentation verfälscht, ja entwertet das zu Repräsentierende im Nu durch erzwungene Konkretion. Doch scheint es eben diese Diskordanz zwischen dem darzustellenden Durchschnitt und der Ungeeignetheit sämtlicher Verkörperungen in einem wie auch immer gearteten Sujet zu sein, deren unfreiwillig irreales Moment abschöpfbar wird.
Niemand hat dies besser verstanden als die Werbeagentur Jung von Matt, die »Deutschlands häufigstes Wohnzimmer« nachbaut, das »den deutschen Durchschnitt so für seine Besucher erfahrbar [macht]«. Angeblich, um ein Nachdenken in authentischer Atmosphäre zu ermöglichen über Träume, Ängste und Kompromissbeladenheiten der Menschen. Und obwohl sich der offizielle Web-Auftritt größte Mühe gibt, das Ganze als Forschungsprojekt zu deklarieren und eine erfahrungsoffene Haltung ehrlicher Neugierde zu kommunizieren, adressiert das Projekt doch ebenso sehr sozialtouristische Gelüste und gibt wohl auch einem campy gestimmten Interesse an geballter Hässlichkeit der unteren Mittelschicht statt. Dies allein wäre noch nicht sonderlich bemerkenswert, es würde sich Strategien der → Idyllbrechung fügen, und es passt zur Popularisierung von Subversionsstrategien durch die gehobene Werbewirtschaft; ebenso könnte man sich ja das entsprechende Wohnzimmer als Kulisse für eine Fernsehshow oder womöglich als eine für ungeheuer originell erachtete Dauerinstallation im Hamburger Bahnhof Berlin vorstellen. Entscheidender ist, was sonst noch geschieht, wenn unser Blick über die Melange aus Schrankwand, gläsernem Beistelltisch und dergleichen gleitet und uns eine leise Ehrfurcht beschleicht – ob eines Umstandes, den wir immer wieder vergessen wollen: dass aus alldem der errechnete Durchschnitt spricht: keine Stelle des Laminats, die dich nicht sieht!
Es liegt auf der Hand, dass an solchen Effekten auch eine Kunst Genesung sucht, die den Pauperismus, die Kontingenz, das kleinbürgerlich Schäbige mittels Durchschnittchen auf angenehme Weise verwandeln kann in Schlechthinnigkeit. Denn der errechnete Durchschnitt lastet ja nie auf den Dingen und Details, die ihn in falscher Konkretion verkörpern sollen, er levitiert sie in sich selbst.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.