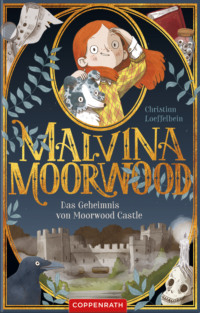Kitabı oku: «Malvina Moorwood (Bd. 1)», sayfa 2
Kapitel 2
Ich lasse eine Bombe platzen

Zum Abendessen gab es eine kalte Version von Tante Fridas Schweinebraten und diesmal waren alle Familienmitglieder in der Küche versammelt. Allerdings nicht um den Tisch herum, sondern im Raum verstreut. Das war nicht unüblich bei uns, wenn eine Art Buffet serviert wurde.
Papa hatte ein Stück Schweinebraten in der einen Hand und unsere alte, klapprige elektrische Heckenschere in der anderen. Er versuchte, das Teil auf ein Stück Zeitung zu legen (also die alte, klapprige elektrische Heckenschere, nicht den Schweinebraten), wobei ihm Poldi fortwährend in die Quere kam.
Onkel Bob scherzte am Herd mit Tante Frida, wobei er abwechselnd ein riesiges Stück Käse und ein Glas Rotwein zum Mund führte und laut lachte. Offenbar hatte das mit den Hufeisen und unserem Hengst geklappt, denn sonst wäre Onkel Bob nicht so gut drauf gewesen.
Tante Frida rührte konzentriert in einem Topf, in dem sich ihre berühmte rote Grütze aus Erdbeeren, Himbeeren und Johannisbeeren befand. Hin und wieder sagte sie Sachen wie »Aha«, »Na, so was« und »Ist ja nicht zu fassen« (Tante Frida interessierte sich nicht besonders für Pferde).
Mama saß mir gegenüber am Esstisch, knabberte gedankenverloren an einer Mohrrübe und ging irgendwelche Rechnungen durch (Mama interessierte sich nicht besonders fürs Essen).
Amalia und Georgina (meine beiden großen Schwestern, wie immer gleich angezogen und geschminkt und mit dem gleichen nervigen Wir-sind-Zwillinge-und-etwas-Besseres-Blick) tippten auf ihren Handys herum, während sie in der Mitte der Küche und Tristan im Weg standen. Der versuchte nämlich gerade, eine geöffnete Flasche Cola, ein geöffnetes Glas Erdnussbutter, eine Packung Toastbrot, zwei Bananen und einen Teller zum Esstisch zu balancieren, und kam an den beiden nicht vorbei.
Genau der richtige Moment, um die Bombe platzen zu lassen.
Tom hatte mir zwar davon abgeraten, aber man kann nicht immer auf seine Freunde hören. Und der schlimmste Tag meines Lebens sollte auch für meine Familie (und vor allem für meinen hinterhältigen Papa) nicht angenehm enden.
»Ich habe heute so einen Typen in Moorwood getroffen«, sagte ich.
Tante Frida schaute an Onkel Bob vorbei zu mir. Sie hob die Augenbrauen und eventuell bewegte sie den Kopf ganz leicht von links nach rechts, das konnte ich aus dem Augenwinkel nicht so genau sehen. Ansonsten reagierte keiner.

Papa untersuchte das Kabel der Heckenschere, das offenbar defekt war. Onkel Bob wedelte mit Käse und Rotwein herum, Mama knabberte, die Zwillinge kicherten und Tristan versuchte weiter, sich an ihnen vorbeizuschieben.
»Hat gesagt, dass er zu wissen glaubt, wer ich bin, der Typ«, fuhr ich fort.
Tante Frida zog die Augenbrauen noch eine Spur höher. Papa drehte den Kopf in meine Richtung, und Mama hörte mit dem Knabbern auf, nicht aber damit, die Rechnungen durchzuschauen.
»Hat gefragt, ob ich die kleine Lady Moorwood bin«, sagte ich.
Tante Frida hob jetzt zusätzlich zu ihren Brauen auch noch ihren Kochlöffel. Mama hörte auf, in ihren Rechnungen zu blättern.
»Und wer war dieser Gentleman, Liebes?«, fragte Papa.
»Hat gemeint, dass er Mr Bommel heißt«, sagte ich.
Der erste Teil der Bombe war explodiert und die Wirkung nicht schlecht.
Tante Fridas Kochlöffel zitterte in der Luft, Onkel Bob bekleckerte sich mit Rotwein, Papa wurde so bleich wie das Stück Käse, das Onkel Bob inzwischen fallen gelassen hatte, und Mama holte zischend Luft und hüstelte. Die Zwillinge stellten ihr Gekicher ein, weil sie merkten, dass irgendetwas vor sich ging (sie waren zwar hochnäsig, aber nicht blöd). Nur mein Bruder machte ungerührt mit seinem Geeiere weiter und versuchte jetzt, links an Amalia vorbeizukommen.
»Hat erzählt, dass er unser Schloss gekauft hat, der Mr Bommel«, sagte ich.
Kawumms! Volle Ladung!
Tante Fridas Kochlöffel verschwand in der Grütze. Onkel Bob begoss das am Boden liegende Stück Käse mit dem Rotwein. Papa riss die Heckenschere an ihrem Kabel nach oben und ließ sie dann gleich wieder fallen, wobei sie um ein Haar Poldi den Schwanz abrasiert hätte. Poldi fing an, klagend zu bellen, aber das war nichts gegen den Lärm, den Tristan mit dem Erdnussbutterglas, der Colaflasche und dem Teller veranstaltete. Ich hätte nie gedacht, dass es derart laut werden kann, wenn Glas und Porzellan auf dem Küchenfußboden zerschellen. Die Zwillinge kreischten »Igitt!« und »Äh!«, weil sie von einer Erdnussbutter-Cola-Scherben-Mischung getroffen wurden, und Mama legte ihre angeknabberte Möhre auf einen Teller und sagte: »Dieser Vollidiot.«
Tristan wollte protestieren, weil er diese wenig schmeichelhafte Bezeichnung auf sich bezogen hatte, aber dann merkte er, dass es gar nicht um ihn ging, und hielt den Mund.
Überhaupt war es plötzlich ganz still in der Küche. Poldi bellte nicht mehr und die Zwillinge hörten auf zu kreischen. Niemand gab einen Laut von sich, bis auf die rote Grütze, die in ihrem Topf vor sich hin blubberte.
»Stimmt das?«, fragten Amalia und Georgina nach einer Weile wie aus einem Mund.
»Nein«, sagte mein Vater.
»Lügner!«, rief ich und verlor dabei leider die Beherrschung. Ich hatte plötzlich Tränen in den Augen. »Du hast unser Schloss an diesen Mr Bommel verkauft. Unser schönes, altes Schloss.«
»Echt jetzt?«, wollte Tristan wissen und nutzte die Dramatik der Ereignisse dazu, sich nicht weiter um die Schweinerei zu kümmern, die er auf dem Küchenfußboden angerichtet hatte.
Papa machte das, was er immer tat, wenn er nicht weiterwusste. Er streichelte Poldi und sah Hilfe suchend zu Mama.
»Nein«, sagte Mama.
»Ihr lügt«, kreischte ich. »Alle beide! Mr Bommel hat es mir gesagt. Ihr lügt! Ihr lügt!! Ihr lügt!!!«
Natürlich log ich auch, aber das war in diesem Fall erlaubt, hatte ich entschieden. Tatsächlich hatte ich diesen Mr Bommel ja gar nicht getroffen, sondern nur seinen Namen auf der Verkaufsurkunde in den verbotenen Zimmern des Ostflügels gelesen, und auch das nicht besonders deutlich.
»Wir lügen nicht«, sagte Mama und reichte mir ein Taschentuch. Keine Ahnung, wo sie das plötzlich herhatte.
»Der Name des Herrn wird übrigens französisch ausgesprochen und er heißt Beaumel und nicht Bommel. In der Tat interessiert sich Mr Beaumel dafür, Moorwood Castle zu erwerben«, fuhr Mama fort. »Aber wir hatten mit ihm vereinbart, darüber Stillschweigen zu bewahren.«
»Krass«, stellte Tristan fest. »Ihr wollt die Hütte also echt verticken.«
»Für wie viel?«, fragten Amalia und Georgina – erneut im Chor.
»Das spielt doch überhaupt keine Rolle!«, rief ich mit viel zu schriller Stimme. »Unser Schloss ist unverkäuflich. Es gehört uns, nur uns und niemandem sonst, und man darf es nicht verkaufen, weil es seit Jahrhunderten unserer Familie gehört, und Opa würde niemals …«
Ich wusste nicht mehr weiter. Wo steckte Opa überhaupt? Erst jetzt und leider etwas zu spät fiel mir auf, dass er gar nicht in der Küche war, als ich die Bombe hatte platzen lassen. Nicht auf Opa zu warten, war natürlich ziemlich dämlich von mir, denn er wäre bestimmt super sauer auf Papa und auf meiner Seite gewesen.
»Was ist denn hier los?«
Na, wer sagt’s denn – da kam Opa gerade noch rechtzeitig durch die Küchentür, mit einem Schraubenschlüssel in den ölverschmierten Händen. Vermutlich hatte er mal wieder an der Heizung herumgewerkelt, die war nämlich des Öfteren kaputt, obwohl sie dringend gebraucht wurde, auch im Sommer. Von der Hitze draußen kam so gut wie nichts in unsere Räume hinein. Wegen der dicken Mauern und der schmalen Fenster.
»Papa will unser Schloss verkaufen, an einen Typen, der Mr Bommel heißt«, berichtete ich schnell, ehe jemand etwas anderes behaupten konnte. Und natürlich sprach ich den Namen von diesem schmierigen Typen nicht französisch aus.
Jetzt würde es gleich ein Donnerwetter geben, das sich gewaschen hatte. Opa war zwar nicht so der zornige Typ und er war ja auch nicht mehr der Jüngste, aber er war unglaublich stark, stärker noch als Onkel Bob. Und früher war Opa mal Soldat gewesen und hatte in einem echten Krieg mitgemacht, wegen irgendwelcher Inseln bei Argentinien, glaube ich. Keine Ahnung, ob damals auch richtig geschossen wurde, aber in unserer Küche würde es auf jeden Fall gleich noch mal richtig rumsen.
Dachte ich.
Tatsächlich schlenderte Opa nur zum Herd, wich mit einem eleganten Seitwärtsschritt dem Käse auf dem Fußboden aus und verkündete:
»Stachelbeerkompott, das ist mein Lieblingsnachtisch.«
»Es gibt rote Grütze, Georgy«, sagte Tante Frida.
»Noch besser«, bemerkte Opa und saß keine fünf Sekunden später mit einem Teller dampfender Grütze vor seiner Nase neben mir.
»Unser Schloss«, jammerte ich. »Unser Schloss, Papa hat es verkauft!«
Jetzt musste Opa mich gehört haben. In seinem Gesicht bildeten sich Falten.
Vielleicht wurde er sogar so wütend, dass er den Teller mit der Grütze nach Papa schmiss.
Schon wieder falsch gedacht.
Die Falten, das waren Lachfalten.
Opa sah mich mit einem verschmitzten Grinsen an.
»Hat dieser Bommel also tatsächlich zugeschlagen?«, raunte er mir verschwörerisch zu.
»Nein, das hat er noch nicht«, mischte sich nun Mama ein. »Und der Mann heißt Beaumel. Er hat lediglich eine Absichtserklärung unterschrieben und sich damit ein Vorkaufsrecht gesichert.«
»Na, immerhin«, freute sich Opa und löffelte vergnügt rote Grütze.
Ich verstand die Welt nicht mehr.
»Opa, hast du mir nicht richtig zugehört?«, fragte ich und rüttelte an seinem Arm. »Unser Schloss! Papa will es verkaufen.«
»Ja, natürlich«, sagte Opa sanft. »Das wollen wir doch alle, oder?«
»Sind wir dann reich?«, fragte Georgina.
»Ziehen wir nach London?«, wollte Amalia wissen.
»Wird die Bruchbude abgerissen?«, erkundigte sich Tristan und fügte noch hinzu: »Falls sie nicht vorher von allein zusammenkracht.«
Statt einer Antwort sagte Mama: »Wir wollten es euch eigentlich erst nach den Sommerferien sagen. Es ist sehr ärgerlich, dass Mr Beaumel so indiskret war und Malvina einfach angesprochen hat.«
»Ach egal«, nuschelte Opa und gab Tante Frida durch Handzeichen zu verstehen, wie sehr ihm die rote Grütze schmeckte. »Hauptsache, wir sitzen nächstes Jahr um diese Zeit alle in einer schönen, gemütlichen Neubauwohnung.«
Da riss bei mir endgültig der Geduldsfaden.
»Neiiiiiiin!«, kreischte ich und schlug mit beiden Fäusten so doll auf den Tisch, dass Opas Teller in die Luft sprang.
Leider war ich nicht besonders geübt darin, auf Tische zu schlagen, und es tat so weh, dass ich für ein paar Sekunden keine Luft mehr bekam. Als ich wieder atmen konnte, ging es mir noch schlechter als vorher.
Mir blieb nichts weiter übrig, als mich fallen zu lassen, unter dem Tisch hindurchzukrabbeln (wobei ich mir natürlich auch noch den Kopf stieß) und aus der Küche zu rennen. Währenddessen sagte Mama etwas, das ich nicht verstand, Opa meinte, dass ich mich schon wieder einkriegen würde und morgen beste Laune hätte, und Papa erwiderte: »Das glaube ich nicht. Malvina hängt an Moorwood Castle.«
Immerhin gab es in meiner missratenen Familie wenigstens einen, der mich verstand, aber das nutzte mir jetzt auch nichts mehr.
Kapitel 3
Rettung in höchster Not

Ich stampfte die Treppe nach oben und schlug meine Zimmertür mit voller Wucht hinter mir zu. Dabei fiel mir ein, dass es vielleicht nicht verkehrt gewesen wäre, Mamas chinesische Vase im Flur von der Vitrine zu fegen, damit sie in genauso viele Einzelteile zersprang wie Tristans Erdnussbutterglas.
Aber ich war zu erschöpft, um noch mal umzukehren.
Und natürlich sollte man seine Wut auch nicht an chinesischen Vasen auslassen, die meistens nichts dafürkönnen, dass schlimme Sachen passieren.
Eine Weile trommelte ich mit den Händen auf mein Bett, was wenigstens nicht wehtat. Besser fühlte ich mich dadurch allerdings auch nicht.
Eher noch mieser.
Als mein Handy die fröhliche Melodie dudelte, die es immer dudelte, wenn jemand anrief, hatte ich große Lust, das dämliche Teil auf den Boden zu werfen und darauf herumzuspringen. Aber dann sah ich, dass der Anrufer mein Onkel Frank war.
Onkel Frank war mein Lieblingsonkel, gewissermaßen das männliche Gegenstück zu Tante Frida. Mama, Papa, Opa und Onkel Bob mochten ihn allerdings nicht besonders und behaupteten sogar, er hätte lange Finger gemacht und was gestohlen, als er aus dem Schloss ausgezogen war.

Aber ich glaubte das nicht und es war mir auch egal, denn Onkel Frank war super. Vor vier Jahren hatte er einmal das völlig lahme Fest zu meinem sechsten Geburtstag gerettet, indem er als lustig kostümierter Überraschungsgast aufgetreten war, überall Konfetti verstreut und mit Karamellbonbons um sich geworfen hatte. Das Ganze war in einer tollen Kuchenschlacht geendet, und ich verstand bis heute nicht, warum er danach endgültig Hausverbot bekommen hatte.
»Prinzesschen, du hast Kummer«, stellte Onkel Frank fest, kaum dass ich »Hallo« ins Telefon geschnieft hatte.
»Das geht ja gar nicht«, empörte er sich, nachdem ich die Lage geschildert hatte. »Wir müssen sofort etwas unternehmen!«
Dreimal mitten ins Schwarze getroffen – typisch Lieblingsonkel.
»Kannst du nicht herkommen und Papa und Opa umstimmen?«, fragte ich und war von meiner eigenen Idee so begeistert, dass ich mich ruckartig im Bett aufsetzte. »Doch, das kannst du«, ereiferte ich mich, ohne Onkel Frank zu Wort kommen zu lassen. »Natürlich kannst du das. Es ist doch auch dein Schloss, oder etwa nicht? Du bist doch Papas Cousin, da ist es ganz klar, dass du ein Wörtchen mitzureden hast, wenn euer Familienschloss verkauft wird. Mama hat natürlich nichts zu melden, die kommt ja aus so einer normalen Familie, aber du nicht. Du, Opa und Papa, ihr seid die Bestimmer, und du musst jetzt sofort hierherkommen und auf dein Recht pochen und dann …«
»Prinzesschen, jetzt halt mal die Luft an«, sagte Onkel Frank und lachte ein wenig, aber nicht so, dass ich mich auf den Arm genommen fühlte. Wenn Onkel Frank mit mir sprach, hatte ich immer das Gefühl, viel älter zu sein, als ich es in Wirklichkeit war.
»Prinzipiell ist das eine sehr gute Idee von dir, aber es ist leider nicht ganz so, wie du meinst. Moorwood Castle gehört nicht automatisch allen Mitgliedern der Familie Moorwood, sondern immer nur einem von uns. Und im Augenblick ist das dein Opa.«

»Das heißt, Papa hat auch nichts zu melden?«, fragte ich.
»Hm, ja, könnte man so sagen, doch er wird das Schloss einmal erben.«
»Warum kannst du es nicht erben?«, wollte ich wissen, obwohl die Frage ein bisschen sinnlos war, denn Opa würde hundert Jahre alt werden, mindestens.
Onkel Frank lachte wieder. »Ach, Prinzesschen, das würde uns jetzt auch nicht weiterhelfen, denn Opa wird mindestens hundert Jahre alt«, sagte er.
Klarer Fall von Seelenverwandtschaft. Kein Wunder, dass ich Onkel Frank so gern mochte. Wir dachten fast immer das Gleiche.
»Aber es ist auch felsenfest in unseren Familiengesetzen so geregelt«, fuhr Onkel Frank fort. »Das Schloss wird immer vom Vater auf den ältesten Sohn vererbt.«
»Das heißt, wenn Papa unser Schloss nicht verkaufen würde, dann würde es Tristan mal erben«, schlussfolgerte ich.
»Stimmt genau«, bestätigte Onkel Frank.
Eine Weile schwiegen wir beide.
»Jetzt pass mal auf«, sagte Onkel Frank dann. »Das Problem ist nicht dein Papa«, erklärte er, »auch wenn er den Verkauf an diesen Mr Beaumel angeleiert hat. Entscheidend ist, dass Opa das Schloss verkaufen will, und was Opa will, das wird auch gemacht. Selbst wenn deine Geschwister und deine Eltern nicht so begeistert von der Idee wären, könnten sie gegen den Willen von Opa nur wenig unternehmen.«
»Das heißt, wir müssen Opa umstimmen«, kombinierte ich und fühlte mich wieder total traurig. Opa umstimmen, das war so, wie ohne Rakete zum Mond zu fliegen, und das wusste auch Onkel Frank.
Er seufzte.
»Schwierig, schwierig«, schätzte er die Lage ein. Genau wie ich.
»Aber nicht unmöglich«, sagte er dann und klang auf einmal so ähnlich wie Tom, wenn der vor einer seiner verzwickten Knobelaufgaben oder vor einem Latein-Rätsel hockte.
»Pass mal auf«, sagte Onkel Frank wieder. »Wir brauchen jetzt erst mal Zeit. Irgendwie müssen wir verhindern, dass dieser Mr Beaumel in den nächsten Tagen einen Kaufvertrag unterschreibt. Das hat er doch noch nicht getan, oder?«
Ich schüttelte den Kopf. Dann fiel mir ein, dass Onkel Frank das ja nicht sehen konnte, und ich sagte: »Ich glaube nicht. Mama meinte, dass er das Schloss nur kaufen will, und dann hat sie so ein komisches Wort gebraucht, das habe ich nicht genau verstanden.«
»Vorkaufsrecht?«, fragte Onkel Frank.
»Ja, kann sein.«
»Okay.«
Schweigen.
»Onkel Frank?«, fragte ich.
»Denke nach«, murmelte er.
»Kannst du nicht einfach herkommen?«, schlug ich noch mal vor.
»Ich würde so gern«, sagte er, »aber ich mache bei einer Großproduktion mit und wir drehen gerade jeden Tag. So was wie Sommerferien gibt es bei uns leider nicht. Ich spiele eine der Hauptrollen und ich kann da echt nicht fehlen.«
Ich hatte ganz vergessen, dass Onkel Frank ja als Schauspieler arbeitete. Auch einer der Gründe, warum er mein Lieblingsonkel war.
»Klingt spannend«, sagte ich.
»Hm«, machte er, »ist es auch, aber im Augenblick ist viel spannender, was bei euch in Moorwood passiert.«
Da hatte er natürlich recht.
»Du hast dich doch mit diesem Mr Beaumel schon einmal unterhalten?«, fragte Onkel Frank.
Mist. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, an dem meine kleine Lügengeschichte aufflog.
»Hm«, machte ich. Das hatte ich mir gerade bei Onkel Frank abgeguckt. Hm war immer gut. Das konnte alles Mögliche bedeuten.
»Vielleicht kannst du noch mal mit ihm reden«, schlug Onkel Frank vor.
»Wie mit ihm reden?«, fragte ich.
»Herausfinden, was er so plant«, erklärte Onkel Frank. »Natürlich darf er nicht Lunte riechen, dass du genau das verhindern willst.«
»Lunte riechen?«, fragte ich.
Onkel Frank lachte wieder. »Das ist so ein altes Sprichwort. Eine Lunte ist eine Art Schnur, die mit ein wenig Schießpulver gefüllt ist und die zu einem Fass führt, in dem sich richtig viel Schießpulver befindet. Wenn man die Lunte anzündet, dann wandert die Flamme langsam zu dem Fass und dann …«
»Dann macht es rums!«, sagte ich.
»Genau«, sagte Onkel Frank. »Und wenn jemand die Lunte riecht, dann merkt er, dass es gleich rums macht.«
Ich kicherte.
»Meinst du, du kriegst das hin?«
»Klar«, sagte ich. »Das mache ich gleich morgen.«
»Prima. Ruf mich danach sofort an.«
»Alles klar.« Ich nickte heftig.
»Ach, Prinzesschen, und noch was«, sagte Onkel Frank und senkte dabei die Stimme. »Wahrscheinlich ist es besser, wenn du niemandem von unserem Telefonat erzählst.«
»Logo«, sagte ich.
»Dann mach’s gut«, verabschiedete er sich.
»Mach’s besser«, erwiderte ich.
Onkel Frank lachte und legte auf.
Ich holte tief Luft. Zwar hatte ich noch keinen Plan, wie ich an diesen dämlichen Mr Bommel herankommen, geschweige denn, ihn in ein Gespräch verwickeln sollte –, aber ich würde es schaffen, das stand schon mal fest. So wahr ich Malvina Moorwood hieß.
Kapitel 4
Ich starte meine Karriere als Detektivin

Zunächst musste ich erst mal den Ball flach halten, um nicht weiter Aufsehen zu erregen und am Ende noch irgendwelche Strafen wie Zimmerarrest zu kassieren. Deshalb war ich sehr froh, dass ich Mamas chinesische Vase nicht zerdeppert hatte. Überhaupt galt es jetzt, sich von Mamas unbeschreiblicher Coolness eine Scheibe abzuschneiden.
Am nächsten Tag stapfte ich also mit gleichmütigem Gesicht in die Küche und wünschte Tante Frida, die am Herd stand und in einer Pfanne Speck brutzelte, einen guten Morgen. Das Rührei war schon fertig und stand in einer Schüssel auf der Anrichte. Ich schnappte mir einen Toast und eine nicht allzu kleine Portion Rührei und verzog mich damit an den hintersten Winkel des Esstischs, gewissermaßen in die Schmollecke.
Das klappte prima.
Opa kam und legte mir einen seiner starken Arme auf die Schultern.
»Was sein muss, muss sein, das ist nun einmal so, meine Kleine«, sagte er.
»Warum muss es sein?«, fragte ich.
Eine Weile starrte Opa auf mein Rührei, und ich dachte schon, er wollte es mir wegfuttern, aber dann sagte er nur: »Wir haben kein Geld mehr, Malvina, und Moorwood verfällt so langsam. Der Dachstuhl muss renoviert werden, sonst stürzt er ein. Der Keller ist noch baufälliger. Und wir können das nicht bezahlen.«
Wenn Opa mich Malvina nannte, dann meinte er all das, was er um meinen Namen herum äußerte, ernst. Sehr ernst. Eigentlich nannte er mich nur Malvina, wenn er sauer auf mich war. Zum Beispiel, wenn ich am Waffenschrank herumhantiert oder Poldi einen seiner Orden umgehängt hatte.
Widerworte waren jetzt also eher nicht angebracht, trotzdem konnte ich sie mir nicht ganz verkneifen: »Papa und Onkel Bob haben doch die Reitschule. Und Mama ist Zahnärztin und bohrt ganz Moorwood für Geld in den Zähnen herum. Und du kriegst eine Pension oder wie das heißt, das haben wir in der Schule gelernt, alle alten Leute kriegen so was. Und Tristan könnte sich auch mal nützlich machen und arbeiten gehen. Er könnte bei McDonald’s Hamburger braten und ich würde mein ganzes Taschengeld …«
Opa drückte mich kurz an sich. Er drückte ziemlich doll.
Und da fiel mir noch etwas ein, weil ich gerade an den Waffenschrank gedacht hatte. Es gab nämlich noch so einen Schrank, drüben im Schloss. Da lagerten Opas antike Gewehre und Flinten. Und die waren echt was wert, das hatte Opa mir selbst mal gesagt.
»Du könntest dich von deiner antiken Waffensammlung trennen«, schlug ich vor.
Opa lachte einmal kurz, aber so richtig fröhlich klang es nicht.
»Eher erschieße ich mich«, sagte er dann, wurde aber sofort wieder ernst.
»Das reicht alles nicht, meine Süße. Allein das Dach kostet Millionen.«
Opa hatte sehr leise gesprochen, deswegen verstand ich, dass es Melonen kostete. Das war witzig, aber mir war nicht zum Lachen zumute.
Opa auch nicht.
Er stand auf, goss sich eine Tasse Tee ein und ging dann aus der Küche.
Als Nächstes kam Tristan ins Zimmer, gefolgt von Onkel Bob, der sogleich die Kaffeemaschine anschmiss, weil er Tee nicht ausstehen konnte.
Tristan setzte sich neben mich. Genau wie Opa legte er seinen Arm um meine Schulter.
»Das wird schon alles, Schwesterherz«, erklärte er vergnügt. »Wenn wir die Hütte erst mal vertickt haben, dann haben wir richtig Asche.«
»Asche interessiert mich nicht«, brummelte ich. »Ich will hier wohnen bleiben.«
»Ach, komm«, sagte Tristan und warf einen gierigen Blick auf mein Rührei.
Ich umfasste die Gabel etwas fester und machte mich bereit, mein Frühstück zu verteidigen, aber Tristan hatte flinke Finger und plötzlich Ei im Mund.
»Die Bude hier kracht demnächst zusammen«, verkündete er kauend. »Da ist es besser, wir wohnen woanders.«
»Geh lieber Burger braten«, sagte ich, »und lass mich in Ruhe.«
Den ersten Teil des Satzes verstand Tristan nicht, aber er ließ mich trotzdem in Ruhe und verzog sich.
Seinen Platz nahm Papa ein, der während des tiefsinnigen Gesprächs mit meinem Bruder zusammen mit den Zwillingen die Küche betreten hatte. Und wieder hatte ich einen männlichen Arm auf der Schulter liegen.
»Es geht leider nicht anders, Mäuschen«, sagte er.
»Ja, ja«, antwortete ich. »Hat mir Opa auch schon erklärt. Wir haben kein Geld für das Dach.«
Papa seufzte.
Er hatte schlecht geschlafen und sah ziemlich zerknittert aus. Das geschah ihm ganz recht, fand ich, aber er tat mir auch ein bisschen leid. Trotzdem sagte ich mit einem Anflug von Bockigkeit in der Stimme: »Lieber ein Schloss ohne Dach als gar kein Schloss.«
Papa seufzte erneut.
Bildete ich mir das nur ein oder schielte auch er auf mein Rührei? Vorsichtshalber stopfte ich mir eine große Portion davon in den Mund.
»Es ist nicht nur der Dachstuhl«, sagte er. Wie Opa sprach er sehr leise. »In den Keller sickert Moorwasser ein. Das ganze Gebäude müsste auf ein neues Fundament gestellt werden. Das kostet Millionen.«
Da waren sie wieder, die Melonen.
Von Dächern und Kellern und Fundamenten hatte ich natürlich keine Ahnung. Ich wusste nur, dass unser Schloss schon seit Jahrhunderten da stand, wo es stand, und das offenbar ohne irgendwelche kostspieligen Baumaßnahmen. Aber da ich ja keinen Ärger machen wollte, hielt ich einfach die Klappe und schlürfte etwas von dem Kakao, den mir Mama vor die Nase gestellt hatte.
Kurz darauf saß sie neben mir, während Papa versuchte, sich mit Onkel Bobs frisch gebrühtem Kaffee in Stimmung zu bringen.
»Wir müssen jetzt alle vernünftig sein, Liebes«, sagte Mama und nickte mir aufmunternd zu. Offensichtlich war sie der Ansicht, dass ich für heute Morgen genug Arme auf meiner Schulter gehabt hatte, denn sie unterließ es, mir auf die Pelle zu rücken.
»Willst du was von meinem Rührei?«, bot ich an.
Mama schüttelte den Kopf und stand auf.
»Ich muss los«, sagte sie.
Das war mein Stichwort. »Nimmst du mich mit?«
»Was willst du denn so früh am Morgen in Moorwood?«, fragte Mama, allerdings ohne etwas zu sagen. Sie beherrschte die Kunst, mit Blicken zu sprechen.
Da ich das leider nicht konnte und sowieso lieber meinen Mund benutzte, antwortete ich: »Bin mit Tom verabredet.«
»Dann aber fix«, sagte Mama, wiederum ohne die Lippen zu bewegen. Unglaublich, wie sie das machte.
Ich schaufelte mir den Rest Rührei hinein und versuchte, so viel von dem süßen Kakao zu trinken wie möglich. Das war gar nicht so leicht, denn Mamas Platz hatten nun Amalia und Georgina eingenommen, und beide überboten sich darin, mir Fotos von Häusern in London zu zeigen, die sie auf den Bildschirmen ihrer Handys hin und her schoben. Scheinbar gingen die beiden davon aus, dass wir dort demnächst wohnen würden.
Abwarten, dachte ich.
»Schau mal, das hier liegt an den Kensington Gardens«, flötete Amalia.
»Und von hier aus kannst du direkt zum Shoppen in die Market Street«, trällerte Georgina.

»Ich muss los«, sagte ich. Das mit dem Kakao konnte ich vergessen. Ich bekam die Tasse nicht zum Mund, weil unentwegt Zwillingshände mit Telefonen vor meinem Gesicht herumwackelten.
Im Flur zur Eingangshalle stand plötzlich Tante Frida vor mir. Während Mama die Fähigkeit hatte, etwas zu sagen, ohne etwas zu sagen, besaß Tante Frida die Gabe, an einem Ort aufzutauchen, ohne dass man wusste, wie sie dorthin gelangt war. Noch vor wenigen Sekunden hatte sie ja am Herd Frühstücksspeck gebraten.
»Ich muss dir was zeigen«, flüsterte sie mir zu.
Verschwörerisch. Geheimnisvoll. Vielversprechend.
Aber nicht so vielversprechend wie der Plan, den ich mit Onkel Frank ausgeheckt hatte. Deshalb erwiderte ich: »Nachher, wenn ich wieder da bin. Jetzt muss ich erst mal zu Tom.«
»Mach keine Dummheiten«, sagte Tante Frida mit einem unergründlichen Blick aus ihren unergründlichen großen Augen.
Ohne dass ich es verhindern konnte, zuckte ich zusammen. Wusste Tante Frida etwa, was ich vorhatte? Das war völlig unmöglich. Trotzdem schlüpfte ich ein wenig verunsichert in meine Turnschuhe.
Aber schon im Auto fühlte ich mich wieder völlig sicher. Was daran lag, dass ich mich immer so fühlte, wenn ich mit Mama durch die Gegend gondelte. Schon als kleines Kind liebte ich es, von ihr herumkutschiert zu werden, vor allem dann, wenn sie mit dem großen Geländewagen fuhr. Der war zwar alt und klapprig, vermittelte aber trotzdem den Eindruck, völlig unzerstörbar zu sein. Genau wie Mama. Und genau wie unser Schloss. Na ja, jedenfalls hatte ich das bislang gedacht. Schade, dass Mama in Sachen Schloss nicht auf meiner Seite war.
Schweigend bretterten wir durch die sommerliche Landschaft.
Ich versuchte, Mama eine Botschaft zu übermitteln, indem ich sie intensiv anstarrte und dachte: Moorwood Castle darf niemals verkauft werden. Moorwood Castle darf niemals verkauft werden.
»Ich muss später noch was einkaufen«, sagte Mama. »Danach kann ich dich bei Tom abholen. So gegen zwei. In Ordnung?«
Mist. Hatte nicht geklappt.
Mama parkte den Landrover vor dem roten Backsteinhaus, in dem sich ihre Zahnarztpraxis befand. Nicht weit entfernt hatte Toms Mutter ihren Kramladen, und wenn man von dort aus einmal um die Ecke bog, stand man direkt vor dem schmalen Wohnhaus der Baxters.
Wir stiegen aus, Mama winkte mir zum Abschied zu und verschwand. Ich blieb allein in der menschenleeren Straße zurück und fühlte mich nun ganz und gar nicht mehr sicher. Der Nachteil an meinem Plan war nämlich, dass ich ja noch gar keinen hatte. Genau genommen hatte ich noch nicht einmal eine Verabredung mit Tom.
Ich holte mein Handy aus der Hosentasche und wählte seine Nummer.
»Hallo«, sagte Tom. Er klang äußerst verpennt.
»Hallo«, sagte ich. »Wir müssen was unternehmen.«
»Du meinst, weil dein Vater euer Schloss verkauft hat?«, fragte er und gähnte.
»Er hat es noch nicht verkauft«, erklärte ich. »Diese Papiere, die wir gesehen haben, die bedeuten, dass es jemanden gibt, der es kaufen will, und zwar dieser Mr Bommel.«
»Aha«, machte Tom. Ich hörte ihn mit seiner Bettdecke rascheln und wurde neidisch.
»Wir müssen mehr über diesen Kerl herausfinden«, sagte ich. »Vielleicht können wir dann verhindern, dass er das Schloss kauft.«
»Wie sollen wir ihn denn daran hindern?«, fragte Tom.
Raschel. Raschel.
Der machte es sich jetzt so richtig schön gemütlich, während ich hier herumstand und mir vorkam wie bestellt und nicht abgeholt.
»Weiß ich noch nicht«, antwortete ich. »Erst mal stöbern wir diesen Typen auf und finden was über ihn heraus.«