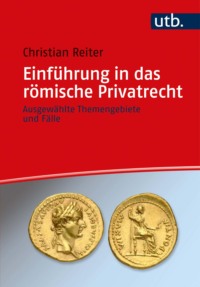Kitabı oku: «Einführung in das römische Privatrecht»

Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage
Brill | Schöningh – Fink · Paderborn
Brill | Vandenhoeck & Ruprecht · Göttingen – Böhlau Verlag · Wien · Köln
Verlag Barbara Budrich · Opladen · Toronto
facultas · Wien
Haupt Verlag · Bern
Verlag Julius Klinkhardt · Bad Heilbrunn
Mohr Siebeck · Tübingen
Narr Francke Attempto Verlag – expert verlag · Tübingen
Ernst Reinhardt Verlag · München
transcript Verlag · Bielefeld
Verlag Eugen Ulmer · Stuttgart
UVK Verlag · München
Waxmann · Münster · New York
wbv Publikation · Bielefeld
Wochenschau Verlag · Frankfurt am Main
Christian Reiter
Einführung in dasrömische Privatrecht
Ausgewählte Themengebiete und Fälle
BÖHLAU VERLAG WIEN KÖLN
Dr. Christian Reiter lehrt als Honorarprofessor an der Universität Osnabrück.
Online-Angebote oder elektronische Ausgaben sind erhältlich unter www.utb-shop.de
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
© 2021, Böhlau, Lindenstraße 14, D-50674 Köln, ein Imprint der Brill-Gruppe (Koninklijke Brill NV, Leiden, Niederlande;
Brill USA Inc., Boston MA, USA; Brill Asia Pte Ltd, Singapore; Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland;
Brill Österreich GmbH, Wien, Österreich)
Koninklijke Brill NV umfasst die Imprints Brill, Brill Nijhoff, Brill Hotei, Brill Schöningh, Brill Fink, Brill mentis, Vandenhoeck & Ruprecht, Böhlau, Verlag Antike und V&R unipress.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: Tiberius, Antike Herrscherprägung, Münzherr. Land: Frankreich (Land). Region: Gallia (Region). Münzstätte/Ausgabeort: Lyon. Nominal: Aureus, Material: Gold, Stempelstellung: 3, Herstellungsart: geprägt. Gewicht: 7,79 g. Durchmesser: 21 mm. Ident.Nr. 18202609. Sammlung: Münzkabinett | Antike | Römische Kaiserzeit (-30 bis 283). © Foto: Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz. Fotograf: Reinhard Saczewski
Korrektorat: Anja Borkam, Jena
Umschlaggestaltung: Atelier Reichert, Stuttgart
Satz: büro mn, Bielefeld
EPUB-Produktion: Lumina Datamatics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
UTB-Band-Nr. 5700
ISBN 978-3-8463-5700-2
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Abkürzungsverzeichnis
1. Grundlagen
1.1 Ein Fall zu Beginn
1.2 Der Zivilprozess im Überblick
1.2.1 Vor dem Prätor: Das Verfahren in iure
1.2.2 Das Verfahren in iudicio oder apud iudicem
1.2.3 Das Urteil
1.2.4 Die Vollstreckung
1.2.5 Weitere Entwicklung des Verfahrensrechts
1.3 Die Klageformel (actio) und das Rechtsdenken der Römer
1.3.1 Vorläufer: Das Legisaktionenverfahren
1.3.2 Das Formularverfahren
1.3.3 Die actio und das aktionenrechtliche Denken: Römisches Juristenrecht
1.3.4 Gesetzesrecht
1.3.5 Das prätorische Edikt
1.3.6 Verfahren und Recht
1.4 Das Werden des römischen Rechts und seine Quellen: Übersicht über die römische Rechtsgeschichte
1.4.1 Vorbemerkung
1.4.2 Archaisches Recht
1.4.3 Die XII Tafeln
1.4.4 Pontifikale Jurisprudenz
1.4.5 „Hellenistische Jurisprudenz“, „Vorklassik“: Mittlere und späte Republik
1.4.6 Klassische Jurisprudenz
1.4.6.1 Kennzeichnung
1.4.6.2 Historische Rahmenbedingungen
1.4.6.3 Die Juristen und ihr Werk
1.4.6.4 Rechtsquellen der Kaiserzeit
1.4.7 Nachklassik
1.4.8 Die Kodifikation Justinians („Corpus Iuris“), insbesondere Digesten und Institutionen
2. Sachenrechtliches
2.1 Eigentum, Freiheit und Bindung
2.2 Die Herausgabeklage: Rei vindicatio
2.3 Übereignung: traditio und mancipatio
2.4 Ersitzung
2.4.1 Eigentumserwerb bei Formfehlern des Übereignungsgeschäftes
2.4.2 Eigentumserwerb bei Nichtberechtigung des Veräußerers
2.4.3 Voraussetzungen und Funktion der Ersitzung
2.5 Quiritisches und prätorisches Eigentum als Ausprägung der Unterscheidung von ius civile und Honorarrecht
2.5.1 Das „bonitarische Eigentum“
2.5.2 Rechtsfortbildung durch die Prätoren: Synthese von Konservativismus und Modernität
2.5.3 Die actio Publiciana als Beispiel aktionenrechtlicher Rechtsfortbildung
2.5.4 Die exceptio
2.5.5 Die Verfolgung des Eigentums gegenüber Dritten
2.6 Geschenkt oder nur geliehen? – Ein berühmter Digestenfall und das Abstraktionsprinzip
2.7 Originärer Eigentumserwerb, insbesondere Verarbeitung
2.8 Besitz und Besitzschutz
3. Schuldrechtliches
3.1 Die Obligation
3.2 Die Schuldverträge
3.2.1 Realverträge
3.2.2 Verbalverträge, insbesondere die stipulatio
3.2.3 Die Konsensualverträge
3.2.4 Der Litteralkontrakt
3.2.5 Nicht als Schuldverträge anerkannte Vereinbarungen
3.3 Strengrechtliche Obligationen und bonae fidei iudicia
3.4 Entwicklung des Vertragsrechts, „Vertragsfreiheit“ und der Innominatvertrag
3.5 Der Kaufvertrag
3.5.1 Allgemeines
3.5.2 Anfängliche Unmöglichkeit
3.5.3 Nachträgliche Leistungsstörungen
3.5.4 Rechtsmängelhaftung
3.5.5 Sachmängelhaftung
3.5.5.1 Ausgangspunkt: Schadensersatz aus der actio empti
3.5.5.2 Das Edikt der Ädilen
3.5.5.3 Ädilizisches Sonderrecht und allgemeines Kaufrecht
3.6 Vertraglicher Schadensersatz
3.7 Deliktischer Schadensersatz: Die lex Aquilia
3.7.1 Allgemeines
3.7.2 Tathandlung und Kausalität
3.7.3 Iniuria
3.7.4 Umfang des Schadensersatzes
3.7.5 Klagekonkurrenzen
3.8 Weitere zum Schadensersatz verpflichtende Tatbestände
3.8.1 Furtum
3.8.2 Iniuria (actio iniuriarum)
3.8.3 Quasidelikte
3.8.4 Prätorische Klagen bei Vermögensschäden
3.9 Ungerechtfertigte Bereicherung
3.10 Dritte in Schuldverhältnissen
3.10.1 Vertragliche Bindung durch Dritte?
3.10.2 Haftung für Hilfspersonen
4. Erbrechtliches
4.1 Grundsätze
4.2 Intestaterbfolge nach ius civile
4.2.1 Das Erbrecht der sui heredes: Römisches Familienrecht und die patria potestas
4.2.2 Agnatische und kognatische Verwandtschaft
4.2.3 Die familienrechtliche Stellung der Ehefrau
4.2.4 Die sui heredes im Ausgangsfall
4.2.5 Das Erbrecht der extranei heredes
4.3 Die Modifikation der zivilen Erbfolge durch das prätorische Recht
4.4 Weitere Entwicklung
Exkurs: Die rechtliche Position der römischen Frau
4.5 Erbfolge durch Testament
4.5.1 Form
4.5.2 Inhalt und Grenzen der Testierfreiheit
4.5.3 Testamentsauslegung: Die cause célèbre Curiana
Exkurs: Quintus Mucius Scaevola pontifex
4.6 Erbschaftserwerb
4.7 Vermächtnis (legatum) und Fideikommiss
4.8 Die hereditatis petitio (Erbschaftsklage)
5. Aktualität der Rechtsgeschichte und des römischen Rechts
5.1 Die „Betriebsrisikolehre“ als Paradigma eines zeitlosen privatrechtlichen Problems
5.1.1 Ohne Arbeit kein Lohn?
5.1.2 Arbeit und Recht in Rom
5.1.3 Die locatio conductio
5.1.4 Die Regelung des Lohnrisikos in den Digesten
5.1.5 Die ratio legis: Soziales Gewissen oder Dogmatik?
5.1.6 Die Praxis: Die dakischen Bergarbeiterverträge
5.1.7 Die weitere Entwicklung und der „Fortschritt“ des modernen Rechts
5.2 Am Ende des Rundganges
Literaturhinweise
Zusätzliche Quellentexte
Register
Vorwort
Das römische Privatrecht ist die historische Grundlage unserer Zivilrechtsordnung. Es gibt daher eine Fülle von Gründen, sich mit diesem Recht zu beschäftigen, nicht nur für diejenigen, die ohnehin ein allgemeines Interesse an der Antike haben. Es ist gemeinsame Tradition der europäischen sowie der von diesen beeinflussten Rechtsordnungen auf der ganzen Welt und kann daher bei deren Verständnis helfen. Es schult systematisches Rechtsdenken und das Judiz, auch unabhängig von einer bestimmten (positiven) Rechtsordnung. Es stellt eine intellektuelle Herausforderung ersten Grades dar. Die Art und Weise der Darstellung und Lösung von Rechtsproblemen durch die römischen Juristen kann auch heute noch als Vorbild dienen. Und manch anderer Grund lässt sich anführen. Hier soll aber vor allem zunächst einmal davon ausgegangen werden, dass die Leserin oder der Leser das Buch aus schlichtem Interesse an der Materie zur Hand genommen hat. Ziel der folgenden Darstellung ist es, grundlegende Informationen zu geben und dieses Interesse zugleich zu verstärken; die Leserinnen und Leser sollen das römische Recht und seine Geschichte in den wichtigsten Elementen und Grundzügen kennenlernen und mögen sich dabei aufgefordert fühlen, den Nutzen dieser Kenntnis selbst zu erleben und zu reflektieren. Und da römisches Recht Fallrecht par excellence ist, liegt es nahe, dies anhand von Fällen zu tun.
Die Beschäftigung mit dem monumentalen, durchaus einschüchternden, in ca. 1000 Jahren gewachsenen Gedankengebäude des römischen Rechts lässt sich mit einem Besuch der ebenfalls in Rom gelegenen und nicht minder monumentalen Vatikanischen Museen vergleichen. Man kann in kurzer Zeit durch möglichst viele Säle eilen und auf jede Statue, jedes Bild, jedes Kunstwerk einen raschen Blick werfen, auf die Gefahr hin, dass vielleicht nicht alles im Gedächtnis haften bleiben wird. Interessierte können sich auch die Zeit nehmen und in vielen Besuchen alles ansehen, was die Jahrhunderte geschaffen und dort zusammengetragen haben, und, wenn sie die dafür erforderliche Ausdauer und Muße mitbringen, eine profunde Kennerschaft entwickeln. Es gibt aber auch noch einen weiteren Weg. Der Betrachter kann auf dem Wege durchaus tieferer Beschäftigung mit exemplarischen Ausstellungsstücken einen fundierten Eindruck von der gesamten Sammlung gewinnen, ohne jeden Saal und jede Vitrine gesehen zu haben. Er wird auf Stücke treffen, die allein der Vergangenheit angehören, und auf solche, deren Bedeutung bis heute ungebrochen ist. Als hilfreich kann sich dabei eine Führung erweisen oder eben, mit dem Titel dieses Buches, eine Einführung. Der Betrachter kann dadurch das notwendige geistige Handwerkszeug erlangen, um nun auch selbstständig andere Stücke der Sammlung einer intensiven Schau zu unterziehen. Zu dieser Art der Beschäftigung mit dem Monument „Römisches Recht“ möchte das vorliegende Buch einladen.
Dieses Buch enthält also keine, auch keine gekürzte, Darstellung oder Zusammenfassung des römischen Privatrechts und seiner Geschichte. Es ist bewusst unvollständig. Vielmehr soll der Versuch unternommen werden, exemplarisch wesentliche Grundprinzipien und Institute des (klassischen) römischen Rechts darzustellen, die unerlässlich sind, um es als Ganzes zu verstehen. Das Bild des Gedankengebäudes bietet sich hier wieder an. Gut erhaltene römische Bauwerke verfehlen bis heute ihre Wirkung nicht: das Kolosseum, der Titusbogen, das Pantheon, um nur einige und sehr bekannte zu nennen, die zur gleichen Zeit wie das klassische römische Recht errichtet wurden, die beiden Erstgenannten sogar in unmittelbarer Nähe zum Forum Romanum, der Geburtsstätte dieses Rechts. Ihre Großartigkeit beruht auf wenigen grundlegenden Elementen (wie Bogen, Gewölbe, Säulen, Pfeiler, Proportionen etc.), die der Variation fähig sind, aber nie ihren eigentümlichen und spezifisch römischen Charakter verlieren und dadurch das Gesamtbild bestimmen. Das römische Recht lässt sich durchaus mit der römischen Architektur vergleichen, und die Kenntnis der Grundelemente hilft dem Betrachter, die Struktur des Gesamtbaus zu erfassen.
Der hier verfolgte Ansatz verlangt eine Auswahl. Der Möglichkeit zur Erweiterung und zur Vertiefung der behandelten Themen dienen die zahlreichen Hinweise auf die römischen Quellen, von denen alle mit einem „Q“ bezeichneten wie die unmittelbar im Buchtext wiedergegebenen zweisprachig im Anhang zu finden sind. Die Auswahl der Themen ließ sich auch davon leiten, was heute zivilrechtlicher Prüfungsstoff im Staatsexamen und daher für die Studierenden von besonderer Bedeutung ist. Daher werden, in der Regel kurz gehaltene, Hinweise zum geltenden deutschen Recht und aus rechtsvergleichender Perspektive zu anderen Rechten gegeben. Elementare Grundkenntnisse im BGB werden dabei vorausgesetzt. Die Studierenden, die sich mit dem Gedanken tragen, das römische Recht als Schwerpunktbereich zu wählen, sollen einen Einblick erhalten, „worauf sie sich da einlassen“; und allen generell am römischen Recht Interessierten soll die Möglichkeit geboten werden, sich in überschaubarer Zeit die Grundlagen anzueignen.
Die Römer wurden schon in der Antike das „Volk des Rechts“ genannt. Eine so tiefgehende Prägung einer Gesellschaft durch das Kulturphänomen Recht hinterlässt seine Spuren auch in einem anderen Kulturphänomen: der Literatur. Die bedeutendsten lateinischen Schriftsteller lebten, als das römische Recht zu blühen begann und seine Hochblüte erreichte; viele von ihnen verfügten selbst über, zuweilen umfangreiche, Rechtskenntnisse und waren aktiv am Rechtsleben beteiligt. Bei ihnen finden sich zahlreiche Bezüge zum Recht, nicht nur in Gerichtsrede, Geschichtsschreibung und staatsphilosophischem Werk, sondern auch im Epos, in Satire und Tierfabel, in unzähligen Privatbriefen und sogar in der Liebesdichtung. Es bietet sich daher an, bei der Führung durch das römische Recht gelegentlich auch den Weg der literarischen Annäherung oder Exemplifizierung zu beschreiten. Vielleicht werden die Leserinnen und Leser dadurch sogar ein wenig Lesevergnügen empfinden, jene suavitas et delectatio in cognoscendo, welche Cicero mit dem Studium des Rechts verbindet1.
Herzlich danken möchte ich denen, die mir durch ihre Bereitschaft zur kritischen Lektüre des Manuskriptes und viele hilfreiche Hinweise dazu zur Seite standen:
Prof. Dr. Ulrich Manthe, der in seinen Vorlesungen und Seminaren an der Universität Passau die Begeisterung für das römische Recht bei mir entfachte;
Prof. Dr. Christian Baldus, Universität Heidelberg, dem ich eine Fülle bereichernder Gespräche verdanke, und Herrn Ass. iur. Robin Repnow, Akademischer Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Römisches Recht der Universität Heidelberg, der mir viele wertvolle Impulse gab;
meinen Fakultätskollegen an der Universität Osnabrück, Prof. Dr. Hans Schulte-Nölke und Prof. Dr. Marcus Bieder, die mich stets in vielfältiger Weise bei meinem Vorhaben unterstützt haben; und Frau Patricia Kainka und Frau Chiara Resing, studentische Mitarbeiterinnen am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Europäisches Privat- und Wirtschaftsrecht, Rechtsvergleichung und Europäische Rechtsgeschichte der Universität Osnabrück, für ihre intensive Probelektüre, Textkorrektur und Mithilfe bei der Erstellung des Registers;
und schließlich Frau Emilia Lutz, Universität Freiburg, für aufschlussreiche Gespräche und stets verlässliche Recherche auf dem Gebiet der lateinischen Philologie.
Dem C. F. Müller Verlag habe ich zu danken für die freundliche Genehmigung zur Nutzung der deutschen Übersetzungen der aus dem Corpus Iuris zitierten Texte. Sie sind entnommen aus: Behrends/Knütel/Kupisch/Seiler (Hg.), Corpus Iuris Civilis. Text und Übersetzung. Bd. I, Institutionen (1990); dies., Bd. II, Digesten 1–10 (1995); dies., Bd. III, Digesten 11–20 (1999); Knütel/Kupisch/Seiler/Behrends (Hg.), Bd. IV, Digesten 21–27 (2005); Knütel/Kupisch/Rüfner/Seiler (Hg.), Bd. V, Digesten 28–34 (2012).
Die Übersetzungen sind gemeinsam verantwortet von den Herausgebern und den jeweiligen Erstübersetzern, die zu Beginn der einzelnen Bände angeführt sind.
Der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft schulde ich Dank für die freundliche Genehmigung zur Verwendung der Institutionen des Gaius, herausgegeben, übersetzt und kommentiert von Ulrich Manthe (2. Aufl. 2010).
Schließlich möchte ich dem Böhlau Verlag, namentlich Frau Dorothee Rheker-Wunsch und Frau Julia Roßberg, für die angenehme Zusammenarbeit danken.
| Osnabrück, im Juni 2021 | Christian Reiter |
1Cicero, de or. 1, 193: „Annehmlichkeit und Genuss beim Lernen“.
Abkürzungsverzeichnis
(Abgekürzt zitiertes Schrifttum zum römischen Recht ist im Literaturverzeichnis aufgeführt)
| a. A. | anderer Ansicht |
| a. E. | am Ende |
| a. a. O. | am angegebenen Ort |
| ABGB | Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch |
| AcP | Archiv für die civilistische Praxis |
| Afr. | Sextus Caecilius Africanus |
| Alf. | Alfenus Varus |
| ALR | Preußisches Allgemeines Landrecht |
| ann. | annales (Tacitus) |
| Art. | Artikel |
| Att. | Briefe an Atticus (Cicero) |
| Aufl. | Auflage |
| BAG | Bundesarbeitsgericht |
| BAGE | Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts |
| Bd. | Band |
| BeckOGK | beck-online Großkommentar |
| benef. | de beneficiis (Seneca) |
| BGB | Bürgerliches Gesetzbuch |
| BGH | Bundesgerichtshof |
| BGHZ | Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen |
| C. | Codex |
| Call. | Callistratus |
| Cass. | Gaius Cassius Longinus |
| cc | Code civil |
| Cels. | Publius Iuventius Celsus |
| cod. civ. | Codice civile |
| Const. | Konstitution (Justinians) |
| D. | Digesten |
| de or. | de oratore (Cicero) |
| epist. | epistulae (Briefe: Plinius, Horaz, Seneca) |
| fam. | Briefe ad familiares (Cicero) |
| fin. | de finibus (Cicero) |
| Flor. | Florentinus |
| Fn. | Fußnote |
| FS | Festschrift |
| Gai. | Gai institutiones |
| GS | Gedächtnisschrift |
| HGB | Handelsgesetzbuch |
| h. M. | herrschende Meinung |
| Hg. | Herausgeber |
| HS | Sesterzen |
| Iav. | Lucius Iavolenus Priscus |
| Inst. | Institutionen Justinians |
| Iul. | Salvius Iulianus |
| Jhd. | Jahrhundert |
| JuS | Juristische Schulung |
| JZ | Juristenzeitung |
| Lab. | Marcus Antistius Labeo |
| lat. | lateinisch |
| leg. | de legibus (Cicero) |
| Lic. | Licinius Rufinus |
| Marcell. | Ulpius Marcellus |
| Marci. | Aelius Marcianus |
| Mod. | Herennius Modestinus |
| Mot. | Motive zu dem Entwurfe eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich |
| Mt. | Matthäusevangelium |
| MünchKomm | Münchener Kommentar zum BGB |
| Mur. | Rede für L. Murena (Cicero) |
| noct. Att. | noctes Atticae (Gellius) |
| m. w. N. | mit weiteren Nachweisen |
| Ner. | Lucius Neratius Priscus |
| NJW | Neue Juristische Wochenschrift |
| NZA | Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht |
| nov. | Novellen |
| od. | Oden (Horaz) |
| off. | de officiis (Cicero) |
| OIR | Orbis Iuris Romani |
| OR | (schweizerisches) Obligationenrecht |
| or. | orator (Cicero) |
| Pap. | Aemilius Papinianus |
| Paul. | Iulius Paulus |
| Planc. | Rede für Cn. Plancius (Cicero) |
| Pomp. | Sextus Pomponius |
| pr. | principium |
| Proc. | Proculus |
| rep. | de re publica (Cicero) |
| RdA | Recht der Arbeit |
| RG | Reichsgericht |
| RGZ | Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen |
| Rn. | Randnummer |
| Sab. | Massurius Sabinus |
| sat. | Satiren (Horaz, Juvenal) |
| SC | senatus consultum |
| Scaev. | Cervidius Scaevola |
| S. Rosc. | Rede für Sex. Roscius Amerinus (Cicero) |
| SZ | Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, romanistische Abteilung |
| top. | topica (Cicero) |
| TR | Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis = Revue d’histoire du droit = The Legal History Review |
| Ulp. | Domitius Ulpianus |
| Ven. | Venuleius Saturninus |
| XII | Zwölftafelgesetz |
| ZPO | Zivilprozessordnung |