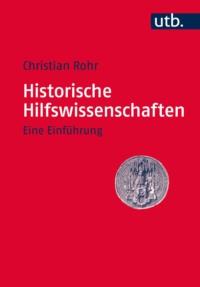Kitabı oku: «Historische Hilfswissenschaften», sayfa 4
Literatur
Brocks, Christine: Bildquellen der Neuzeit. Historische Quellen interpretieren (UTB 3716 M), Paderborn 2012.
Burke, Peter: Augenzeugenschaft. Bilder als historische Quellen, Berlin 2003.
Gräf, Holger Th.: Historische Bildkunde. Eine Hilfswissenschaft zwischen Kunstgeschichte und Bildwissenschaft?, in: Archiv für Diplomatik 54 (2008), 379–398.
Jäger, Jens: Photographie. Bilder der Neuzeit. Einführung in die Historische Bildforschung (Historische Einführungen 7), Tübingen 2000.
Jäger, Jens; Knauer, Martin (Hg.): Bilder als historische Quellen, Paderborn 2009.
Langemeyer, Gerhard u. a. (Hg.): Bild als Waffe. Mittel und Motive der Karikatur in fünf Jahrhunderten. Katalog der Ausstellung im Wilhelm-Busch-Museum Hannover vom 7. Oktober 1984 bis 2. Januar 1985, München 1984.
Pandel, Hans-Jürgen: Bildinterpretation. Die Bildquelle im Geschichtsunterricht. Bildinterpretation I (Methoden Historischen Lernens), Schwalbach 2008.
Panofsky, Erwin: Ikonographie und Ikonologie. Eine Einführung in die Kunst der Renaissance, in: Panofsky, Erwin (Hg.), Sinn und Deutung in der bildenden Kunst, 2. Aufl., Köln 1996 (Erstveröffentlichung 1939), 36–67.
Roeck, Bernd: Das historische Auge. Kunstwerke als Zeugen ihrer Zeit. Von der Renaissance zur Revolution, Göttingen 2004.
Sauer, Michael: Bilder im Geschichtsunterricht, Seelze-Velber 2000.
Talkenberger, Heike: Von der Illustration zur Interpretation. Das Bild als historische Quelle. Methodische Überlegungen zur Historischen Bildkunde, in: Zeitschrift für historische Forschung 21 (1994), 289–313.
Wohlfeil, Rainer: Methodische Reflexionen zur Historischen Bildkunde, in: Tolkemitt, Brigitte; Wohlfeil, Rainer (Hg.): Historische Bildkunde. Probleme – Wege – Beispiele (Zeitschrift für historische Forschung, Beiheft 12), Berlin 1991, 17–35. [<<34]
3.6 Dingliche Quellen
Ein Überblick über die große Bandbreite von gegenständlichen Quellen, die als mögliche historische Quellen infrage kommen, kann und soll hier nicht geboten werden. Grundsätzlich kann je nach Fragestellung praktisch alles Dingliche, jede Realie, zur Quelle werden. Grundsätzlich lassen sich aber folgende Großgruppen unterscheiden:
Bauwerke und Reste davon geben Auskunft über frühere Wohnverhältnisse, über Formen der Repräsentation, etwa in Form von prunkvollen Schlössern, oder aber auch über die jeweiligen Geisteshaltungen der Zeit. Romanische Kirchen aus dem Hochmittelalter sind häufig in der Form von trutzigen Gottesburgen erbaut, während die grazilen gotischen Kichen aus dem Spätmittelalter mit ihren in der Regel meist sehr hohen Kirchtürmen den Blick in Richtung Himmel lenken, im Inneren aber mit ihren Lichtdurchstrahlten bunten Glasfenstern einen Vorgeschmack auf das himmlische Jerusalem geben sollen. Die katholischen Barockkirchen des 17. und 18. Jahrhunderts wiederum betonen mit ihrer Verspieltheit und dem umfassenden Kirchenschmuck ein Lebensgefühl, das von dem Bestreben geprägt war, in einem nicht nur religiösen Sinne das Jetzt zu feiern, gerade in Anbetracht von Kriegen und Seuchen. Die Kirchen der reformierten Kirchen hingegen weisen eine betonte Schlichtheit auf: Kirchenschmuck fehlt fast völlig, mit Ausnahme der Orgel. Die historische Bauforschung wird in erster Linie von kunst- und architekturgeschichtlichen Fragestellungen geprägt, die sich vermehrt auch naturwissenschaftlicher Methoden bedient, etwa bei der Verwendung der Radiokarbonmethode zur Datierung des verwendeten Bauholzes.
Menschliche und tierische Überreste bilden eine zweite Gruppe der „dinglichen“ Quellen. Besonders die Archäologie und die Anthropologie beschäftigen sich mit den Knochenfunden, doch sind die Ergebnisse auch aus historischer Sicht interessant: Sie geben Auskunft über die Besiedlungsgeschichte einer Region, besonders wenn schriftliche Quellen dazu weitgehend fehlen (etwa für das Frühmittelalter), sie lassen aber auch Rückschlüsse auf die Körpergröße der Menschen zu, ebenso auf deren Krankheiten und Verletzungen. Massengräber von Pesttoten lassen auf die Dimensionen der Seuche schließen, solche von Kriegstoten auf Gräueltaten, die mitunter in den schriftlichen Quellen verschwiegen oder verschleiert wurden. Tierknochen von (Haus-)Tieren deuten auf die entsprechenden Ernährungsgewohnheiten hin, zeigen aber auch, dass besonders die Großhaustiere wie Rinder, Pferde oder Schweine bis in die Frühe Neuzeit in der Regel deutlich kleiner waren als heute.
Dinge des täglichen Gebrauchs können noch in situ (an Ort und Stelle) oder an anderen Orten (z. B. Museen) in vollständig erhaltener oder fragmentarischer Form vorliegen. Dazu gehören etwa Mobiliar, Schmuck, Geschirr, liturgisches Gerät, Textilien, [<<35] Werkzeuge, technische Geräte etc. Da all diese Gegenstände bestimmten Stilen und Moden unterliegen, können sie in der Regel auch zeitlich näher eingegrenzt werden. Häufig stehen nicht allein der tägliche Gebrauch und der praktische Nutzen im Vordergrund, sondern es geht auch um die Konstitution der sozialen Klasse oder den Ausdruck eines bestimmten Lebensgefühls.
Auch die natürliche Umwelt kann im weitesten Sinne als „dingliche“ Quelle aufgefasst werden: Reste von Altstraßen oder einstigen Kanalprojekten wie der Fossa Carolina, einem Projekt Karls des Großen, das Flusssystem der Donau mit dem des Rheins zu verbinden, finden sich ebenso im Landschaftsprofil wie solche früherer Naturkatastrophen. Gerade innerhalb der Umweltgeschichte geht es darum, die Landschaft „zu lesen“. Damit ist gemeint, dass sich z. B. frühere landwirtschaftliche Nutzungsformen, etwa die Aufteilung von Feldern, mitunter noch heute ablesen lassen, insbesondere aus der Luft.
Der Bereich der dinglichen Quellen macht in besonderem Maße deutlich, dass der Begriff der „Historischen Hilfswissenschaften“ fließend und fachlich übergreifend ist. Im konkreten Fall bedürfen die zeitliche, räumliche und stilistische Einordnung sowie die Interpretation der Zusammenarbeit vieler Disziplinen, neben der Geschichtswissenschaft auch der Archäologie und ihrer naturwissenschaftlichen Nachbarwissenschaften, der Ethnologie, der Anthropologie, der Kunstgeschichte und anderer Disziplinen. Jede Einzeldisziplin fungiert dabei auch gleichzeitig als „Hilfswissenschaft“ für die Nachbardisziplinen, ohne dass damit irgendeine Wertigkeit ausgedrückt wird. In interdisziplinären Projekten geht es genau um diese Notwendigkeit, einander hilfswissenschaftliches Know-how zur Verfügung zu stellen: Zu einem archäologischen Fund können mitunter schriftliche Quellen eine viel präzisere Datierung ermöglichen, als dies die in der Archäologie gängigen, naturwissenschaftlichen Möglichkeiten imstande wären. Umgekehrt ist durch die Archäologie häufig eine genauere Lokalisierung möglich, als dies in der Regel anhand einer schriftlichen Quelle möglich wird. Kunstgeschichtliche Interpretationen von Alltagsgegenständen wären oft nicht ohne das historische Hintergrundwissen möglich und umgekehrt benötigt der Historiker die Expertise der Kunsthistoriker oder Ethnologen, um Gegenstände in ein zeitliches, künstlerisches und soziales Umfeld einordnen zu können.
Literatur
Fehring, Günther P.: Die Archäologie des Mittelalters. Eine Einführung, 3. Aufl., Darmstadt 2007.
Haupt, Peter: Landschaftsarchäologie. Eine Einführung, Darmstadt 2012.
Jankuhn, Herbert: Einführung in die Siedlungsarchäologie, Berlin/New York 1977. [<<36]
4 Diplomatik (Urkundenlehre)
4.1 Allgemeines und historische Entwicklung
Urkunden (Diplome, Diplomata) sind unter Beachtung bestimmter Formen abgefasste Erklärungen rechtlicher Natur. Die Bezeichnung Diplom, die vor allem für die feierlichen Urkunden von Kaisern und Königen verwendet wird, ist aus dem Griechischen abgeleitet. Das griechische Verbum diploo (δίπλοω) bedeutet „ich verdopple“, das davon abgeleitete Substantiv diploma (δίπλομα), ein Neutrum, bezeichnet ursprünglich ein Schriftstück, das auf zwei mit einem Faden verbundene Teile oder Tafeln geschrieben ist. Davon abgeleitet wird es dann für Geleitbriefe und Empfehlungsschreiben, besonders aber für zusammengelegte Schriftstücke verwendet. Im lateinischen Mittelalter wurde die Bezeichnung Diplom für Urkunden kaum verwendet, erst mit dem Humanistenlatein des 16. Jahrhunderts setzte sie sich durch. Davon abgeleitet nennt man die Wissenschaft, die sich mit den Urkunden befasst, Diplomatik oder Urkundenlehre.
Die Diplomatik ist eine der ältesten Hilfswissenschaften und entstand wie die Paläographie (Schriftenkunde) im 17. Jahrhundert aus dem Streit nach der Echtheit von Rechtsansprüchen. Gerade in den Kabinettskriegen des Absolutismus wurden Rechtsansprüche häufig durch Urkunden „belegt“, wobei diese nicht selten auf plumpen Fälschungen basierten. Die Diplomatik wurde v. a. seit dem 19. Jahrhundert im deutschsprachigen Raum forciert, gleichsam als melancholischer Rückblick auf das Mittelalter nach dem Ende des Heiligen Römischen Reiches. Es kam daher bald nach 1815 zur Gründung von Gesellschaften, die sich vor allem der Aufsuche und Edition historischer Quellen (erzählende Quellen, Urkunden) widmeten. So rief 1819 Heinrich Friedrich Karl Freiherr vom und zum Stein (1757–1831) die wichtigste Institution in diesem Bereich, die Monumenta Germaniae Historica (Geschichtsdenkmäler Deutschlands, MGH), ins Leben.
Die Urkunden der römischen-deutschen Kaiser und Könige des Mittelalters werden von den Monumenta Germaniae Historica, Abteilung Diplomata, ediert. Der Sitz dieser Gesellschaft befindet sich seit dem Kriegsende in München, doch hat die Wiener Diplomata-Abteilung nach wie vor einen wesentlichen Anteil an der Edition (Schwerpunkt Stauferzeit). [<<37]
Außerdem gibt es die von Johann Friedrich Böhmer (1795–1863) begründete Reihe der Regesta Imperii (Regesten des Kaiserreichs, RI), die zum Großteil neu bearbeitet wurden und derzeit bei Friedrich III. und Maximilian I. angelangt sind. Im Gegensatz zur Edition der Kaiserurkunden in der Diplomata-Reihe der MGH beinhalten die Regesta Imperii nicht nur die Siegelurkunden und Briefe der römisch-deutschen Kaiser und Könige, sondern alle für den Herrscher relevanten Geschichtsquellen, also auch Annalen, Chroniken, Viten, Gesetze etc. in Form von kurzen Regesten (Auszügen).
Die Diplomatik, die hier mitsamt ihren Nachbarwissenschaften Sphragistik (Siegelkunde) und Chronologie (Zeitrechnung) vorgestellt werden soll, wird nach der deutschen Tradition in drei Bereiche geteilt: Papsturkunden, Kaiserurkunden und Privaturkunden. Maßgeblich für die Trennung von Kaiserurkunden und Privaturkunden war die Tatsache, dass die Kaiserurkunde im Mittelalter als unscheltbar galt. Wegen der Autorität des Kaisers als Aussteller konnte ihr Inhalt nicht infrage gestellt werden, sofern das Diplom nicht als Fälschung entlarvt wurde. Deshalb bedurfte die Kaiserurkunde im Gegensatz zur Privaturkunde keiner Zeugen als Beweismittel. Wurden trotzdem Zeugen angeführt (vor allem seit der Zeit Kaiser Friedrichs I. Barbarossa), dann vor allem, um die Anwesenden zu ehren und – wie z. B. beim österreichischen Privilegium minus von 1156 – die hochrangige Versammlung von Reichsfürsten, die den Rechtsspruch verfassten, zu demonstrieren.
Theodor von Sickel und die von ihm begründete Wiener Schule der Diplomatik haben wegen der für die gesamte Urkundenlehre beispielhaften Form der Kaiserurkunde die Diplomatik auf der Trennung von Kaiserurkunden und Privaturkunden aufgebaut. Rein formal sind Kaiserurkunden und Fürstenurkunden jedoch seit dem 13. Jahrhundert hinsichtlich des inneren Aufbaus (Formulars) und der äußeren Form kaum voneinander zu unterscheiden, sodass die Trennung in Kaiserurkunden und Privaturkunden nach wie vor umstritten ist. Eine Urkunde des Habsburgers Albrecht I. aus seiner Herzogszeit weicht nur im Titel von einer Königsurkunde Albrechts ab, wenn man von einigen wenigen, besonders feierlichen Königsprivilegien absieht.
Zwischen Kaiser- und Königsurkunden gibt es keinen Unterschied, weder in formaler, noch in rechtlicher Hinsicht. Das gilt auch für das mittelalterliche Deutschland. Der König übt bereits vor der Krönung durch den Papst die volle kaiserliche Gewalt aus.
In Frankreich und England gelten andere Grundsätze als im deutschen Sprachgebiet. Man unterscheidet zwischen Herrscherurkunden, die neben den Königsurkunden auch solche regierender Fürsten umfassen, und Privaturkunden.
Die Abgrenzung zur Aktenkunde ist oft fließend. Allerdings versteht man unter Akten die Produkte des gesamten Verwaltungsprozesses, an dessen Ende schließlich eine Urkunde stehen kann. Diese Akten sind vor allem für die Neuzeit erhalten, im [<<38] Mittelalter jedoch selten. Vorformen dazu sind z. B. die Register, die zunächst in der päpstlichen Kanzlei, ab dem 13./14. Jahrhundert auch in vielen landesfürstlichen Kanzleien über aus- und/oder einlaufende Schriftstücke geführt wurden.
Die Urkundenlehre unterscheidet formal zwischen zwei Hauptformen der Urkunde: Die notitia (Beweisurkunde) wird erst nachträglich als Beweismittel zur Rechtssicherung ausgestellt. Das Rechtsgeschäft ist dann bereits vollzogen, die Beurkundung selbst war dafür nicht notwendig. Die carta (dispositive Urkunde oder Geschäftsurkunde) stellt hingegen einen wesentlichen Teil des Rechtsgeschäfts dar, das durch die feierliche Aushändigung der Urkunde (traditio cartae), die feierliche Aufnahme des Pergamentblattes zur Urkundenausstellung vom Boden (levatio cartae) und der Niederlegung der Urkunde am Altar der beschenkten Kirche (depositio cartae) vollzogen oder zumindest wesentlich mitbestimmt wird. Kennzeichen der carta als einer rechtskonstitutiven Urkunde ist meist die Abfassung in subjektiver Form: Ego N. trado et transfundo ad […] – „Ich, N., übergebe und übertrage an […]“). Die Gattung der carta ist vor allem bei den Privaturkunden und bei jenen Traditionsbüchern, die als systematische Sammelaufzeichnungen der im Kloster vorhandenen cartae angelegt wurden (z. B. die Traditionen von Mondsee in Oberösterreich), vertreten.
Die Urkunden besitzen besonders für das Früh- und Hochmittelalter einen großen Wert als Geschichtsquellen. Sie haben eine ähnliche Bedeutung wie die Inschriften (Inskriptionen) für die Antike, da der Staat des frühen und hohen Mittelalters so gut wie keinen Verwaltungsapparat besaß und daher auch keine Akten produzierte. Aus diesem Grunde sind die Urkunden die wichtigsten, zeitweise auch die einzigen Quellen sowohl zur Rechts- und Verfassungsentwicklung als auch zu den wirtschaftlichen Verhältnissen jener Zeit.
In der Entwicklung des Urkundenwesens gibt es regionale Unterschiede: Die überragende Bedeutung der Urkunden hielt sich nördlich der Alpen länger als in Italien, in Deutschland länger als in Westeuropa. Die römisch-deutschen Kaiser und Könige übten Jahrhunderte hindurch keine Verfassungstätigkeit aus. Erst im Spätmittelalter kam es zur Ausbildung von größeren Kanzleien zur Bewältigung der stark steigenden Produktion von Urkunden und zur Entwicklung einer Behördenorganisation, die sich mithilfe der Urkundenlehre genau verfolgen lässt. Am besten ausgebildet waren im Mittelalter Urkundenwesen, Kanzlei und Behördenorganisation an der päpstlichen Kurie. [<<39]
Literatur
Handbücher und Einführungen
Bresslau, Harry: Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien, 2 Bände, 2. Aufl., Leipzig 1912–1915; Band II/2 (Register) aus dem Nachlass herausgegeben von Hans Walter Klewitz, Berlin/Leipzig 1931, Nachdruck der gesamten Ausgabe Berlin 1969.
Erben, Wilhelm; Schmitz-Kallenberg, Ludwig; Redlich, Oswald: Urkundenlehre (Handbuch der mittleren und neueren Geschichte 4/1–3), München/Berlin 1907–1913, Nachdruck München 1971.
Guyotjeannin, Olivier; Pycke, Jacques; Tock, Benoît-Michel: Diplomatique médiévale (L’atelier du médiéviste 2), Turnhout 1993.
Heuberger, Richard: Allgemeine Urkundenlehre für Deutschland und Italien (Grundriss der Geschichtswissenschaft 1/2a), Leipzig/Berlin 1921.
Santifaller, Leo: Urkundenforschung, 3. Aufl., Köln/Graz 1967.
Vogtherr, Thomas: Urkundenlehre. Basiswissen (Hahnsche Historische Hilfswissenschaften 3), Hannover 2008.
Geschichte der Diplomatik
Bresslau, Harry: Geschichte der Monumenta Germaniae historica (Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde 42), Hannover 1921.
Fuhrmann, Horst: „Sind eben alles Menschen gewesen“. Gelehrtenleben im 19. und 20. Jahrhundert, München 1996.
Rück, Peter: Historische Hilfswissenschaften nach 1945, in: Rück, Peter (Hg.): Mabillons Spur. Zweiundzwanzig Miszellen aus dem Fachgebiet für historische Hilfswissenschaften der Philipps-Universität Marburg zum 80. Geburtstag von Walter Heinemeyer, Marburg an der Lahn 1992, 1–20.
Tropper, Peter G.: Urkundenlehre in Österreich vom frühen 18. Jahrhundert bis zur Errichtung der „Schule für Österreichische Geschichtsforschung“ 1854 (Publikationen aus dem Archiv der Universität Graz 28), Graz 1994.
Tafelwerke
Rück, Peter (Hg.): Fotografische Sammlungen mittelalterlicher Urkunden in Europa. Geschichte, Umfang, Aufbau und Verzeichnungsmethoden der wichtigsten Urkundensammlungen, mit Beiträgen zur EDV-Erfassung von Urkunden und Fotodokumenten (Historische Hilfswissenschaften 1), Sigmaringen 1989.
von Sybel, Heinrich; Sickel, Theodor (Hg.): Kaiserurkunden in Abbildungen, 11 Lieferungen, Berlin 1880–1891.
Seeliger, Gerhard (Hg.): Urkunden und Siegel in Nachbildungen für den akademischen Gebrauch, Heft 2: Brackmann, Albert: Papsturkunden; Heft 3: Redlich, Oswald; Gross, Lothar: Privaturkunden, Leipzig/Berlin 1914. [<<40]
4.2 Formen der Überlieferung
Original ist jene äußere Form der Urkunde, die ihr der Aussteller zu geben beabsichtigt hat. Anhand des Originals kann man sowohl die inneren als auch die äußeren Merkmale einer Urkunde feststellen. Originale werden auch Autographa genannt. Neben dem Original stehen die Kopien (Abschriften): Hier muss man zwischen beglaubigten und unbeglaubigten Abschriften trennen. Bei den beglaubigten Abschriften, die Rechtskraft besitzen, unterscheidet man zwischen dem Vidimus, das den vollständigen Text enthält, und dem Transsumpt, das den Urkundeninhalt von einer oder mehreren Urkunden in eine neue Urkunde (bisweilen in der äußeren Form eines Urkundenfaszikels) aufnimmt. Immer wieder hatte man in den einzelnen Archiven, besonders in denen der Kirchen und Klöster, das Bedürfnis, möglichst den gesamten Urkundenbestand durch Kopien in Sammelhandschriften zu sichern. So entstand der Typus des Kopialbuchs, auch Kopiar oder Chartular genannt; dieses weist entweder eine chronologische, eine sachliche oder eine geographische Ordnung auf.
Unter einem Register versteht man die systematische Sammlung der von einer Kanzlei ausgestellten Urkunden (Auslaufregister). Allerdings war die Registerführung nur an der päpstlichen Kurie wirklich lückenlos, in allen anderen Kanzleien, darunter auch in der Reichskanzlei mit den Reichsregistern, nur unvollständig. Bei der Registerführung ist die Frage wichtig, in welchem Stadium der Beurkundung sie durchgeführt wurde. Ein Register kann nach den Originalen oder nach Konzepten angelegt werden. Seltener als die Auslaufregister wurden Einlaufregister geführt, in denen alle an eine Person oder Gemeinschaft gerichteten Schriftstücke verzeichnet wurden.
Häufig sind Urkunden nur in dieser Form des Entwurfs, der vor der Ausstellung des Originals angefertigt wurde, überliefert. In diesen Konzepten wurden vom Aussteller bzw. vom verantwortlichen Kanzleibeamten Änderungen vorgenommen, die bei der Anfertigung des Originals zu berücksichtigen waren. Normalerweise werden Konzepte nach der Ausfertigung des Originals vernichtet.
Als Vorurkunde bezeichnet man ein Dokument, das bei der Ausfertigung eines neuen Stückes als textliche Grundlage diente. Das war immer dann der Fall, wenn vom Kaiser oder König die Urkunde eines seiner Vorgänger erneuert wurde. In diesem Fall wurde jeweils die Vorurkunde als Insert in die vom Kaiser erneuerte Urkunde aufgenommen (inseriert).
Da die Leistungsfähigkeit der kaiserlichen Kanzlei im Früh- und Hochmittelalter beschränkt war, stellten vor allem geistliche Institutionen mit schriftkundigem Personal wie Bistümer oder Klöster Urkunden nach den Vorgaben des Kaisers bzw. der Kanzlei selbst her, die als sogenannte Empfängerausfertigungen in der Kanzlei nur mehr [<<41] gesiegelt und mit Teilen des Eschatokolls (Signumzeile mit Monogramm) versehen wurden und damit Rechtskraft erhielten. Empfängerausfertigungen sind einerseits an der nicht kanzleigemachten Schrift, andererseits an Abweichungen im Formular, besonders in der Arenga, zu erkennen.
Wenn die Kanzlei großes Vertrauen in den Empfänger setzte, war es möglich, dass sie ihm ein Blankett (Blankoform) übergab, auf dem sich nur die mundierte Unterschrift, das Siegel und eventuell auch Teile des Eschatokolls befanden. Der Text selbst wurde vom Empfänger gemäß Absprache mit dem Aussteller geschrieben.