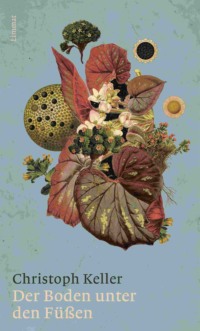Kitabı oku: «Der Boden unter den Füssen», sayfa 2
Natürlich sind die Scheiben von außen bei weitem schmutziger als von innen. Wind wirft, was immer er findet, an das Glas und hinterlässt Muster, die ich, wäre ich ein Künstler, fotografieren und als Lithografie drucken würde. Sporen, Blütenstaub, Fasern, Tannennadeln, Grashalme, Insekten, von der Sonne getrocknet, in Form gepresst, vom Regen wieder aufgeweicht, wieder getrocknet und neu geformt, immer wieder. Ein befreundeter Künstler bezeichnet sie als Naturkunstwerke, von der Natur erschaffene Kunstobjekte. Physik und Natur. Ohne menschliches Zutun, wobei dieser Gedanke letztlich nicht mehr greift, so sehr haben wir in alles eingegriffen. Brücken tauchen vor meinem inneren Auge auf, setzen Pylonen in unwegbaren Grund, wölben sich, strecken ihre Betonfühler von Abgrund zu Abgrund (darunter ein stürmischer Bergfluss), werfen Stahlseile aus, verbinden natürlich Getrenntes. Wie immer, wenn sich dieses Bild bei mir meldet, stürzt eine der Brücken ein. Wie immer schließe ich die Augen und wundere mich, dass ich dieses nun mein Leben definierendes Bild so einfach löschen kann. Dass ich tagelang existieren kann, ohne erneut an die von mir verursachte Katastrophe zu denken. Dass ich gar traumlos schlafen kann, lange und immer besser.
Seit mein Künstlerfreund (der immer wieder Brücken für seine Arbeit einsetzt) mit mir von den Naturkunstwerken gesprochen hat, betrachte ich das, was im Garten geschieht, anders. Dadurch ist für mich der Garten, den ich als selbstverständlich hingenommen habe, voll neuer Bedeutung, voll wachsender Spannung. Überall sehe ich jetzt beides, Natur und Kunst, Muster, Bilder eigentlich, die nur noch reproduziert und in Rahmen gefasst werden müssten: Das wäre dann unser Beitrag. Doch bin ich kein Künstler und habe mich auch nicht verkrochen, um einer zu werden. Ich lasse die auf die Wege gefallenen Blätter, Blüten und Nadeln liegen und schaue sie mir immer wieder an, sobald Regen, Wind und Sonne sie neu angeordnet haben.
Auch die Anordnung auf dem Gartentisch lasse ich in Ruhe. Ein Tannenzapfen hat beim Fall in eine Kaffeetasse (ich trinke meinen Kaffee schwarz) ein Actionpainting-Muster auf das weiße Tischtuch gespritzt. Ich schaue welken Blättern zu, die sich von Ästen lösen, zu Boden schweben und ihren Platz in einer Assemblage von Zapfen, Nadeln, Rossschneckenschleimspuren (und Rossschnecken!), späten Gänseblümchen und weiteren gefallenen Blättern im sich streckenden Gras finden. Ich schaue und schaue und sehe immer mehr. Seit ich den Garten so sehe, fällt es mir leichter, meinen Drang zu beherrschen, überall gleich wieder für Ordnung zu sorgen.
Andri aber geht mir nicht aus dem Kopf. Andri, der vorgibt, seine Eltern im Garten verloren zu haben, also mir die Schuld am Verschwinden von Corinna und Reto gibt. Hätte er «zuletzt im Garten gesehen» gesagt, würde ich seiner Aussage mehr vertrauen. Corinna war tatsächlich das eine oder andere Mal hier. Natürlich war sie es. Allerdings ist es schon lange her. (Wie lange, weiß ich nicht mehr.) Einmal mit Reto zum apéro riche (an einem milden Spätherbsttag), an dem auch Cora teilgenommen (mir gar bei der Vorbereitung geholfen) hat. Ein anderes Mal (das war im Sommer) durchstreiften sie und ich den Garten, sie mit einem Glas Prosecco in der Hand, während ich ihr mit meinem Wein überallhin folgte. Sie trug Jeans und eine weiße Bluse, aus der ich in der Erinnerung wohl die weiße Tennisausstattung gemacht habe, die sie doch im Leben nie tragen würde. Ihr sprungbereiter Labradoodle war dabei, Reto, wie gesagt, war es nicht. Nachtdienst. Betrunken. Beides.
Diesmal war Cora im Haus, arbeitete an einem ihrer Bücher und wollte nicht gestört werden, was Corinna während unseres Spaziergangs mit einem kühlen Wirklich? kommentierte. Corinna hat Cora diese Kleinigkeit nicht verziehen.
Meinen Entschluss, keine Brücken mehr zu bauen, habe ich gleich öffentlich bekanntgegeben. Ich habe es zuerst an den Beerdigungen der Opfer gesagt, an den privaten, in die ich mich eingeschlichen habe, wie auch an der öffentlichen, die in der Kantonshauptstadt Chur abgehalten wurde und an der eine erstaunlich große Zahl der Hinterbliebenen teilnahm. Den Tod offiziell machen hat noch immer etwas Beruhigendes.
Nicht nur dieses Versprechen, das man mir erst nicht glauben wollte, sondern für einen PR-Stunt hielt, habe ich gemacht: Ich habe meine Zunft wie auch das Land aufgefordert, meinem Beispiel zu folgen. Baut eine Weile keine neuen Brücken mehr, habe ich in der Arena des Schweizer Fernsehens in die Talkrunde geworfen. Und wenn es nur ein Jahr ist. Nutzt diese Zeit (und die freigewordenen Gelder), um über die Brücken zu gehen. Ich habe meinen ungewollten Kalauer gleich realisiert. Um über die Bücher zu gehen, korrigierte ich mich. Erst dann hat die verstörte Runde aufgelacht. Dann baut wieder neue Brücken, habe ich nachgesetzt. Oder vielleicht auch nicht. Oder weniger. Oder andere. Man muss ja nicht schon vorher wissen, zu welchem Ergebnis man kommen wird.
Ich gab all dies in derselben Sendung zum Besten, in der man mich und Leo schon des Öfteren gefeiert hat. Nun war ich eingeladen, um beschimpft zu werden, um der berechtigten Empörung eine Zielscheibe abzugeben. Zwölf Leben! Wie nur konnte das geschehen? Brücken stürzen in der Schweiz doch nicht ein! Das Beschimpfen aber lief nicht gut, denn ich fing gleich damit an, mich selber zu beschimpfen.
Trotz gezückter Messer sah sich die Runde in der Defensive. Wie beschimpft man einen, der sich nicht verteidigt, sich vielmehr selber anklagt und beschimpft? Also verteidigte man mich gegen mich. (Die Messer blieben gezückt.) Man sagte, man brauche meine Brücken doch. Ich, der ich das Zeug hätte, in die Fußstapfen des großen Christian Menn zu treten. Man könne unmöglich auf neue Brücken verzichten, nicht einmal ein Jahr lang. Und die eingestürzte müsse sofort wieder aufgebaut werden, alles andere sei undenkbar. So etwas geschehe nun einmal. Allerdings so gut wie nie. Statistisch gesehen sei dieses Unglück vernachlässigbar. Das letzte größere Brückenunglück habe sich in der Schweiz 1891 ereignet. Münchenstein, Eisenbahnbrücke, einundsiebzig Tote. Jemand hatte sich gut vorbereitet. Bei mir dann doch nur elf. Zwölf, warf ich ein und sagte, ich zähle den Hund mit. Fortschritt also. Statistisch gesehen werde ohnehin alles dauernd besser, auch wenn es sich leider nicht so anfühle.
Ich fasste nach. Schrieb ein Meinungsstück für die Neue Zürcher Zeitung, die es aber, dem Schweizer Brückenbau verpflichtet, nicht abdrucken wollte beziehungsweise mir mitteilte, ich sei polemisch, ob ich nicht weniger polemisch sein könne. Also zur Weltwoche. Das Organ der prinzipiell gegenteiligen Meinung veröffentlichte es mit Handkuss in seiner nächsten Ausgabe, ja, machte gleich (und ohne es mit mir abzusprechen) eine Titelgeschichte daraus, eine saloppe Weltgeschichte eingestürzter Brücken.
Darauf war ich doppelt geächtet: als naiver oder, je nachdem, zynischer Opportunist und als einer, der keine Brücken mehr bauen will. O seligmachende Metapher! Brückenbauer will kein «Brückenbauer» mehr sein. Was darfs denn sein, Mauern? Tatsächlich wurde ich das gefragt. Wer keine Brücken will, wenn auch nur für ein Jahr, der muss Mauern wollen. Im Zeitalter der Echokammern darf es nichts dazwischen geben. Die Sache explodierte, Brücken (und Mauern) wurden natürlich weiterhin gebaut, es wurde geschrieben und geredet, stets möglichst pointiert dafür oder radikal dagegen, während das Katastrophenrisiko täglich wuchs, national, global, und immer mehr Menschen starben, wenn auch nicht statistisch gesehen.
Natürlich hatte ich nicht damit gerechnet, dass mein Brückenbaumoratorium umgesetzt würde. So naiv bin ich nicht. Zynisch – ja, dessen habe ich mich schuldig gemacht. Mein Argument, diese relativ kleine Zerstörung als Zeichen zu verstehen, größere zu verhindern, indem wir eine Denkpause einlegten, uns ein Brücken-Time-out verordnen, wurde verlacht.
Das sei naiv.
Das ist zynisch, bellte ich vor laufenden Kameras.
Nach diesen Wortgefechten legte mir Leo, der bereits dabei war, den Auftrag für den Wiederaufbau der Adda Valsömmi zu ergattern (wer wäre dafür geeigneter?), nahe, mich temporär aus der Firma zurückzuziehen. Natürlich meinte er mit «temporär» permanent. Schneller, als eine Brücke einstürzen kann, wurde ich ausbezahlt, mit großzügigen Schecks und tränenreichen Beteuerungen, man würde mich vermissen, aus meinem Büro gewedelt.
Also auch hier eine Lüge. Ich meine meine, nicht die Leos. Mein Zwillingsbruder musste mich, den der Blick zum «Schweizer Antibrückenbauer» gekürt hatte (korrekter wäre «Nichtmehrbrückenbauer»), möglichst weit von nun seinem Büro entfernen.
Die Lüge, die ich meine, ist, meine Auszeit sei meine Idee gewesen, wie ich es überall, privat und in den Medien von mir gegeben habe. Dies mag im Nachhinein den Geschmack von Haarspalterei haben. Doch wie der Brückenbau, so ist auch die Wahrheit Präzisionsarbeit. Schraube für Schraube, Wort für Wort muss fest sitzen. Ein falsches, und alles stürzt ein.
Bevor ich Andris Mutter ausfindig machen kann, will ich im Haus für Ordnung sorgen. Seit ich mein Büro in meiner eigenen Firma geräumt habe, ist mir das ein Bedürfnis geworden. Geht es um die ungelösten Rätsel der Menschheit, bietet die Bürokratie noch immer den verlässlichsten Halt. Die Hausverwaltung also. Meine hat in letzter Zeit so viele Fehler gemacht, dass ihr nichts anderes übriggeblieben ist, als mir den Verwaltungsvertrag aufzukündigen.
Allzu oft musste ich sie mahnen, etwas nachzubessern. Jedes Mal gab es auf der Telefontastatur eine neue Option zu wählen. Jedes Mal dauerte es länger, bis ich jemanden erreichte, dabei handelt es sich bei der Ullmann Immobilien AG um eine «Boutiqueliegenschaftsverwaltung», die nur gerade aus fünf Mitarbeiterinnen (alles Frauen) besteht. Immer häufiger musste ich mich per Tastatur mit Kundennummer und meiner Telefonnummer, die doch auf dem Display erscheint, identifizieren. Dazu gesellte sich bald ein Codewort, jüngst auch noch ein PIN. Gelang es mir schließlich, mit jemandem zu sprechen, musste ich dieser Person meine der Firma hinlänglich bekannte Situation erneut erklären. Wer ich sei, was ich wolle. Welche Liegenschaft nun schon wieder, wie viele Wohnungseinheiten. Roboterstimmen, die trotz des Versuchs, akustisch etwas Diversität einzubringen, alle gleich klangen, die alle einen leicht ungeduldigen Unterton aufwiesen und die durchaus alle dieselbe, auf Roboterstimme gedrillte Person sein könnten.
Was ich zu beanstanden hatte, waren Selbstverständlichkeiten: dass in Mietinseraten die Wohnungsgröße, ebenso die Anzahl Zimmer korrekt angegeben wird. Dass die Wohnung, die ein Cheminée hat, nicht über eine Terrasse verfügt, während die Terrasse in jener Wohnung, die eine hat, unerwähnt bleibt. Dass sich eine Wohnung an einer Bushaltestelle befindet, eine andere – im selben Haus! – einen Kilometer von der nächsten Haltestelle entfernt ist. Beides ist falsch: fünfhundertfünfzig Meter sind es von meiner Liegenschaft bis zur nächsten Bushaltestelle. Die Wohnungsabnahmen liefen nicht reibungsfrei. Man vergaß das Auszugsprotokoll, übersah Mängel, die ich beseitigen musste. Geborstene Scheiben, rostbraunes Wasser in der Toilette. Kosten, die ich absorbieren musste. Und wie kann man ein zurückgelassenes Schlafsofa, eine zerfurchte Skigarnitur (im Wohnzimmer!), ein bildschirmloses Fernsehgerät oder einen toten, möglicherweise nach dem Auszug verendeten Papagei im Kinderzimmer übersehen?
Natürlich wurde im Kündigungsschreiben nicht auf die eigenen Fehler hingewiesen. Vielmehr hieß es dort: «Aufgrund der Reorganisation unserer Firmenstruktur und unseres Kapazitätsvolumens haben wir uns entschlossen, die Mandate, bei denen wir keinen Vollverwaltungsauftrag ausführen dürfen, per Jahresende zu kündigen.» Auch das stimmt nicht, die Firma hatte einen Vollverwaltungsauftrag. Nur ist sie ihm nicht nachgekommen. Immerhin hat mir meine Verwaltung die Mühe abgenommen, ihr das Mandat zu entziehen.
Kein Problem, würde Sarhat sagen. Corinna würde mir einen bunten Strauß lokaler Boutiqueverwaltungen übergeben, Cora mich in einem späteren Werk in einer exemplarischen Fußnote auftauchen lassen. Aus dem Internet ein paar regionale Büros zu fischen, einige Bekannte anzurufen, die vergleichbare Liegenschaften besitzen und sich, wie sich herausstellte, mit ähnlichen Belanglosigkeiten herumärgern, ist aber tatsächlich kein Problem. Unter diesen befand sich auch der einstige Partner meines ehemaligen Ingenieurbüros. Leo nahm den Anruf erwartungsgemäß nicht entgegen, sah er ja meinen Namen auf seinem Gerät aufleuchten. Immerhin kenne ich meinen Fastnamensvetter gut genug, um zu wissen, dass ich für den Rest des Tages durch sein Hirn flackern würde. Wenig später habe ich mit vier Hausverwaltungen Termine auf die kommende Woche vereinbart. Eine wird zu meiner Liegenschaft passen. Erledigt. Zurück zu Andri.
Ich wähle einige weitere Nummern, erreiche aber niemanden, der mir über den Verbleib von Andris Eltern einen Hinweis geben könnte. Tatsächlich gelingt es mir nicht, auch nur eine Person ans Telefon zu locken. Es klingelt und klingelt. Ich stelle mir leere, fensterlose Räume vor, in denen es klingelt. Mein andauerndes Klingeln wird lediglich von den Pfützen, die es hier geben könnte, gedämpft. Möbel gibt es hier keine. Vielleicht sind wir im zwölften Stockwerk, vielleicht unter der Erde. Es ist verlockend, so Zeit verstreichen zu lassen, klingelnd, wartend, stunden-, tagelang, bis die Räume anfangen zu verfallen, bis es tatsächlich Pfützen gibt, bis Frösche von einer zur nächsten springen, ich aber rede mir ein, dafür keine Zeit zu haben, und stecke mein Handy weg.
Meine Nachbarn physisch aufzuschrecken, ergibt keinen Sinn. Wer meinen Anruf nicht entgegennimmt, wird mir auch die Tür nicht aufmachen. Es wäre Aktivismus, brächte weder Andris Eltern nach Hause, noch würde es mein schlechtes Gewissen auf ein erträglicheres Maß reduzieren. Je schuldiger (oder nutzloser) sich einer fühlt, umso rastloser gestaltet er seinen Alltag. Das erklärt die dauerverstopften Straßen. Im Garten genügt ein Blick in den Himmel, wo die Jets ihre fantasielosen Muster hinterlassen. Mit Immobilität ist mehr erreicht. Willst du einen kühlen Kopf bewahren, bleib, wo du bist. Das ist ein Beitrag, den zu leisten ich nun bereit bin. Weiß ich schon nichts mit mir anzufangen, so verringere ich durch mein Bedürfnis nach Ruhe wenigstens meinen ökologischen Fußabdruck. Ich habe genug Schaden angerichtet.
Die Menschen sind ängstlicher geworden. Einbrüche, vor allem tagsüber, häufen sich, die Straßen leeren sich zu jeder Tageszeit, die Mauern werden höher, die Alarmsirenen schriller, die Nachbarn unsichtbarer: Sie sind weg oder verschanzen sich, darauf vertrauend, die allgegenwärtige Überwachungselektronik schütze sie. Wenn ich durch das Küchen- oder eins der Treppenhausfenster doch jemanden sehe, wirken sie gehetzt, gebückter, gedrungener, schleichen im Schutz der Zäune herum. Sie benehmen sich selbst wie Einbrecher, die durch ihre Häuser huschen, die ihre Nachbarn, von denen sie selbst misstrauisch beobachtet werden, als Einbrecher wahrnehmen. Unsere Angst macht uns zu leichter Beute. Geht es uns wirklich zu gut, wie manche meinen? Kann es sein, dass Andri, dieser neunmalkluge Neunjährige, der eine meiner Aussagen mit einem Fick-dich kommentiert hat, diesen Umstand zu seinen Gunsten ausnutzt?
Mit gezücktem Telefon sitze ich auf dem Küchenfenstersims. Nichts regt sich, weder in meiner Hand noch auf meiner Straße.
Seit einiger Zeit haben wir wieder Elstern und Eichhörnchen. Genauer: ein schwarzes Eichhörnchen, wie es hier früher viele gab. Die Elstern, wie auch die Raben, kommen paarweise. Meist höre ich sie erst nur, sie klappern mit ihren Krallen auf dem Blech des Daches, dann erst sehe ich ihren Schnabel, das Weiß der Brust, schon sind sie wieder weg. Auf einmal aber ist da eine zweite, gemeinsam stürzen sie sich ins Gras, auf für mich unsichtbare Würmer.
Das Eichhörnchen scheint allein zu sein. Vielleicht wurde es aus einem anderen Eichhörnchenterritorium verstoßen. Ich weiß nicht, wie es diese Tiere halten, biete diesem aber gern meine Nüsse an. Ich schaue ihm nach, wie es nervös den Rändern des Gartens entlangfegt. Im Schutz des Zauns, der uns vor Ida Walser und ihren scheuen Forderungen abgrenzt, rennt es, schleudert sich aus eigener Kraft vorwärts, den Bäumen entlang über die große Wiese, durchs kleine Wäldchen auf die Südseite. Ich folge ihm zum Nussbaum, dessen Früchte es sammelt und für den Winter vergräbt. Es ist die Jahreszeit dafür.
Cora, verstört wie ich, als wir von der Katastrophe vernahmen (in einem Online-Newsfeed, noch bevor mein Bruder anrief), schlug mir wie Leo ein Time-out vor. Nimm dich aus all dem raus, lass uns eine lange Reise machen. Luigis Angebot, wir könnten seine Villa in der Emilia Romagna jederzeit und für wie lange auch immer benutzen, steht noch. Ich kann mein Buch fertigschreiben, du kannst die Gedanken verjagen. Ich verwarf die Emilia-Romagna-Option vielleicht etwas zu barsch, doch kann ich den polternden Luigi nun einmal nicht ausstehen. Und kaum wüsste er, dass und wann wir in seiner «Villa» (tatsächlich ein abgehalftertes Einfamilienhaus aus den 1970er-Jahren am Rande des Städtchens, dessen Namen ich mir nie merken kann) sind, würde er uns mit seiner Auffassung mittelitalienischer ospitalità belästigen. Luigi wäre zugleich Gastgeber und Gast in seinem Haus. Mit dieser Doppelbenachteiligung könnte ich nicht umgehen.
Dann ziehen wir uns in den Garten zurück, bot Cora als Alternative an. Immerhin ist es ja gerade passenderweise Sommer, da lauert schon der November, den du so liebst und der wie geschaffen ist, um eben auf andere Gedanken zu kommen. Mir wird das auch guttun, und meinem Buch sowieso.
Noch nervt Cora meine Dauerpräsenz nicht, auch wenn ich ihr jedes Mal, wenn ich von einer meiner stets etwas länger währenden Wanderungen zurückkomme, wieder etwas veränderter erscheine.
Ja, sagt sie, du veränderst dich.
Nicht: Du hast dich verändert.
Als könne sie mir dabei zusehen. Tatsächlich begann sie mich zu beobachten. Unverhohlen, ohne es zu verbergen, und scharf, messerscharf, mit immer weniger Wohlwollen schnitten mir ihre Blicke in die Haut. Das ging damals los, ich weiß es, und ich weiß auch, dass mir Cora damals stumm vorwarf, wegen Corinna nirgendwo hingehen zu wollen. Dabei hätte ich mir Corinna gerade in der Emilia-Romagna-Szenerie bestens zusammenträumen können, unfreiwillig unterstützt von Cora, für die Luigis Bleibe eine Villa, der öffentliche, ungepflegte Tennisplatz dahinter dessen privates Refugium war.
War das nicht die Idee? Zumal deine – dass ich mich verändere? Wer Abstand sucht, der verändert sich. Du sagst das, als habe ich mich nicht zum Besseren verändert?
Du bist gelassener und hast auch interessantere Gedanken, sagte sie endlich.
Ich beließ es dabei, als sie bereits wieder verstummte. Mehr wollte ich nicht wissen. Wer sich verändert, verändert auch die anderen, doch für eine entfremdete Cora war ich noch nicht bereit. Noch wusste ich nicht, ob wir uns miteinander veränderten, parallel sozusagen in dieselbe Richtung, oder ob es zur Katastrophe kommen würde, weil sich das Material überdehnte, die Gelenke krachten, die Seile rissen und die Brücke schließlich einstürzte.
Mit Kleinigkeiten fängt es an. So wartet Cora zum Beispiel am Abend nicht mehr auf mich, arbeitet bei geschlossener Tür in ihrem Büro oder schläft bereits. Ich habe gehört, wie sie am Telefon einen Unikollegen angefragt hat, ein neues Kapitel durchzusehen, etwas, was bis anhin ich gemacht habe. (Ob es eine Ausnahme ist? Und welcher Kollege ist es? Das habe ich beim Belauschen nicht herausgekriegt, und fragen kann ich sie natürlich nicht.) Auch ist mir aufgefallen, dass Cora den Troll, dem sie lange kaum Beachtung geschenkt hat, nun häufiger erwähnt. Fängt sie an, ihn mir vorzuziehen? Dieser Frage möchte ich mich auch nicht stellen. Cora ist meine Liebe, mein Leben. Letztlich verdanke ich ihr, wer ich geworden bin. Und noch werde. Lieben heißt, mit Veränderungen Schritt zu halten. Ihr wird das nicht schwerfallen. Ich aber muss lernen, ihr mehr zu vertrauen, auch wenn ich mir nicht mehr sicher bin, ob sie mir vertrauen kann.
Prof. Dr. Cora Y. Curti lehrt philosophisches Recht an unserer Universität und verfasst provokative Essays, die weiterherum in Buchform für Aufsehen und Stirnrunzeln sorgen. Ihr jüngstes Buch, an dem sie mit überhitztem Motor arbeitet, heißt Mit der Natur und plädiert dafür, dass wir, wollen wir als Spezies überleben, von der biblischen Unterjochung der Natur und der Tiere und damit eben auch einer Vielzahl unserer Mitmenschen abkommen und uns auf eine Zusammenarbeit mit der Natur zurückbesinnen müssen, so wie es (dies das Vorbild, auf das sich Cora hauptsächlich bezieht) die Ureinwohner Amerikas einst gelebt haben. Nicht ein Zurück zur Natur, eben ein mit der Natur. Nicht keine Zivilisation, sondern weniger beziehungsweise eine kooperativere, keine, die in absehbarer Zeit alles abtöten, die Erde unbewohnbar machen wird. Ihr provokativstes Bild, mit dem sie bald schon auf das Buch aufmerksam machen will, ist eine Menschengruppe, die in einer Rakete ins All schießt, auf eine schwarze Mauer zu. Im Hintergrund unser Planet in Flammen. Mir ist das zu plakativ. Und es kommt noch schlimmer, denn angeführt wird das verlorene Häufchen von einem Elon-Musk-Typen. Ach herrje, Cora, habe ich gesagt. Lass wenigstens von diesem Klischee ab. Doch ihr Verleger weiß, wie man in unserer Aufschreikultur für einen Aufschrei sorgt. Es war ja seine Idee. Er hofft auf einen Tweetshitstorm und kann dabei auf die Mitwirkung von Musk selber zählen.
Was Cora will, bedeutet natürlich in erster Linie Verzicht, viel Verzicht, und Verzicht, das weiß keine besser als Dr. Cora Y. Curti, ist etwas, was die Menschen am wenigsten können. Sie bringt es auf den Punkt: Verzichten ist unmenschlich. Cora ist nicht naiv, ich bin es. Ich will es sein. Ich will mehr. Ich fordere ein sofortiges, unbegrenztes Zivilisationsmoratorium. Eine Dekade Stillstand, zehn Jahre nichts Neues, ein Jahrzehnt Nullwachstum. Realist mag ich in meinem neuen Leben nicht mehr sein. Ich fühle mich bereits ruhiger.
Ich befolgte Coras Rat, zog mich aus dem Büro zurück und ließ Leo dort im Stich. LLI. Die drei Buchstaben hatten einen guten Klang. Niemand weiß, dass unsere zwillingshaften Vornamen für den Firmennamen stehen. Lion und Leo, Ingenieurbüro. Wenige wissen, dass wir tatsächlich Zwillinge sind. (Corinna weiß es, Cora nicht.) Deshalb bin ich auch zuversichtlich, dass wir eines Tages wieder miteinander reden können. Leo, mein älterer Bruder (um etwa elf Minuten). Leo, dem gegenüber ich im Bedarfsfall gern den unbedarften, ratbedürftigen kleinen Bruder spiele (um elf Minuten und dreiundzwanzig Sekunden bin ich jünger, um genau zu sein). Ich gebe meinem Bruder Zeit. Das hat er verdient. Ich habe seine Mitschuld verdoppelt, indem ich meine eingestanden und die Konsequenz daraus gezogen habe, während er sich geschworen hat, noch bessere Arbeit zu leisten.
Wichtiger ist mir jetzt das Eichhörnchen. Ich beobachte es. Es hat etwas von Andri, ist nervös, macht mich nervös. Es weiß mehr, als es zu erkennen gibt. Ich stehe still in der grell brennenden Sonne und versteife mich. Acht Meter vom Nussbaum entfernt versteinere ich zur Statue. (Der Nussbaum muss getrimmt werden.) Verharre ich lange genug, wird das Eichhörnchen in mir keine Gefahr mehr sehen, und ich kann ihm bei der Nahrungssuche, oder was immer es vorhat, zusehen. Die Zeit dehnt sich, ich dehne mich mit. Mir wird schwindlig, mein Blick trübt sich vor Hitze, mein Tierchen aber sieht mich jetzt als Teil der Landschaft. Zielstrebig wühlt es, präzis und rechthaberisch, wie mir scheint, in der Erde herum, verliert aber seine angeborene Nervosität nicht. Diese hält es am Leben.
Jetzt schießt es hoch, die Vorderglieder von sich gestreckt, den Blick nach oben gerichtet, rast es auf mich zu. Schnellt ohne zu zögern an mir hoch, am linken Bein, über den Bauch und die Brust, prescht über mein Gesicht, kratzt meine Wange und Stirn blutig und bleibt abrupt auf meinem Kopf stehen. Ich rühre mich noch immer nicht. Ich warte und warte. Es klingelt in meinem fensterlosen Schädel, Pfützen bilden sich, ich habe Zeit, warte auf die Frösche. Noch immer stürzen Brücken ein. Wird das Eichhörnchen seine Krallen in meine Kopfhaut graben?, denke ich plötzlich. Diese Möglichkeit schreckt mich auf. Nicht nur mich, das Eichhörnchen springt (ich spüre den sich verstärkenden Druck der Krallen) von meinem Kopf in das ausladende Geäst der riesigen, hundertjährigen Scheinzypresse hinter mir.
Eine Weile noch spüre ich das Wiegen ihrer Äste, dann ist es wieder ruhig. Vorsichtig drehe ich mich um, schaue auf die Zypresse, dann am Baum vorbei zum Haus. Auf der Dachrinne hockt das Elsternpaar und schaut grinsend auf mich herunter.
Die Stille, nach der ich mich sehne, gibt es auch im Garten nicht. Auch nicht, seit die Flugzeuge wieder seltener geworden sind, weil die Flugschneise verlegt worden ist. Dafür ist der Schattenlärm der fernen Autobahn, der, je nach Windlage, den Weg doch hierher findet, wieder dichter geworden. Letzteres mag daran liegen, dass ich die Bäume am Südhang zu stark habe trimmen lassen. Bäume, selber die wunderbarsten Geräusche verursachend, sind der beste Lärmschutz. Aber auch ohne diese mechanischen Geräusche gibt es im Garten keine absolute Stille. Gute Stille braucht etwas Lärm, sie nährt sich von guter Störung. Was ich lernen will, ist, die Stille des Wachstums zu hören. Gerade jetzt raschelt es wieder lauter im Gehölz, ich glaube, Zirpen zu hören, obwohl es dafür nicht die Jahreszeit ist.
Ich erschrecke, wirble herum.
Schon lange bin ich hinter dir her, sagt Sarhat. Du hast nicht gehört.
Ich war in meine Geräusche vertieft.
Vorsichtig sein!, ruft er und grinst breit. Ich hätte dich killen können. Du weißt, ich habe verleumderischen Türkendolch immer dabei. Hör mit Augen, seh mit Ohren, verpasst er mir eine osmanisch klingende Weisheit. Recht aber hat er. Hören ergibt keinen Sinn, wenn man das Gehörte nicht einordnen kann. Wer in der Wildnis nicht richtig hört, ist auch schon tot, Beute eines Wildschweins oder eines Wolfsrudels geworden. Auch wenn ich solchen Gefahren hier noch nicht ausgesetzt bin, will ich vorbereitet sein.
Ich weiß nicht genau, woher Sarhat kommt, Kurdistan, aber wo genau? Irak, Türkei, Syrien, Iran? Wo gibt es noch Kurdengebiete? Ah ja, in Armenien. Er hat mir alle Länder aufgezählt, ich habe sie mir gemerkt, doch eben nicht, welches seines ist. Er ist seit zwanzig Jahren im Land, besitzt unseren Pass, spricht gebrochen unsere Sprache. Er passt sich uns an, aber oft versucht er auch, uns seine Gewohnheiten aufzudrücken. Kurdistan keine Grenzen, sagt Sarhat, wie Geschichte keine Anfang. Wir schon immer da. Dehnen uns aus, sind wieder klein. Aber schon wieder größer. Hin, her. Vor, zurück. Immer so. Klar ist aber, wir sind da. Immer. Ganz sicher. Wer dehnt, bleibt. Ist wie mit deinen Brücken.
Sarhat kommt tiefer aus dem Osten als ich. Er tut dem Garten gut. Er stammt aus einer Kleinstadt, die Samsat heißt. Samsat ist eine junge Stadt, die 1988 gegründet wurde, um die Bewohner von Samosata aufzunehmen, die in den 1960er-Jahren nach dem Bau eines Staudamms geflutet wurde. Wo Sarhat vor 1988 war, wo er seine Jugend verbracht hat, weiß ich wiederum nicht. Wer in Samosata geboren wurde, dem fehlt ein knappes Vierteljahrhundert, bevor er in der neuen Stadt Samsat angesiedelt wurde. Samosata war ursprünglich altgriechisch, Samsat ist türkisch.
Da haben wir es: Sarhat ist türkischer Kurde!
Sarhat, Samsat, Samosata.
Das weiß ich alles. Aber nicht, wo Sarhat hier bei uns wohnt. Er hat drei Kinder und ist verheiratet mit einer Frau, von der ich weiß, dass sie sehr religiös ist. Muslimin. Sarhat ist nicht sehr religiös, bezeichnet sich aber auch als Muslim. Muslim und praktizierender Alleskönner, sagt er, wenn er merkt, dass er einem Hiesigen mit dem Wort Muslim Angst eingejagt hat. Manchmal packt ihn der Schalk, und er will den Hiesigen Angst einjagen. Mit seinem deutschen Lieblingswort: Kopftuch. Dann springt er wie ein Kobold herum und schreit Kopftuch! Kopftuch! Kopftuch!, weil im zivilisierten Westen dieses Wort genügt, um die muslimische Weltverschwörung Wirklichkeit werden zu lassen.
Jemand hat die wilden Weinreben ausgerissen, sage ich. Den ganzen Zaun entlang. Warum nur?
Wo? Sarhat zögert. Weiß er etwas? In der Regel ist Sarhat über den Garten besser informiert als ich. Vielmehr anders. Seines ist ein praktisches Wissen, womit er natürlich weiterkommt als ich mit meinem metaphysischen Wunschwissen.
An Meiers Zaun, bei den großen Bäumen.
Scheinzypresse, Fichte, Birke, wirft er ein, als wisse ich die Namen der Bäume nicht selber. (Tatsächlich habe ich sie erst kürzlich gelernt.) Die Art, wie er sie aufzählt, hat etwas Besitzergreifendes. Sarhat kümmert sich um mindestens drei Gärten. Alle bezeichnet er als «seine». Daneben betreibt er eine Kebabbude irgendwo in Bahnhofsnähe, auch ein Catering, und zusätzlich nimmt er Reparaturaufträge an. Vor allem kümmert er sich um Gartenmaschinen. Was diese anbelangt, ist sein Eigentumsverständnis fließend. Immer wieder entdecke ich im Schuppen Geräte, die nicht hierher gehören, während ich andere vermisse. Meistens tauchen meine wieder auf. Diejenigen, die es nicht tun, werden durch das Bleiben fremder Geräte aufgewogen. Die Summe der Geräte im Schuppen bleibt sich in etwa gleich. Allerdings benutzt Sarhat, Organhändler für noch zu rettende Laubbläser, Rasenmäher, langstielige Rosenscheren, die Geräte seiner insgesamt vier Gärten auch als Ersatzteillager.
Mittlerweile stehen wir vor Meiers Zaun, um den sich bis vor wenigen Tagen noch die Weinreben gerankt haben. Die herbstfarbenenen Blätter sind dem abgeschabten Metallgrün des Maschendrahts gewichen.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.