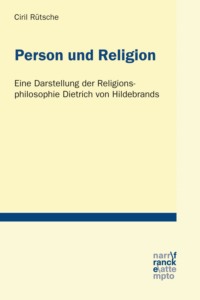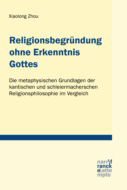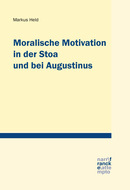Kitabı oku: «Person und Religion», sayfa 11
3.4 Die WerteWerte als Hinweis auf den Inbegriff aller WerteInbegriff aller Werte
Was sodann die zweite Frage betrifft, die eingangs des letzten Kapitels gestellt wurde, nämlich, inwiefern die WerteWerte „ein Fingerzeig, ein Hinweis auf GottGott“1 seien, so ist der BegriffBegriff des Wertes an sich bereits „in unserer Gottesvorstellung enthalten“, denn eine „Gottesidee, die das unendlich vollkommene WesenWesen als absolut neutral auffassen würde, wäre so sinnlossinnlos und fürchterlich wie die Idee eines bösen Gottes“.2 Ein Hinweis auf Gott, in dem alle Werte eins sind,3 sind die Werte auf verschiedene Weise, je nach der Eigenart der jeweiligen Werte. Der Hauptunterschied besteht zwischen den ontischen und den qualitativen Werten. Bei den ontischen Werten spricht von HildebrandHildebrandDietrich von von einem AbbildenAbbilden, während er das Verhältnis zwischen Gott und den Werten im Falle der qualitativen Werte als eine BotschaftBotschaft bezeichnet, „die direkter ist und Tieferes verkündet als die von den ontischen Werten vermittelte“4. Das zeigt sich beispielsweise an der berühmten Neunten Symphonie von BeethovenBeethovenLudwig van. Ihre SchönheitSchönheit kündet von einer Welt über uns, „sie trägt unseren GeistGeist empor und erfüllt unser Herz mit der Sehnsucht nach einer höheren Welt“5.
Seine Aufnahmefähigkeit für das wahrhaft Schöne beweist von HildebrandHildebrandDietrich von auch mit seiner Abgrenzung der sublimen FormenschönheitFormenschönheit, die sich eindeutig über die Welt des Sinnenfälligen erhebt. Damit spricht er „ein Zentralproblem der ganzen Ästhetik“ an, „das Mysterium, das dem Sichtbaren und Hörbaren anvertraut ist, nämlich, nicht nur Träger der Sinnenschönheit, sondern einer sublimen geistigen SchönheitSchönheit sein zu können“.6 „So z.B. im Angesicht einer erhabenen Gebirgskette, gebadet in strahlendes Sonnenlicht: es ist nicht das, was wir unmittelbar sehen, an dem die Schönheit haftet, sondern der Gedanke an Gottes Schöpferkraft.“7 Der eigentliche Träger der Schönheit ist nicht das Sicht- und/oder Hörbare, die eigentliche Schönheit ist ein Geistiges. Zwar haftet die Schönheit unmittelbar am Sicht- und Hörbaren, doch ist sie nicht Ausdruck des Soseins der sicht- und hörbaren Gegenstände. Obwohl die körperlichen Dinge eine ontologische Schönheit besitzen, kann diese Schönheit die Formenschönheit nicht erklären. „Diese höhere Formenschönheit transzendiert in ihrer Qualität bei weitem die Sphäre dieser Gegenstände“8. Sie ist „der AbglanzAbglanz von etwas unvergleichlich Höherem“, die „kündet von GottGott“.9
Desgleichen versteht von HildebrandHildebrandDietrich von auch das Verhältnis zwischen GottGott und den sittlichen Werten nicht als ein blosses AbbildenAbbilden. Die sittlichen WerteWerte „strahlen Gott in unvergleichlicher Weise wider, sie sind wahrhaft sein direktester AbglanzAbglanz, seine unmittelbarste BotschaftBotschaft im natürlichen Bereich“10. Als Abglanz bezeichnet von HildebrandHildebrandDietrich von die Ausstrahlung, den Duft oder die Glorie der Werte.11 Allerdings nicht aller Werte, sondern nur der Werte qua geistiger Gebilde.12 Von den ontologischen Werten geht in diesem Sinne keine Ausstrahlung aus. Das Phänomen selbst bezeichnet von HildebrandHildebrandDietrich von als metaphysische SchönheitSchönheit,13 welche umso grösser ist, je höher der Wert, dessen Abglanz sie ist.
Mit dem Höher ist unweigerlich die Frage nach der Rangordnung der WerteWerte angesprochen, auf die von HildebrandHildebrandDietrich von wiederholt aufmerksam gemacht hat. Er spricht von der „in Gottes WesenWesen fundierten Rangordnung der WerteRangordnung der Werte“14, wonach es zum Wesen der echten Werte gehört, „dass es ein objektives Höher und Niedriger gibt“15. Er spricht auch davon, dass ein volles Verständnis eines gegebenen Wertes unmöglich ist, „ohne ein Erfassen seiner objektiven WerthöheWerthöhe“16. Die HierarchieHierarchie ist allerdings zu differenzieren. Zu unterscheiden ist einmal die Hierarchie, die innerhalb einer einzelnen Wertfamilie – z.B. der sittlichen oder der intellektuellen – besteht, eine Hierarchie, die die Urteile ermöglicht: „DemutDemut steht höher als Zuverlässigkeit, und geistige TiefeTiefe höher als Schärfe des Verstandes.“17 „Eine analoge Hierarchie der Werte besteht innerhalb der ontologischen Werte“18, so steht das personale Sein des Menschen höher als das apersonale Sein der Tiere, dieses wiederum höher als das Sein der Pflanzen, welches selbst wiederum der unbelebten MaterieMaterie übergeordnet ist.19 Nach einer anderen Gliederung thront über allem „GottGott und das Reich des Übernatürlichen“, während innerhalb des Natürlichen die Sphäre des Geistes und der geistigen PersonPerson an erster Stelle steht; untergeordnet erscheint das Reich des Vitalen und schliesslich das der reinen Materie.20
Von der HierarchieHierarchie innerhalb einer einzelnen Wertfamilie ist die Hierarchie der WertfamilienWertfamilien zu unterscheiden. „Diese letzte haben wir im Auge, wenn wir sagen, die sittlichen WerteWerte stehen höher als die intellektuellen. Dann vergleichen wir die einzelnen Bereiche und die Rangstufe ihrer jeweiligen Themen.“21 Was aber ist unter der „Rangstufe ihrer jeweiligen Themen“ zu verstehen? Um sich in der Beantwortung dieser Frage der Beispiele der Familien der sittlichen und der ästhetischen Werte zu bedienen, so ist das Thema der sittlichen Werte die sittliche Gutheit, währenddem dasjenige der ästhetischen Werte die SchönheitSchönheit ist, wobei die sittlichen den ästhetischen Werten deswegen übergeordnet sind, weil das Thema der sittlichen Gutheit demjenigen der Schönheit übergeordnet ist. Doch übergeordnet ist das Thema der sittlichen Werte nicht alleine dem der ästhetischen, sondern den Themen sämtlicher Wertfamilien und -gattungen, denn die sittlichen sind „die höchsten Werte […], in ihnen gipfelt die Herrlichkeit aller Werte“22.
Die Rangordnung der WerteWerte steht in dem SinnSinn in einem Wesenszusammenhang mit der EinfachheitEinfachheit, als ein Seiendes umso einfacher ist, je höher es steht.23 Dabei besagt „einfach“ jedoch alles andere als Sinnarmut oder Primitivität. Mit der Einfachheit – freilich in einem metaphysischen Sinne verstanden – verhält es sich vielmehr so, wie Maurice BlondelBlondelMaurice es einmal charakterisierte, dass nämlich das Sein umso mehr inneren Reichtum hat, je mehr es eins ist.24 Auch für von HildebrandHildebrandDietrich von bedeutet die Zunahme an Einfachheit insofern eine Zunahme, als „mit einem Einzigen ‚viel gesagt‘“25 ist. Beispielsweise ist die SeeleSeele so einfach, „dass bei ihr FormForm und MaterieMaterie nicht mehr unterschieden werden können“26. Auch bei den weiter oben besprochenen Erkenntnisarten – dem empirischen und dem apriorischen bzw. philosophischen ErkennenErkennen – hat sich etwas von dieser Einfachheit gezeigt. „So ist das philosophische Erkennen, das auf das Erfassen des Wesens des Seienden abzielt, – das ‚intima rei intus legere‘ – prinzipiell einfacher als das naturwissenschaftliche Erkennen, das ‚von aussen her‘ um das Seiende herumgeht, beobachtend und schliessend.“27 Während die NaturwissenschaftenNaturwissenschaften der Quantität bedürfen, indem sie von vielen BeobachtungenBeobachtungen auf das betreffende Arturteil schliessen, wobei sie im besten Fall den Gewissheitsgrad der HöchstwahrscheinlichkeitHöchstwahrscheinlichkeit erreichen, bedarf die Philosophie nicht des Vielerleis an Einzelbeobachtungen. Sie kann das SoseinSosein prinzipiell an einem einzigen Beispiel erfassen. Auch geht sie nicht wie die Naturwissenschaften in die Breite, ihre Dimension ist vielmehr die TiefeTiefe. Sie zielt „auf das Erfassen der EinheitEinheit des ganzen Kosmos“ und erreicht ihre Krönung im Vordringen „bis zu dem Urgrund des Seins, dem absolut einfachen, unendlichen Sein, in dem alle Fülle des Seins ‚per eminentiam‘ enthalten ist“.28 „Bei der absoluten Einfachheit Gottes gibt es nicht nur keinen Unterschied von Form und Materie mehr, sondern auch nicht mehr den von ExistenzExistenz und Essenz,29 Akt und Potenz – und doch ist GottGott die unendliche Fülle des Seins.“30
Schliesslich sind die WerteWerte auch noch in einer anderen Hinsicht „ein Fingerzeig, ein Hinweis auf GottGott“31. Nämlich insofern, als sie „eine in ihrer Wertnatur wesenhaft fundierte ‚virtus unitiva‘“32 besitzen. Zwar macht nicht die vereinigende Kraft den Wert zum Wert, doch gründet jede wirkliche Verbundenheit zwischen Personen letztlich auf einem Wert bzw. auf einem WertbereichWertbereich. Die vereinigende Kraft der Werte lässt sich allerdings weder beweisen noch formal ableiten. Auch die virtus unitiva der Wertevirtus unitiva der Werte lässt sich nicht von aussen her konstatieren oder an einem äusseren Aspekt ablesen. Der „Wesenszusammenhang von Wert und EinheitEinheit“ wird erst sichtbar bei der „Vertiefung in das WesenWesen des Wertes, in seine einzigartige in sich ruhende BedeutsamkeitBedeutsamkeit, in seine unreduzierbare materiale Wertnatur“.33 Die vereinigende Kraft der Werte wird auch an den Unwerten ersichtlich, die den Werten konträr gegenüberstehen. Wie beispielsweise dem Wert der LiebeLiebe eine vereinigende Kraft innewohnt, geht mit dem dem Wert der Liebe konträren UnwertUnwert des Hasses „eine trennende, entzweiende, isolierende Wirksamkeit“34 einher. Zweifelsohne liegen diesem UrteilUrteil Erfahrungen zugrunde, die zu machen möglich und von vielen Menschen wohl auch tatsächlich schon gemacht worden sind.
Nicht zuletzt zeigt sich auch hieran, inwiefern die WerteWerte ein Hinweis auf GottGott, auf den Inbegriff aller WerteInbegriff aller Werte sind. Die einzelnen Werte ebenso wie der Inbegriff aller Werte stehen offensichtlich in einem Verhältnis zum oben angesprochenen LebenssinnLebenssinn, welcher durch die Abwendung von den transzendenten Werten, die in vielen Fällen nach einer Realisierung verlangen, in eine SinnkriseSinnkrise umzuschlagen scheint. Bevor allerdings die Grundlage zu einer angemessenen Auseinandersetzung mit dem Lebenssinn des Menschen gelegt und die „für die Wesensbestimmung der Werte entscheidenden drei Bedeutsamkeitskategorien“35 dargelegt werden, wird erst die Frage erörtert, warum von HildebrandHildebrandDietrich von das ontologische ArgumentArgument eigentlich verworfen hat.
4 Warum hielt von HildebrandHildebrandDietrich von das ontologische ArgumentArgument für ungültig?
Wie weiter oben dargelegt, wusste von HildebrandHildebrandDietrich von die Möglichkeit philosophischen, synthetischsynthetisch-apriorischen Erkennens zu begründen. Er vermochte nachzuweisen, dass der empirische Bereich transzendiert und Sachverhalte von innen her mit absoluter GewissheitGewissheit erkannt werden können, die in Gegenständen mit einem innerlich notwendigen SoseinSosein gründen. Dazu kommt, dass er GottGott als den Inbegriff aller WerteWerte versteht – als „die GüteGüte, die WahrhaftigkeitWahrhaftigkeit, die GerechtigkeitGerechtigkeit, die LiebeLiebe“1, ja dass Gott „das absolute Sein, die absolute WahrheitWahrheit, die absolute Gerechtigkeit und die unendliche Liebe ist“2. Wenn es in Gott überdies keinen Unterschied von ExistenzExistenz und Essenz mehr gibt3 und es nur bei dem absolut Seienden, nur bei Gott eine notwendige reale Existenz gibt,4 dann ist es zumindest der Frage wert, warum „wir sie [sc. die notwendige reale Existenz Gottes] nicht aus der Wesenheit Gottes allein erkennen“5 können.
4.1 Das ArgumentArgument in der Darlegung durch AnselmAnselmvon Canterbury von Canterbury
Das ist die grosse Frage, die die Philosophen seit jeher beschäftigt: Kann die ExistenzExistenz Gottes aus seinem WesenWesen erkannt werden? Wurzeln einer bejahenden StellungnahmeStellungnahme finden sich bei PlatonPlaton (427–347 v. Chr.)1 ebenso wie bei AugustinusAugustinus (354–430)2 oder bei BoethiusBoethius (etwa 480–524). Bei Letzterem findet sich unter anderem der zukunftsträchtige Gedanke, dass GottGott etwas ist, „über das hinaus es kein Besseres gibt“, ja sich „nichts Besseres als Gott ausdenken lässt“.3 AnselmAnselmvon Canterbury von Canterbury (1033–1109) hat diesen Gedanken in seiner Schrift Proslogion zu einem eigentlichen ArgumentArgument entwickelt, das seit Immanuel KantKantImmanuel als ontologischer GottesbeweisGottesbeweis bezeichnet wird.4 Die einschlägige Stelle aus dem genannten Werk von AnselmAnselmvon Canterbury von Canterbury sei in der Folge zitiert, um das Argument gründlich bedenken zu können:
So denn, Herr, der Du die Glaubenseinsicht schenkst, gib mir, soweit Du es für nützlich erachtest, dass ich verstehe, dass Du bist, wie wir es glauben, und dass Du das bist, was wir glauben. Und zwar glauben wir, dass Du etwas bist, über das hinaus nichts Grösseres gedacht werden kann [aliquid quo nihil maius cogitari possit]. Oder ist etwa ein solches WesenWesen nicht, weil der Tor in seinem Herzen gesprochen hat: Es ist kein GottGott? Wenn aber eben derselbe Tor eben das hört, was ich sage, nämlich etwas, über das hinaus nichts Grösseres gedacht werden kann, so versteht er ganz gewiss, was er hört, und was er versteht, ist in seinem Verstande, auch wenn er nicht versteht, dass dies ist. Eines nämlich ist es, wenn eine Sache im Verstande ist, etwas anderes, wenn man versteht, dass eine Sache ist. Wenn nämlich ein Maler zuvor denkt, was er ausführen wird, hat er [es] zwar im Verstande, aber er versteht noch nicht, dass das, was er noch nicht geschaffen hat, sei. Hat er es aber bereits gemalt, so hat er es sowohl im Verstande als auch versteht er, dass das, was er bereits geschaffen hat, ist. So wird also auch der Tor überzeugt, dass etwas, über das hinaus nichts Grösseres gedacht werden kann, zumindest im Verstande ist, weil er das versteht, wenn er es hört; und was auch immer verstanden wird, ist im Verstande. Und gewiss kann das, über das hinaus Grösseres nicht gedacht werden kann, nicht allein im Verstande sein. Denn wenn es nur im Verstande allein ist, so kann man denken, es sei auch in der WirklichkeitWirklichkeit, was grösser ist. Wenn also das, über das hinaus Grösseres nicht gedacht werden kann, im Verstande allein ist, so ist eben das, über das hinaus Grösseres nicht gedacht werden kann, dasjenige, über das hinaus Grösseres gedacht werden kann. Das aber kann mit Sicherheit nicht der Fall sein. Es existiert also ohne ZweifelZweifel etwas, über das hinaus Grösseres nicht gedacht werden kann, [und zwar] sowohl im Verstande als auch in der Wirklichkeit.5
Ja, das ist schlechterdings so wahrhaft, dass auch nicht einmal gedacht werden kann, es sei nicht. Denn man kann denken, dass etwas sei, von dem man nicht denken kann, es sei nicht; das [jedoch] ist grösser als dasjenige, von dem man denken kann, es sei nicht. Wenn man deshalb von dem, über das hinaus Grösseres nicht gedacht werden kann, denken kann, es sei nicht, dann ist das, über das hinaus Grösseres nicht gedacht werden kann, nicht das, über das hinaus Grösseres nicht gedacht werden kann; das [aber] kann nicht zusammenstimmen. So also ist wahrhaft etwas, über das hinaus Grösseres nicht gedacht werden kann, derart, dass man nicht einmal denken kann, es sei nicht. Und das bist Du, Herr, unser GottGott. So wahrhaft bist Du also, Herr mein Gott, dass Du auch nicht einmal als nicht seiend gedacht werden kannst.6
Die VernunftVernunft findet in sich selbst, so der Ausgangspunkt des Arguments, die Idee des höchsten Wesens vor. AnselmAnselmvon Canterbury spricht von dem, im Vergleich zu dem nichts Grösseres (nihil maius7) und nichts Besseres (nihil melius8) gedacht werden kann. Und nicht nur das: GottGott ist nicht nur derjenige, im Vergleich zu dem nichts Grösseres und nichts Besseres gedacht werden kann, er ist auch grösser als was überhaupt gedacht werden kann.9 Was er unter dem Grösser näherhin verstanden wissen will, erläutert AnselmAnselmvon Canterbury etwas später in derselben Schrift:
Allein, was also bist Du, Herr und GottGott, über den hinaus nichts Grösseres gedacht zu werden vermag? Was bist Du, wenn nicht das, was, alles überragend, allein durch sich existiert [und] alles andere aus dem Nichts geschaffen hat? Was nämlich dies nicht ist, ist weniger, als man denken kann. Das aber kann man von Dir nicht denken. Welches GutGutdas also fehlt dem überragenden GutGutdas, durch das jedes GutGutdas ist? Darum bist Du gerecht, wahrhaftig, selig und alles, was besser ist zu sein, als nicht zu sein [quidquid melius est esse quam non esse]. Denn es ist besser, gerecht zu sein, als nicht gerecht, selig, als nicht selig.10
Das Grösser ist also eine axiologische Qualität, demnach GottGott „etwas ist, das alles überragt, über das hinaus nichts Besseres [nihil melius] gedacht werden kann“11. Er vereinigt all das in seinem WesenWesen, was zu sein „absolut besser [absolute melius]“ ist, „als nicht zu sein“.12 Entscheidend ist der „BegriffBegriff ‚Wesen, das alle Vollkommenheiten in sich enthält‘“13. In diesem und nur in diesem einzigartigen Falle des Wesens, das alle Vollkommenheiten in sich enthält, ist die wirkliche ExistenzExistenz eine VollkommenheitVollkommenheit. Existierte dieses Wesen nämlich bloss in Gedanken, so wäre es nicht das vollkommenste WeseWesenn, denn es könnte ja ein Wesen gedacht werden, das nicht nur in Gedanken, sondern auch in WirklichkeitWirklichkeit existiert. Das aber wäre dann ein vollkommeneres Wesen, als ein nur in Gedanken existierendes. Folglich existiert das vollkommene Wesen nicht nur in Gedanken, sondern auch in Wirklichkeit.
Bei diesem Gedankengang setzt AnselmAnselmvon Canterbury freilich nicht voraus, dass das abschliessende VerstehenVerstehen des Wesens dessen, über den hinaus nichts Grösseres und nichts Besseres gedacht werden kann, überhaupt möglich ist. Er setzt nur soviel voraus, wie er in seiner Erwiderung auf die Einwände Gaunilos – einem Zeitgenossen Anselms, deren Kritik im nächsten Punkt behandelt werden wird – klarstellt, dass vom WesenWesen Gottes soviel verstanden wird, wie für das Verständnis dieses Gedankenganges vonnöten ist. „Wenn du [GauniloGaunilo] nun behauptest, das, was nicht ganz und gar verstanden sei, sei so gut wie nicht verstanden und nicht im Verstande, dann behaupte auch, dass derjenige, der das reinste Licht der Sonne nicht anschauen kann, das Tageslicht nicht sieht, das nichts anderes ist als das Sonnenlicht.“14
Doch grundsätzlich gefragt: Wie will man überhaupt denkerischen Zugang zum WesenWesen Gottes erhalten? Ist nicht jede Rede von GottGott anthropomorphanthropomorph, wie XenophanesXenophanes es den alten Mythen und Ludwig FeuerbachFeuerbachLudwig der christlichen ReligionReligion vorgeworfen haben?
4.2 GauniloGaunilo und die erste Kritik am ontologischen ArgumentArgument
Die erste literarisch greifbare PersonPerson, die Anselms Gedankengang explizit kritisiert hat, war – der bereits erwähnte – GauniloGaunilo (ca. 1000–1083), ein Benediktinermönch aus dem in der Nähe von Tours gelegenen Kloster Marmoutiers.1 Noch heute findet er Befürworter „seiner Kritik des Beweises von AnselmAnselmvon Canterbury“, die sich dafür aussprechen, dass Gaunilo zurecht auf den entscheidenden Fehler des Arguments hingewiesen habe.2 Worum es sich bei diesem Fehler handelt, lässt sich Gaunilos Worten selbst entnehmen:
Wie also wird mir bewiesen, dass jenes „grösser“ gemäss der wahren WirklichkeitWirklichkeit nach besteht, weil feststeht, dass es grösser als alles sei, während ich dies doch noch verneine und bezweifle, derart, dass ich behaupte, nicht einmal in meinem Verstande oder in meinem Denken sei dies „grösser“ selbst wenigstens auf dieselbe Weise wie auch vieles Zweifelhafte und Ungewisse? Zuerst nämlich ist es notwendig, dass ich die GewissheitGewissheit erlange, dass irgendwo dieses „grösser“ selbst in Wirklichkeit sei, und dann erst wird es auch nicht mehr zweifelhaft sein, dass es, aufgrund der Tatsache, dass es grösser ist als alles, auch in sich selbst Bestand habe.3
Zur Illustration bedient er sich des bekannten Beispiels von der gedachten „Insel, die vortrefflicher [praestantiorem] ist als alle Länder“4. Und „weil es vortrefflicher ist, nicht im Verstande allein, sondern auch in WirklichkeitWirklichkeit zu sein [quia praestantius est, non in intellectu solo sed etiam esse in re]“, so existiert sie notwendigerweise auch in WirklichkeitWirklichkeit; denn „wäre sie nämlich nicht, dann wäre jedes andere Land, das wirklich ist, vortrefflicher als sie, und so wäre sie, die […] als die vortrefflichere begriffen worden ist, nicht die vortrefflichere“.5
Was GauniloGaunilo an Anselms Gedankengang bemängelt, das ist, dass die notwendige ExistenzExistenz dessen, „über das hinaus nichts Grösseres gedacht werden kann“6, apriorisch erkannt werden soll, währenddem er selbst – Gaunilo – die ErkenntnisErkenntnis der notwendigen Existenz nur aposteriorisch für möglich hält. Was seinen Worten zu entnehmen ist: „Zuerst nämlich ist es notwendig, dass ich die GewissheitGewissheit erlange, dass irgendwo dieses ‚grösser‘ selbst in WirklichkeitWirklichkeit sei, und dann erst wird es auch nicht mehr zweifelhaft sein, dass es, aufgrund der Tatsache, dass es grösser ist als alles, auch in sich selbst Bestand habe.“7
Wenn Franz von KutscheraKutscheraFranz von das ArgumentArgument von GauniloGaunilo für „ebenso korrekt [hält] wie das von AnselmAnselmvon Canterbury“8, dann ist das aus der Sicht der formalen LogikLogik stimmig. Nicht aber, wenn es aus materialer Sicht betrachtet wird. Denn wenn von KutscheraKutscheraFranz von meint, Gaunilo hätte „den BeweisBeweis Anselms dadurch ad absurdum geführt, dass er nach demselben Schema die ExistenzExistenz einer vollkommenen Insel nachwies“, indem er sagte: „Eine in jeder Hinsicht vollkommene (schöne, fruchtbare, klimatisch bevorzugte etc.) Insel ist denkbar, existiert also in intellectu. Würde sie nicht tatsächlich existieren, so wäre sie nicht vollkommen. Also existiert sie.“9 Bei diesem Gedankengang werden die Sachen selbst – im Kantschen Sinne – auf ihre blosse FormForm reduziert, ganz ausser Acht wird jedoch gelassen, dass das SoseinSosein einer Insel und das Sosein Gottes in materialer Hinsicht nicht nach demselben Schema behandelt werden können.10 Das wird sich zeigen, wenn weiter unten die reinen Vollkommenheitenreine Vollkommenheiten als die einzigen Momente eines adäquaten Gottesbegriffs herausgearbeitet werden.11