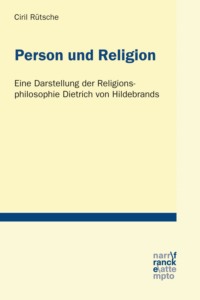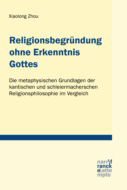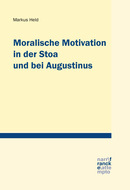Kitabı oku: «Person und Religion», sayfa 12
4.3 Die Einwände gegen das ontologische ArgumentArgument durch Thomas von AquinThomas von Aquin und Immanuel KantKantImmanuel
Zu den namhaftesten Kritikern sind aus erkenntnistheoretischer Sicht Thomas von AquinThomas von Aquin und Immanuel KantKantImmanuel zu rechnen. Während Thomas von Aquin – im Anschluss an GauniloGaunilo – die Möglichkeit der unmittelbaren Erkennbarkeit Gottes verneinte und nur die Möglichkeit der mittelbaren ErkenntnisErkenntnis zu begründen wusste, war GottGott auch nach KantKantImmanuel nicht unmittelbar zu erkennen. Doch hielt er ihn auch auf indirektem Wege nicht für erkennbar, vielmehr reduzierte er ihn – wie gesehen – auf ein blosses Postulat, d.h. auf eine theoretische Annahme, um sittliche TatsachenTatsachen verstehen zu können.
Thomas wendet sich in seiner theologischen Summe ausdrücklich, wenn auch nicht unter Nennung des Namens, gegen Anselms ArgumentArgument. Wie GauniloGaunilo, so hält auch er das ontologische Argumentontologische Argument für einen unerlaubten Schritt aus der Denk- in die Seinsordnung. Denn
auch zugegeben, dass jedermann unter dem Ausdruck ‚GottGott‘ ein WesenWesen verstehe, über das hinaus nichts Grösseres gedacht werden kann, so folgt daraus noch nicht, dass man dieses durch den Namen ‚Gott‘ bezeichnete Wesen auch als wirklich seiend erkenne, sondern nur, dass es sich in unserem Denken findet.1
„Da wir aber gerade das, was GottGott ist, mit dem GeistGeist nicht begreifen können, bleibt es in Bezug auf uns unerkannt.“2 Denn man müsse die bezeichnete Sache und den begrifflichen Gehalt des Wortes auf derselben Ebene ansetzen.3 Angesichts dessen, dass der MenschMensch nachweislich die Möglichkeit hat, Erkenntnisse über transzendente Wirklichkeiten zu erlangen,4 erscheint das zuletzt genannte Postulat des Thomas von AquinThomas von Aquin zumindest als problematisch.5 An dieser Stelle sei sein Gedankengang immerhin bis zu der Stelle weiter entwickelt, an der seine Absicht offen zutage tritt. Der Mensch, so Thomas, könne Gott „nicht in ihm selbst schauen […], sondern nur in seinen Wirkungen [ex effectibus], und der somit nur durch Schlussfolgern [ratiocinando] zur ErkenntnisErkenntnis, dass Gott ist, geführt wird“6. „Daher muss der Mensch durch die in den Wirkungen entdeckten Ähnlichkeiten zur GotteserkenntnisGotteserkenntnis auf dem Wege der SchlussfolgerungSchlussfolgerung gelangen.“7
Mit diesen Schlussfolgerungen bezieht er sich auf die bereits erwähnten fünf Wege (quinque viae). Bei allen steht am Anfang die Konstatierung eines kontingenten Seienden, von wo aus deren UrsacheUrsache erschlossen wird. Beim ersten Weg wird von der Feststellung, dass sich etwas bewegt, auf einen ersten Beweger geschlossen. Beim zweiten geht er von der Feststellung aus, „dass es in der sichtbaren Welt eine Über- und Unterordnung von Wirkursachen gibt“8, was ihn zur Annahme einer ersten Wirkursache führt. Beim dritten – weiter oben behandelten9 – Weg führt ihn die Feststellung des Unterschieds von möglichem und notwendigem Sein zu dem Sein, das den Grund seiner NotwendigkeitNotwendigkeitsubjektive in sich selber hat. Der vierte Weg führt über die Feststellung, „dass das eine mehr oder weniger gut, wahr, edel ist als das andere“10 zur Erschliessung der Ursache aller Vollkommenheiten, die unter den Menschen nur begrenzt vorhanden sind. Der fünfte Weg geht aus von der Weltordnung, und zwar von den Dingen, die keine ErkenntnisErkenntnis haben und dennoch auf ein festes ZielZiel hin tätig sind. Was er dadurch erwiesen sieht, „dass sie immer oder doch in der Regel in der gleichen Weise tätig sind und stets das Beste erreichen“11. „Die vernunftlosen WesenWesen sind aber nur insofern absichtlich, d.h. auf ein Ziel hin tätig, als sie von einem erkennenden geistigen Wesen auf ein Ziel hingeordnet sind, wie der Pfeil vom Schützen.“12
Auf diesen fünf Wegen wird der MenschMensch „durch Schlussfolgern zur ErkenntnisErkenntnis, dass GottGott ist, geführt“13. Sei es nun das Erstbewegende oder die erste Wirkursache, sei es das in sich notwendige oder das vollkommene Sein, sei es das geistig-erkennende WesenWesen, das alle Naturdinge auf ihr ZielZiel hinordnet, immer werde es „von allen ‚Gott‘ genannt“14. Mit diesem aposteriorischen Vorgehen bezieht er sich offensichtlich nicht auf AnselmAnselmvon Canterbury, der das Dasein Gottes aus seinem Wesen zu erkennen suchte.15 Vielmehr basiert er mit seinen fünf Wegen auf dem Wissenschaftsbegriff der Zweiten Analytiken des AristotelesAristoteles. Für Aristoteles ist die WissenschaftWissenschaft ein auf unmittelbar einsichtigen, unbeweisbaren Prämissen aufgebautes deduktives System von Aussagen. Unbeweisbar meint, dass die Prämissen nicht die KonklusionKonklusion eines Schlusses sein können, sondern unmittelbar eingesehen werden müssen. Neben den einsichtigen Prämissen muss die Wissenschaft noch zwei weitere Voraussetzungen machen, die sie ebenfalls nicht beweisen kann: Sie muss die Bedeutung der Wörter kennen, die sie verwendet, und sie muss die ExistenzExistenz der Gegenstände annehmen, auf die sie sich bezieht. Diese zweite Voraussetzung will Thomas mit den fünf Wegen als gegeben erweisen.16
Was Immanuel Kants Umgang mit dem ontologischen ArgumentArgument betrifft, so hat sich weiter oben einerseits bereits gezeigt, dass und warum seine ErkenntnistheorieErkenntnistheorie die Erlangung metaphysischer Erkenntnisse verhindert, andererseits auch, dass er aus menschlich-existentieller Sicht nicht umhin konnte, die ExistenzExistenz Gottes zumindest auf ein Postulat, auf eine ForderungForderung der praktischen VernunftVernunft zu reduzieren. Nichtsdestotrotz sei der Grund, weswegen er das ontologische Argumentontologische Argument verwirft, in der Folge angeführt, da er – gleich wie in erkenntnistheoretischer Hinsicht – mit seinen Irrtümern die negativen Voraussetzungen geschaffen hat.17 Denn hätte er das absolut gewisse ErkennenErkennen nicht auf die FormForm reduziert, so wäre auch der Anstoss unterblieben, nach dem AprioriApriori auch im Materialen zu forschen. Desgleichen in Bezug auf das ontologische Argument. Auch bei der BegründungBegründung der Existenz Gottes lag offensichtlich einiges im Argen. Wohl sei „eine Namenserklärung von diesem BegriffBegriff ganz leicht, dass es nämlich so etwas sei, dessen Nichtsein unmöglich ist, aber man wird hierdurch um nichts klüger“18.
Wie für die genannten Vorgänger der Kritik am ontologischen ArgumentArgument, so folgt das Dasein Gottes auch für KantKantImmanuel nicht aus dessen SoseinSosein. So ist es auch nur insofern notwendig, dass ein Triangel drei Winkel hat, als ein Triangel da ist, denn nur dann „sind auch drei Winkel (in ihm) notwendiger Weise da“19. „Einen Triangel setzen und doch die drei Winkel desselben aufheben, ist widersprechend; aber den Triangel samt seinen drei Winkeln aufheben, ist kein WiderspruchWiderspruch.“20 Ebenso sei es auch mit „dem Begriffe eines absolutnotwendigen Wesens bewandt“21. „Wenn ihr das Dasein desselben aufhebt, so hebt ihr das Ding selbst mit allen seinen Prädikaten auf; wo soll alsdenn der Widerspruch herkommen?“22
Der Gedankengang Anselms ebenso wie die fünf Wege des Thomas von AquinThomas von Aquin sind für KantKantImmanuel analytische Sätze. Es sind ihm TautologienTautologien, bei denen das, was im BegriffBegriff Gottes enthalten ist, bloss erläutert wird. Bekanntlich ist es KantKantImmanuel jedoch nicht um analytische, sondern um synthetische Erkenntnisse zu tun. Um Erkenntnisse also, die einen gegebenen Begriff nicht bloss erläutern – d.h. analysieren und ihn in seine Bestandteile zerlegen –, sondern einen anderen Begriff, der im ersteren nicht enthalten ist, als notwendig zu ihm gehörig erfassen.23 Es ist evident, dass die Existentialerkenntnisse von dieser wissenserweiternden Art sind. Nach KantKantImmanuel sind die philosophischen Erkenntnisse jedoch nicht nur synthetischsynthetisch, sie sind überdies auch apriorisch, ihre Quellen liegen also jenseits der Erfahrung – der inneren wie der äusseren.24 Da die Anschauung und die Begriffe für KantKantImmanuel die Elemente einer jeden ErkenntnisErkenntnis ausmachen,25 die Anschauungen des Menschen jederzeit sinnlich sind26 und Gottes Dasein nun einmal nicht sinnlich angeschaut werden kann, so ist es aufgrund dieser Prämissen nichts als folgerichtig, wenn er dem ontologischen ArgumentArgument eine „Verwechslung eines logischen Prädikats mit einem realen“27 anlastet. Worin KantKantImmanuel mit dem erwähnten Standpunkt von Franz von KutscheraKutscheraFranz von übereinstimmt. Auch er ging mit den zitierten Kritikern einig, dass es sich beim ontologischen Argument um einen unberechtigten Sprung aus der Denk- in die Seinsordnung handelt, da das Dasein Gottes in seinem SoseinSosein nicht erkannt werden könne.
„Unser BegriffBegriff von einem Gegenstande mag also enthalten, was und wie viel er wolle, so müssen wir doch aus ihm herausgehen, um diesem die ExistenzExistenz zu erteilen.“28 Bei den Objekten der Sinne geschehen die entsprechenden Wahrnehmungen nach empirischen Gesetzen, „aber für Objekte des reinen Denkens ist ganz und gar kein Mittel, ihr Dasein zu erkennen, weil es gänzlich a prioria priori erkannt werden müsste“29.
4.4 Die reinen Vollkommenheitenreine Vollkommenheiten als Gültigkeitsgrund des ontologischen Arguments
Wie den Kritiken von GauniloGaunilo, Thomas von AquinThomas von Aquin und Immanuel KantKantImmanuel zu entnehmen ist, halten sie das ontologische ArgumentArgument darum für ungültig, weil das WissenWissen um das Dasein Gottes durch reines Denken erworben werden soll, statt auf dem Wege der Synthesis bzw. der Erfahrung. Damit rückt das weiter oben besprochene Thema des synthetischsynthetisch-apriorischen Erkennens wieder ins Blickfeld. Wie an jener Stelle gesehen, versteht von HildebrandHildebrandDietrich von das synthetisch-apriorische ErkennenErkennen als höchst intelligibles und absolut gewisses Erkennen eines in einer notwendigen Soseinseinheit oder Weseneinheit gründenden Sachverhalts. Das objektive Korrelat ist ihm das Verhalten einer in sich notwendigen Wesenheit. Sind die Voraussetzungen damit geschaffen, um die „existential erweiterte WesensnotwendigkeitWesensnotwendigkeit“1 zu begründen?
Das hängt ganz davon ab, ob das ArgumentArgument von einem anthropomorphen Begriffanthropomorphen Begriff oder vom objektiven und notwendigen WesenWesen Gottes ausgeht, wie auch davon, ob die ExistenzExistenz im notwendigen Wesen Gottes gründen und ob dies auch erkannt werden kann.
Gleich an dieser Stelle sei gesagt, dass es sich insofern nicht um einen anthropomorphen Begriffanthropomorphen Begriff handelt, als von GottGott keine Eigenschaften ausgesagt werden, die endlich, begrenzt und unvollkommen sind. Wenn AnselmAnselmvon Canterbury in diesem Sinne sagt, dass Gott all das in seinem WesenWesen vereinigt, „von dem wir denken können, es sei absolut besser zu sein, als nicht zu sein“2, dann bezieht er sich mit der Negation freilich nicht auf den kontradiktorischen Gegensatzkontradiktorischer Gegensatz, so als wäre es absolut besser ein Vogel zu sein, als überhaupt nicht zu sein. Die augenscheinlichen Schwierigkeiten, die mit Anselms formaler Bestimmung verbunden sind, bewogen Johannes Duns ScotusDuns ScotusJohannes (1265–1308) zu einer weitergehenden Unterscheidung, dergemäss das Wesen, „über das hinaus nichts Besseres gedacht werden kann“3, all das in sich vereinigt, was „schlechthin und an und für sich genommen besser ist als jegliches mit ihr Unvereinbare [absolute melius quocumque incompossibili]“4. Nicht vereinbar mit dem, „was schlechthin und an und für sich genommen besser ist“, wie Walter HoeresHoeresWalter dartut, „ist alles, was in seinem Wesen mit Einschränkung, Teilnegation der Position und daher Zusammensetzung behaftet ist und von Scotus mit der Tradition ‚gemischte Vollkommenheitgemischte Vollkommenheit‘ (perfectio mixta) genannt wird“.5 Wozu eben gerade all das gehört, was endlich, begrenzt und unvollkommen ist, oder anders gesagt, was der Ordnung von Genus und Spezies angehört. Auch setzt dasjenige, „von dem wir denken können, es sei absolut besser zu sein, als nicht zu sein“6, ein Wesen voraus, das überhaupt darauf angelegt ist, es zu sein.7
Duns ScotusDuns ScotusJohannes, der sich in Bezug auf die göttlichen Wesensmerkmale – die reinen Vollkommenheitereine Vollkommenheitenn (perfectioni simpliciter) – grosse Verdienste erworben hat, blieb hierbei aber noch nicht stehen. So lassen die reinen Vollkommenheitenreine Vollkommenheiten überdies UnendlichkeitUnendlichkeit in einer Weise zu, dass sie nur in der unendlichen FormForm wahrhaft sie selber sind.8 Die Unendlichkeit der reinen Vollkommenheitenreine Vollkommenheiten ist denn auch der Grund, weswegen AnselmAnselmvon Canterbury sagt, dass GottGott nicht nur dasjenige ist, „über das hinaus nichts Grösseres gedacht werden kann“9, sondern auch „etwas Grösseres, als gedacht werden kann“10. Nichtsdestotrotz lassen sich die reinen VollkommenheVollkommenheititreine Vollkommenheitenen in ihrem formalen Wesensgehalt (ratio formalis), in ihrem reinen SoseinSosein oder WesenWesen von allen Begrenztheiten, denen sie in den endlich Seienden unterworfen sind, abstrahieren.11 Diesbezüglich lehrte schon AugustinusAugustinus:
Wenn du daher von diesem GutGutdas und jenem GutGutdas hörst, das auch einmal nicht gut heissen kann, und wenn du dann ohne die Güter, welche durch Teilnahme am Guten selbst gut sind, das GuteGutedas selbst, durch dessen Teilnahme sie gut sind, durchschauen kannst – wenn du nämlich von diesem und jenem GutGutdas hörst, dann siehst du zugleich das GutGutdas selbst –, wenn du also jene Güter beiseite lässt und das GuteGutedas selbst durchschauen kannst, dann schaust du GottGott.12
Die reinen Vollkommenheitenreine Vollkommenheiten, deren Sein oder Besitz absolut besser ist als ihr Nichtsein oder ihr Nichtbesitz, weisen zudem eine gegenseitige Verträglichkeit auf, die solcherart ist, dass sie alle gleichzeitig besessen bzw. realisiert werden können, ja keine im vollen Masse sie selbst ist ohne all die anderen (nulla perfectio simpliciter est incompossibilis alteri perfectioni simpliciter13). Jeder BeweisBeweis einer Unverträglichkeit einer Eigenschaft E mit einer reinen VollkommenheitVollkommenheit R würde beweisen, dass E oder R oder beide keine reinen Vollkommenheitenreine Vollkommenheiten sind. Und schliesslich sind die reinen VollkommenheVollkommenheititreine Vollkommenheitenen irreduzibel einfacirreduzibel einfachh (omnis perfectio simpliciter est simpliciter simplex14), d.h. dass sie weder auf etwas anderes reduziert noch von etwas anderem deduziert werden können.15
Welches aber sind die materialen Eigenschaften, die diese formalen Merkmale aufweisen? Welches sind die Eigenschaften, die absolut besser sind als alles, was damit nicht zu vereinbaren ist, die nur in der unendlichen FormForm wahrhaft sie selber, die gegenseitig verträglich und irreduzibel einfachirreduzibel einfach sind? Die reinen Vollkommenheitenreine Vollkommenheiten können in drei Gruppen unterschieden werden. Zur ersten Gruppe gehören – nach der mittelalterlichen Terminologie – die TranszendentalienTranszendentalien: das Sein (ens und esse), das WesenWesen (res), die innere EinheitEinheit (unum), das Etwassein und damit das in sich selber, vom Nichts und von Anderem Unterschiedensein (aliquid), die Seinswahrheit (verum), das GuteGutedas (bonum) und schliesslich das Schöne (pulchrum).16 Da sie alle keiner Seinsart und keinem Seienden überhaupt ganz fehlen können, stellen sie schlechthinnige Vollkommenheiten dar. Zur zweiten Gruppe der reinen Vollkommenheitereine Vollkommenheitenn gehören jene, die nur einigen Seienden in der Welt zugehören, wie Leben, WeisheitWeisheit, FreiheitFreiheit, ErkenntnisErkenntnis, LiebeLiebe. Auch sie sind ihrer VollkommenheitVollkommenheit nach nicht begrenzt. Drittens gibt es die Gruppe der exklusiv göttlichen Eigenschaften, „wie ein aus sich seiendes Wesen (ein ens a se) zu sein, absolute UnendlichkeitUnendlichkeit, Allwissenheit, AllmachtAllmacht, Allgegenwärtigkeit, anfanglose EwigkeitEwigkeit, höchste Verkörperung des Sittlichen und höchster Richter zu sein“17.
Die reinen Vollkommenheitenreine Vollkommenheiten sind die einzige Möglichkeit, objektive Eigenschaften des vollkommenen Wesens zu benennen und sich nicht in blossen AnthropomorphismenAnthropomorphismen zu ergehen. Sie geben deutlich zu erkennen, dass das vollkommene WesenWesen weder innerlich unmöglich noch widersprüchlich, sondern vielmehr unerfindbar-notwendig ist. Inwiefern trägt dies nun aber bei zur ErkenntnisErkenntnis des Sachverhalts der notwendigen ExistenzExistenz des vollkommenen Wesens? Ausgangspunkt war ja der Gedankengang: Weil das Wesen Gottes alle Vollkommenheiten in sich vereinigt, ist seine Realexistenz eine VollkommenheitVollkommenheit, und weil die reale Existenz im Falle des vollkommenen Wesens eine Vollkommenheit ist, darum existiert es auch mit NotwendigkeiNotwendigkeitsubjektivet. Betrachtet man dahingegen die Dinge dieser Welt, so lässt sich mit Thomas von AquinThomas von Aquin feststellen, wie die wirkliche Existenz zum jeweiligen Wesen von aussen hinzukommt.18 Wie aber steht es mit dem Wesen, über das hinaus nichts Grösseres und nichts Besseres gedacht werden kann? Kommt auch dem vollkommenen Wesen die Existenz von aussen zu? Ist das nicht widersprüchlich? Schliesst das vollkommene Wesen nicht gerade aufgrund seines Wesens die notwendige Existenz ein? Es ist evident, dass der ständig drohende Verlust der Existenz nur dem zukommen kann, was unvollkommen ist. Beim vollkommenen Wesen dagegen sind Sein und Wesen identisch, ja müssen identisch sein, denn vollkommen ist eben nur das WesenWesen, das den Grund seiner Existenz in sich selber hat. Hätte das vollkommene Wesen seine Existenz nicht aus sich selber, sondern wäre stetig in Gefahr, seine Existenz wieder einzubüssen, so wäre es mit Sicherheit nicht das, worüber hinaus nichts Grösseres gedacht werden kann. Eine tatsächliche oder auch nur eine als möglich gedachte Nichtexistenz widerspricht dem Wesen Gottes.
Wer vermeint, dieses WesenWesen könne auch nicht sein, legt Zeugnis ab von seinem Nichtverstehen dieser einzigartigen WesensnotwendigkeitWesensnotwendigkeit. Dies war bei GauniloGaunilo der Fall, der gegen AnselmAnselmvon Canterbury den absurden Einwand vorbrachte, dass die vollkommenste Insel notwendigerweise existiere, da eine wirklich seiende Insel vollkommener sei als eine bloss gedachte. Indessen übersah er mit vielen anderen Philosophen jedoch, dass die vollkommenste Insel – trotz aller begrifflichen NotwendigkeitNotwendigkeitsubjektive – die notwendige reale ExistenzExistenz aufgrund ihres Wesens nicht nur nicht einschliesst, sondern gerade strikt ausschliesst. „So bleibt kein ZweifelZweifel daran“, wie Josef SeifertSeifertJosef feststellt, der sich seit seinen frühen Jugendjahren mit dem ontologischen ArgumentArgument beschäftigt und ihm mit GottGott als GottesbeweisGottesbeweis schliesslich eine überzeugende Schrift gewidmet hat, „dass in der Tat zur göttlichen, und nur zur göttlichen Wesenheit, die reale und absolut notwendige Existenz, das absolute Nicht-nicht-sein-Können gehört.“19
4.5 Dietrich von Hildebrands implizite Bejahung des ontologischen Arguments
Wenn diese Ausführungen bedacht werden, stellt sich unweigerlich und berechtigterweise die Frage, warum von HildebrandHildebrandDietrich von trotz seiner Erkenntnismethode und trotz seines Gottesbegriffs – Inbegriff aller WerteWerte – sowie im WissenWissen, dass es in GottGott keinen Unterschied von ExistenzExistenz und Essenz und es nur bei ihm eine notwendige reale Existenz gibt, die Auffassung vertreten kann, dass man die notwendige reale Existenz Gottes „nicht aus der Wesenheit Gottes allein erkennen“1 kann. Von HildebrandHildebrandDietrich von hätte die Bedingungen eigentlich erfüllt, um die notwendige reale Existenz aus dem SoseinSosein Gottes erkennen zu können. Denn zumindest implizit hatte er die reinen Vollkommenheitenreine Vollkommenheiten erkannt, was sich nicht nur daran zeigt, dass er Gott als „die GüteGüte, die WahrhaftigkeitWahrhaftigkeit, die GerechtigkeitGerechtigkeit, die LiebeLiebe“2 bezeichnet, sondern auch daran, dass Gott „das absolute Sein, die absolute WahrheitWahrheit, die absolute Gerechtigkeit und die unendliche Liebe ist“3. Ausnahmslos reine Vollkommenheiten (perfectioni simpliciter). In dieselbe Richtung weist auch sein WortWort vom „Wesenszusammenhang von Allgüte und AllmachtAllmacht“, die, „obgleich völlig selbständige Qualitäten, sich gegenseitig wesensmässig bedingen“4. Wenngleich von HildebrandHildebrandDietrich von dafür eintrat, dass man die notwendige reale Existenz Gottes „nicht aus der Wesenheit Gottes allein erkennen“5 kann, so hat er Gott nichtsdestotrotz gerade solche Eigenschaften zugeschrieben, die die Möglichkeit des Erkennens der realen Existenz aus dem WesenWesen Gottes begründen. Denn alle Eigenschaften, die er Gott zuschreibt, sind absolut besser als alles, was damit nicht zu vereinbaren ist, sind nur in der unendlichen FormForm wahrhaft sie selber, sind überdies gegenseitig verträglich und sind nicht zuletzt auch irreduzibel einfachirreduzibel einfach. Auch wenn die Eigenschaften Gottes, die von HildebrandHildebrandDietrich von zur Sprache gebracht hat, hier nicht abschliessend erwähnt werden, so geben alleine schon die angeführten zu erkennen, dass sie die genannten Merkmale der reinen Vollkommenheitenreine Vollkommenheiten aufweisen. Warum das ontologische ArgumentArgument für von HildebrandHildebrandDietrich von trotzdem ungültig war, bleibt eine offene Frage. Fehlte es ihm schlicht und einfach an überzeugenden Begründungen? Dafür scheint jedenfalls eine Anmerkung aus dem bereits genannten Werk von Josef SeifertSeifertJosef zu sprechen, der ausdrücklich davon spricht, dass von HildebrandHildebrandDietrich von sehr aufgeschlossen gewesen sei gegenüber der Möglichkeit, dass das ontologische Argumentontologische Argument, angemessen begründet, gültig sein könne.6
Da von HildebrandHildebrandDietrich von quer durch sein Schrifttum GottGott immer wieder als Inbegriff aller WerteWerte bezeichnet, sei im Anschluss an die Auseinanderlegung der reinen Vollkommenheitenreine Vollkommenheiten als den einzigen Momenten eines adäquaten Gottesbegriffs schliesslich auch das Verhältnis abschliessend zu bestimmen gesucht, in dem die Werte und die reinen Vollkommenheitenreine Vollkommenheiten zueinander stehen. Die leitende Frage geht dahin, ob Gott seinem WesenWesen nach oder qua Schöpfer als Inbegriff aller WerteInbegriff aller Werte zu verstehen ist. Wenn mit dem Inbegriff aller Werte auf sein Wesen abgezielt wird, dann müssten alle Werte reine Vollkommenheiten sein, geben sie alleine die göttlichen Wesenseigenschaften doch angemessen wieder. Wenn Gott qua Schöpfer als Inbegriff aller Werte verstanden sein soll, dann wiederum müssten nicht alle Werte notwendigerweise reine Vollkommenheiten sein.
Aus dem weiter oben dargelegten Merkmal der WerteWerte sowie den Merkmalen der reinen Vollkommenheitenreine Vollkommenheiten geht hervor, dass die reinen Vollkommenheitenreine Vollkommenheiten aufgrund ihrer intrinsischen BedeutsamkeitBedeutsamkeit Werte sind. Reine Vollkommenheiten finden sich unter den ontologischen, den sittlichen, den intellektuellen wie auch unter den ästhetischen Werten, doch nicht in dem Sinne, als wären alle diesbezüglichen Werte reine Vollkommenheiten. Denn was die ontologischen Werte betrifft, so sind nur einige davon reine Vollkommenheiten. Eine reine VollkommenheitVollkommenheit ist beispielsweise der Wille, keine reine Vollkommenheiten sind dagegen die Farbe oder die MenschenwürdeMenschenwürde. Von den intellektuellen Werten sind ebenfalls nur einige reine Vollkommenheiten, und zwar jene, die nicht wesenhaft die BegrenztheitBegrenztheit des Intellekts voraussetzen, sondern das WesenWesen des Intellekts als solchen betreffen. Auch von den ästhetischen Werten zählen nur einige zu den reinen Vollkommenheitenreine Vollkommenheiten. Während dazu etwa vollkommene EinheitEinheit oder absolute SchönheitSchönheit gehören, sind Charme, Eleganz und dergleichen keine reinen Vollkommenheitenreine Vollkommenheiten.
Bei der Familie der sittlichen WerteWerte verhält es sich schliesslich so, dass bei vielen dieser Werte – z.B. bei der GüteGüte, der WahrhaftigkeitWahrhaftigkeit, der GerechtigkeitGerechtigkeit oder der LiebeLiebe, die von HildebrandHildebrandDietrich von GottGott zugeschrieben hat7 – es sich um reine Vollkommenheiten handelt. Bei anderen sittlichen Werten fällt es wiederum schwer, sie Gott zuschreiben zu wollen, z.B. bei der BescheidenheitBescheidenheit oder der DemutDemut, so als könnten sie in unendlicher göttlicher FormForm existieren, auch wenn es gemäss dem christlichen Glauben eine spezifisch gottmenschliche Demut gibt. Keine reinen Vollkommenheitenreine Vollkommenheiten, die Gott zugeschrieben werden können, sind – kurz gesagt – jene, die die kreatürliche BegrenztheitBegrenztheit und Geschaffenheit des Subjekts voraussetzen. Da sie keine UnendlichkeitUnendlichkeit zulassen, sind diese sittlichen Werte den gemischten Vollkommenheiten zuzurechnen. Zu ihnen gehört u.a. auch die ReueReue, die an die SündeSünde gebunden ist und daher für Gott sinnlossinnlos wäre, des Weiteren die Verzichtsbereitschaft oder der Opferwille, die eindeutig menschliche Dimensionen haben, und Gott von da her nicht zugeschrieben werden können. Anders stellen sich die Verzichtsbereitschaft und der Opferwille oder auch MitleidMitleid und GeduldGeduld und v.a. BarmherzigkeitBarmherzigkeit freilich für die PersonPerson dar, die an die Menschwerdung Gottes glaubt. Dann gibt es beispielsweise eine göttliche Verzichtsbereitschaft (auf das Festhalten an seiner Gottheit) oder einen göttlichen Opferwillen aus Liebe, der sich in der Menschwerdung, der Passion und der Kreuzigung des Gottmenschen offenbart.
Ein grosses Problem stellen schliesslich die rein göttlichen moralischen Vollkommenheiten dar, die scheinbar die SchöpfungSchöpfung voraussetzen und nicht vor dieser im rein göttlichen Leben gedacht werden können, wie z.B. die BarmherzigkeitBarmherzigkeit; denn GottGott kann doch nicht sich selber gegenüber barmherzig sein, oder die GerechtigkeitGerechtigkeit, da Gott nicht sich selber gegenüber Gerechtigkeit widerfahren lassen kann. Dieses Problem wird noch schwerer, wenn an die scheinbar höchste moralische VollkommenheitVollkommenheit Gottes gedacht wird, die das BöseBösedas vorauszusetzen scheint, nämlich die göttliche Sündenvergebung. Braucht Gott etwa das BöseBösedas, um diese Vollkommenheit zu besitzen? Ja ist es auch nur denkbar, dass Gottes ewiges Leben vor der Schöpfung weniger vollkommen gewesen ist als nach ihr, auch wenn in der ewigen göttlichen GüteGüte und LiebeLiebe das Geschöpf und die SündeSünde vorausgesetzt sind? Die reinen Vollkommenheitenreine Vollkommenheiten, die potentiellpotentiell Barmherzigkeit, VergebungVergebung etc. einschliessen, scheinen Gott seit Ewigkeiten zu eignen, auch wenn deren Ausübung das Geschöpf oder sogar die Sünde voraussetzt. Dieser grob skizzierte Komplex an ungelösten Fragen gibt jedenfalls klar zu erkennen, dass grosse AporienAporien angesichts der reinen Vollkommenheitenreine Vollkommenheiten bestehen, die den Menschen und das BöseBösedas voraussetzen.8
Abschliessend lässt sich immerhin so viel mit GewissheitGewissheit festhalten, dass alle reinen Vollkommenheitenreine Vollkommenheiten WerteWerte, nicht alle Werte aber reine Vollkommenheiten sind.