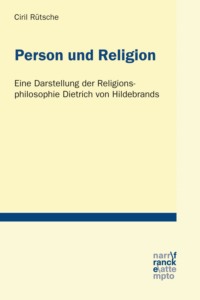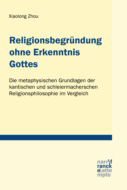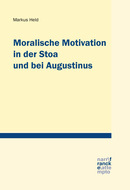Kitabı oku: «Person und Religion», sayfa 5
7.2 Die Differenzierung der Seienden in drei grundsätzlich verschiedene Arten als Wegbahnung zum apriorischen ErkennenErkennen
Aus welchen Gründen aber sind gewisse Erkenntnisse notwendig, unvergleichlich intelligibelintelligibel und absolut gewiss? Das hängt ganz davon ab, von welcher Art von EinheitEinheit ein gegebenes Seiendes ist, über dessen Verhalten ein WissenWissen erworben werden soll. Von HildebrandHildebrandDietrich von unterscheidet die Soseinseinheiten in drei verschiedene Grundtypen, von denen die ersten beiden Arten Gegenstände der empirischen ErkenntnisErkenntnis sind. Nur eine ganz spezifische Art von SoseinSosein ist apriorischer Erkenntnis zugänglich. Gegenstände der empirischen Erkenntnis sind die chaotischen und zufälligen EinheitenEinheitenchaotische, zufällige, morphische und die morphischen EinheitenEinheitenchaotische, zufällige, morphische, Gegenstände apriorischen Erkennens dagegen sind die wesensnotwendigen EinheitenEinheitenchaotische, zufällige, morphische.1 Beispiele für die chaotischen und zufälligen EinheitenEinheitenchaotische, zufällige, morphische sind solche EinheitenEinheitenchaotische, zufällige, morphische wie ein Steinhaufen, eine Tonfolge, die keine Melodie ist, ein Haufen Gerümpel und dergleichen mehr. Von diesen zufälligen EinheitenEinheitenchaotische, zufällige, morphische unterscheiden sich die Gegenstände wie Gold, SteinSteinEdith, Wasser, Pferd etc. Diese Gegenstände sind nicht zufällig so wie sie sind, sie haben eine Washeit.
Innerhalb solcher Seiender müssen zwei Schichten unterschieden werden: die Erscheinungseinheit und die konstitutive EinheitEinheit. Erstere ist das „Gesicht“, die äussere ErscheinungErscheinung, letztere das SoseinSosein des Materietyps, der dieses Gesicht trägt. Jede Schicht verlangt eine andere Erkenntnisart. Um das WissenWissen bezüglich der Erscheinungseinheit zu bereichern, muss beschreibend vorgegangen werden: um den Gegenstand herumgehen und alle ihn betreffenden BeobachtungenBeobachtungen sammeln. Die innere konstitutive Einheit dagegen kann nur durch komplizierte Experimente, wie die der Chemie, und durch die Verwendung von Instrumenten, etwa des Mikroskops, erreicht werden.2
Befassen wir uns jedoch mit Gegenständen wie einem Dreieck, einer PersonPerson, dem WillenWillen, der LiebeLiebe usw., so stehen wir vor einem völlig neuen und anderen Typ von EinheitEinheit. Diese Gegenstände führen uns zu der Stufe der notwendigen Einheit. […] Mit ihr ist der Höhepunkt innerer Konsistenz, das polare Gegenstück zu einer bloss von aussen zusammengehaltenen Einheit erreicht. […] Sie ist nicht das SoseinSosein der ErscheinungErscheinung, die blosse äussere Erscheinungseinheit, sondern das konstitutive WesenWesen dieses Gegenstandes selbst. […] Sehen wir ein, dass die geistige Person kein räumlich ausgedehntes Sein besitzt oder dass sie allein Träger sittlicher WerteWerte sein kann, dann haben wir das konstitutive Sosein der Person selbst vor uns, das uns als notwendige Einheit unmittelbar anschaulich zugänglich ist.3
Nur Gegenstände dieser Art von EinheitEinheit sind apriorischer ErkenntnisErkenntnis zugänglich. Nur bei den wesensnotwendigen EinheitenEinheitenchaotische, zufällige, morphische, bei denen man, wie Adolf ReinachReinachAdolf es nannte, ein „So-Sein-Müssen und dem WesenWesen nach Nicht-Anders-Sein-Können“4 vorfindet, ist es möglich, zu absolut gewissen Erkenntnissen zu gelangen. Dabei bezieht sich die NotwendigkeitNotwendigkeitsubjektive, auf die sich auch HusserlHusserlEdmund mit seinem WortWort des „Nicht-anders-sein-könnens“5 bezog, auf den Gegenstand selbst und sein Verhalten zu sich selbst oder zu anderem. Dieses Verhalten der Sache (des Sachverhalts) selbst ist es, das in gewissen Fällen so sein muss und nicht anders sein kann. Das Merkmal der IntelligibilitätIntelligibilität (Verstehbarkeit), das eng mit der inneren NotwendigkeitNotwendigkeitsubjektive des Sachverhalts verbunden ist, bezieht sich sodann auf das Verhältnis zwischen dem SachverhaltSachverhalt und der Erkenntnis von ihm. Doch ist dieses Merkmal nicht mehr alleine auf den Sachverhalt beschränkt, wie die NotwendigkeitNotwendigkeitsubjektive, sondern dieses Merkmal besteht im VerstehenVerstehen: Man versteht nicht nur, dass etwas so ist, wie es ist, sondern man versteht auch, warum es so ist. Nur bei den notwendigen Sachverhalten kann von einer EinsichtEinsicht im Vollsinn des Wortes gesprochen werden. Mit einem Beispiel: Moralische WerteWerte – z.B. der Verzicht oder das VerzeihenVerzeihen – setzen eine PersonPerson voraus. Dieser Sachverhalt wird nicht von aussen her verstanden, wie im Falle eines Naturgesetzes, sondern der Sachverhalt wird „von innen her“6 verstanden. Auch das dritte und letzte Merkmal des apriorischen Erkennens, nämlich die absolute GewissheitGewissheit, ist verständlicherweise kein Merkmal des Sachverhalts selbst, sondern eines der Beziehung zwischen dem Sachverhalt und seiner Erkenntnis. Jedenfalls kann auf der Basis der Epistemologie von Hildebrands verstanden werden, warum Husserls Einklammerungsthese nicht zielführend war: Weil er den Blick auf das SoseinSosein mit Einklammerung der ExistenzExistenz bei allen Seienden versuchte, absolut gewisse Erkenntnisse aber nur bei jenen Sachverhalten erlangt werden können, die in notwendigen EinheitenEinheitenchaotische, zufällige, morphische gründen.7
Von HildebrandHildebrandDietrich von, so viel kann im Anschluss an die Unterscheidungen attestiert werden, die hier ihren evidentesten Wesenszügen nach kurz umrissen wurden, hat einen originellen Beitrag zur philosophischen Erkenntnislehre geleistet. Sein ZielZiel, wie weiter oben bereits erwähnt, war die Herausarbeitung des wahren Wesens philosophischer ErkenntnisErkenntnis, ihrer existentiellen Lebendigkeit und des wahren Gegenstands der Philosophie. Dies gelang ihm in erster Linie mit der Herausarbeitung der Merkmale synthetischsynthetisch-apriorischen Erkennens, welche sind: NotwendigkeitNotwendigkeitsubjektive, IntelligibilitätIntelligibilität und absolute GewissheitGewissheit. Dann aber auch mit der expliziten Bezeichnung des Möglichkeitsgrundes der Erlangung solcher Erkenntnisse durch die Unterscheidung zwischen drei grundsätzlich verschiedenen Arten der EinheitEinheit, welche entweder zufällig oder morphisch oder wesensnotwendig sind. Das objektive Korrelat des philosophischen Erkennens ist dabei immer ein SachverhaltSachverhalt, der in einer wesensnotwendigen Einheit gründet.
8 Stand der Forschung
Was den ForschungsstandForschungsstand betrifft, so sind über das Werk von Hildebrands in punkto PhänomenologiePhänomenologie, ErkenntnistheorieErkenntnistheorie, EthikEthik im Allgemeinen und WertethikWertethik im Speziellen, Sozialphilosophie oder Philosophie der LiebeLiebe zahlreiche Forschungsarbeiten vorhanden – um hier nur einige der behandelten Themen zu nennen –, währenddem die ReligionsphilosophieReligionsphilosophie zu den Themen zählt, über die noch keine umfassende Studien vorhanden sind. Auch wenn in Rechnung gestellt wird, dass von Hildebrands Religionsphilosophie noch grösstenteils unveröffentlicht im Nachlass ruht,1 kann dennoch nicht in Abrede gestellt werden, dass trotz den Teilen, die nicht publiziert wurden, wesentliche Beiträge in den publizierten Werken enthalten sind, so dass genug einschlägige Quellen zur Verfügung stehen würden, um von Hildebrands Denken auch in dieser Hinsicht zu bedenken und zu entfalten. Da dies jedoch nur sporadisch geschehen ist, besteht bezüglich der Religionsphilosophie bei Dietrich von HildebrandHildebrandDietrich von offensichtlich eine ForschungslückeForschungslücke.
Wohl finden sich gewisse Arbeiten und Beiträge, wie z.B. Jacques-Albert CuttatCuttatJacques-Albert’s „Technique“ of spiritualization and transformation in Christ (1960), worin ihm der Vergleich zwischen einer kausalen Technik wie dem indischen Yoga und einer interpersonalen, christlichen MethodeMethode der Annäherung an das bzw. den Absolute(n) als Folie dient, um die notwendigen Elemente der Umgestaltung herauszuarbeiten. Da er sich aufgrund des beschränkten Rahmens seines Artikels auf die formalen und materialen Voraussetzungen der similitudo Dei konzentrierte, konnten viele Themen zwangsläufig nicht hinreichend untersucht werden.
Dem half Alice von HildebrandHildebrandDietrich vonAlice von (1923-) in ihrer Introduction to a Philosophy of ReligionReligion (1971) – zu der Dietrich von HildebrandHildebrandDietrich von im Übrigen ein kurzes Vorwort beisteuerte – insofern ab, als sie mit einer Analyse des Wesens der Religion aufzuzeigen vermochte, dass dieses WesenWesen eine IntelligibilitätIntelligibilität besitzt, die es philosophischer EinsichtEinsicht zugänglich macht. Wenngleich dieser Schrift nicht explizit zu entnehmen ist, inwieweit ihr Ehemann Dietrich von HildebrandHildebrandDietrich von bei der Erstellung beteiligt war, so wird sein Einfluss doch sozusagen zwischen den Zeilen ersichtlich. Wobei allemal sicher ist, dass Dietrich von HildebrandHildebrandDietrich von nicht das Forschungsobjekt dieser Studie war und das primäre Interesse nicht der ReligionsphilosophieReligionsphilosophie bei Dietrich von HildebrandHildebrandDietrich von, sondern der Analyse des Wesens der Religion an sich galt. Wie Alice von HildebrandHildebrandDietrich von dem Verfasser dieser Zeilen in einem persönlichen Briefwechsel zur Kenntnis brachte, hatte sie nie das GlückGlück, den religionsphilosophischen Vorlesungen ihres Ehemannes beizuwohnen. Auch habe er selbst nie ein einschlägiges Buch über das Thema der Religionsphilosophie geschrieben. Immerhin habe sie einige kurze Notizen von Personen erhalten, die seine Vorlesungen über die Philosophie der Religion gehört hätten. Was schliesslich den Einfluss betrifft, den Dietrich von HildebrandHildebrandDietrich von bei der Entstehung ihrer Introduction to a Philosophy of Religion ausübte, so sei das Herz dieser Schrift mit Sicherheit durch die achtzehn Vorlesungen geformt worden, die sie bei ihm gehört habe. Doch bestünden nichtsdestotrotz Unterschiede in der Darstellung. Zudem habe sie einige historische Quellen verwendet, die sie in den Mitschriften der Vorlesungen ihres Ehemannes über die Philosophie der Religion nicht gefunden habe.
Bedeutende Beiträge zur ReligionsphilosophieReligionsphilosophie bei Dietrich von HildebrandHildebrandDietrich von lieferte Josef SeifertSeifertJosef mit seiner Besprechung der Bedeutung der WertantwortWertantwort für die ReligionReligion und die Religionsphilosophie im 5. Kapitel seines Artikels Dietrich von Hildebrands philosophische Entdeckung der ‚Wertantwort‘ und die Grundlegung der EthikEthik (1992). Phänomenologisch wusste er die philosophische Erkennbarkeit Gottes sodann in seiner Schrift GottGott als GottesbeweisGottesbeweis (2000) neu zu begründen. Zu erwähnen bleibt schliesslich noch die Studie von Alessandro BiagettiBiagettiAlessandro, Religio del cuore e trasformazione in Cristo (2011), in der ebenso wie bei CuttatCuttatJacques-Albert die Umgestaltung in Christus im ZentrumZentrum steht. Spezielle Beachtung fand das Herz als des innersten Kerns der PersonPerson und als des eigentlichen Gegenübers Gottes im Dialog der Religion. Dabei war es ihm vor allem um den Nachweis zu tun, dass von HildebrandHildebrandDietrich von mit der Umgestaltung nicht einen asketischen oder mystischen, sondern einen moralischen Weg skizzierte.
Doch im Grossen und Ganzen ist es um den ForschungsstandForschungsstand in Bezug auf die ReligionsphilosophieReligionsphilosophie bei Dietrich von HildebrandHildebrandDietrich von schlecht bestellt. Was sich etwa an der fehlenden Auseinandersetzung mit der Erkennbarkeit des Wesens Gottes vor dem Hintergrund der ErkenntnistheorieErkenntnistheorie von Hildebrands und dem fehlenden Vergleich mit dem Zugang anderer Philosophen zeigt. Ausstehend ist auch eine unterscheidende Inblicknahme der gegenwärtig gleichsam in der Luft liegenden Kritiken an der ReligionReligion im Lichte der philosophischen Beiträge von Hildebrands. Zur Behebung dieser und weiterer Mängel will die vorliegende Untersuchung einen Beitrag leisten. Aufgrund des Fehlens umfassender oder auch nur einer gewissen Anzahl an Studien zur Religionsphilosophie bei Dietrich von HildebrandHildebrandDietrich von, ist das Forschen in dieser Untersuchung grösstenteils auf die Beschäftigung mit den Quellen verwiesen.
9 Zusammenfassung
Durch den mit Francis BaconBaconFrancis anhebenden Paradigmenwechsel von einem Selbstzweck des Wissens zu einem Mittel zum ZweckZweck, und zwar einem Zweck, der in der Beherrschung der quantifizierbaren NaturNatur liegt, geriet die menschliche ExistenzExistenz in eine Schieflage. Im Rahmen einer immanenten WeltanschauungWeltanschauung und einer wissenschaftlichen MethodeMethode, in der der MenschMensch auf ein Konglomerat von berechenbaren Teilen reduziert wurde, gerieten viele Menschen in eine LebenskriseLebenskrise. Nachfolgend hat sich in empirischen Studien wiederholt gezeigt, dass das eigene Dasein häufig als sinnlossinnlos empfunden wird. Beim Versuch, dieses existentielle Problem zu lösen, sind sowohl HusserlHusserlEdmund als auch MaslowMaslowAbraham und vor allem FranklFranklViktor E. darauf aufmerksam geworden, dass die immanentistische Grenze durch die TranszendenzTranszendenz des eigenen Selbst überstiegen werden muss. Nur auf diesem Wege kann der Mensch zu sich selber finden, denn „die Transzendenz ihrer selbst ist die Essenz menschlicher Existenz“1. Was PlatonPlaton schon wusste, das hat der moderne Mensch zumindest theoretisch verstanden. Praktisch ist er aufgerufen, die Grenze des eigenen Selbst immer wieder oder sogar bleibend zu übersteigen, was sich durch die Hingabe an eine andere PersonPerson ebenso realisiert wie durch die Hingabe an eine Aufgabe.
Dies alles ist und bleibt jedoch relativ auf bestimmte Menschen oder Aufgaben. Absolut dagegen ist das transzendente Gegenüber der ReligionReligion. MaslowMaslowAbraham hatte bereits behauptet, dass die Religion den Menschen zum grösstmöglichen Wachstum motiviere und seine gleichgearteten Bedürfnisse zu befriedigen vermöge. Wie es darum bestellt ist, d.h. ob der MenschMensch den Bereich der ImmanenzImmanenz zu transzendieren und mit GottGott in einen beglückenden und sinnstiftenden Dialog zu treten vermag, wird im Rahmen dieser Arbeit unter Zugrundelegung der Beiträge Dietrich von Hildebrands untersucht. Neben bzw. von HildebrandHildebrandDietrich von in einem gewissen Sinne vorgeordnet wird die Untersuchung auf AugustinusAugustinus’ Lehre von der Dreieinheit des menschlichen Geistes als Grundlage der Religion im Menschen sowie auf Newmans DefinitioDefinitionn der ReligionsphilosophieReligionsphilosophie als erfahrungsgestütztem Aufweis der (Un-)Vernünftigkeit religiöser Überzeugungen basieren.
Methodisch leitet diese Arbeit die Realistische PhänomenologiePhänomenologie, wie sie oben in ihren grundlegenden Zügen dargestellt wurde.2 Weitere notwendige Elemente dieser MethodeMethode, die die ErkenntnistheorieErkenntnistheorie zwar voraussetzen, sie in gewissem Sinne aber übersteigen, werden mit der WertethikWertethik im III. Abschnitt erörtert.3
I DAS WISSEN UM DAS TRANSZENDENTE
Bezugspunkt der ReligionReligion ist das Transzendente. Doch kann der MenschMensch überhaupt wissen, wie es um das Transzendente bestellt ist, sind seine Wissensmöglichkeiten nicht auf den immanenten Bereich des sinnlich Erfahrbaren beschränkt? Die religiösen Aussagen und Überzeugungen können jedenfalls nur unter der Bedingung als vernünftig erwiesen und gerechtfertigt werden, dass metaphysische Erkenntnissemetaphysische Erkenntnisse erlangt werden können und das Transzendente ein Objekt des Wissens sein kann. Immanuel KantKantImmanuel verneinte das Bestehen der Möglichkeit, Erkenntnisse über Objekte zu erlangen, die den Bereich des sinnlich Erfahrbaren übersteigen. Seine Behauptung sei in der Folge mitsamt den von ihm angeführten Begründungen auseinandergelegt. Was in diesem Rahmen vor allem deswegen unternommen wird, weil von Hildebrands ErkenntnistheorieErkenntnistheorie in ihren wesentlichen Stücken als AntwortAntworttheoretische auf Kants Position zu verstehen ist. KantKantImmanuel bereitete den sachlichen und terminologischen Boden, auf dem von HildebrandHildebrandDietrich von seine eigene Erkenntnistheorie entwickelte.
1 Immanuel KantKantImmanuel und der Schritt von der TranszendenzTranszendenz zum transzendentalen ImmanentismusImmanentismus
In seiner vorkritischen Periode – bis etwa 1769/1770 – ging Immanuel KantKantImmanuel (1724–1804) von der Möglichkeit eines vernunftgemässen Überstiegs der Grenze aus, die die Bereiche der ImmanenzImmanenz und der TranszendenzTranszendenz voneinander trennt. In seiner kritischen Periode, d.h. ab der Kritik der reinen VernunftVernunft (1. Aufl. 1781) und dann auch den Prolegomena zu einer jeden künftigen MetaphysikMetaphysik, die als WissenschaftWissenschaft wird auftreten können (1783), welche er als Nachschrift zu seiner kritischen Hauptschrift konzipierte, verfolgt er das vielsagende ZielZiel der Sicherung der Grundlagen und Grenzen der menschlichen Vernunft. Wie er dieses Projekt versteht, wird sich im Verlauf der folgenden Seiten erweisen.
1.1 Humes Kritik am KausalprinzipKausalprinzip und Kants kopernikanische Wendekopernikanische Wende
Den Anlass zu einer neuen und spezifisch kritischen Grundlegung der Erkenntnismöglichkeiten des menschlichen Geistes gab die Kritik David HumesHumeDavid (1711–1776) an der Verknüpfung der UrsacheUrsache-WirkungWirkung-Relation. Entgegen der Annahme der bisherigen MetaphysikMetaphysik (μετά τά φύσικα – philosophische Disziplin, die das Hinter-der-Grenze-Liegende behandelt), die mit ihrem KausalprinzipKausalprinzip immer angenommen hatte, dass eine NotwendigkeitNotwendigkeitsubjektive der Verknüpfung einzusehen sei, vertrat HumeHumeDavid die Auffassung, a prioria priori, d.h. rein aus dem BegriffBegriff einer bestimmten Ursache, könne die zugehörige Wirkung nicht abgeleitet werden, weil die Dinge grundsätzlich zusammenhanglos nebeneinander lägen.1 Die Beziehungen, die man zwischen einzelnen Seienden auszumachen vermeine, seien blosse AssoziationenAssoziationen.2
Wenn sich uns ein Gegenstand oder Ereignis in der NaturNatur darbietet, so ist es uns ohne Erfahrung unmöglich, mit noch so eindringlichem Scharfsinn zu entdecken, ja auch nur zu erdenken, was für ein Ereignis aus ihm folgen wird, oder mit unserer Voraussicht über den Gegenstand hinauszugelangen, der unmittelbar dem GedächtnisGedächtnis oder den Sinnen vorliegt. Selbst wenn ein Beispiel oder eine Erfahrungstatsache uns beobachten liess, dass ein bestimmtes Ereignis einem anderen folgte, so sind wir nicht berechtigt, eine allgemeine Regel zu bilden oder vorauszusagen, was in gleichen Fällen eintreten wird; denn mit Recht gilt es als unverzeihlicher Vorwitz, aus einer einzelnen, auch noch so genauen und gewissen Erfahrungstatsache, ein UrteilUrteil über den gesamten Naturverlauf abzugeben.3
Diese Infragestellung des Kausalprinzips hatte die Potenz, Kants „dogmatischen Schlummer“ zu unterbrechen.4 Ist das Band an den Dingen selbst zu sehen, in der unmittelbaren Wahrnehmung, oder kann die Verknüpfung deduziert werden? Wenn nicht, woher stammt die Verknüpfung? KantKantImmanuel ging mit HumeHumeDavid insoweit einig, als die Erfahrung keine NotwendigkeitNotwendigkeitsubjektive habe, doch an der NotwendigkeitNotwendigkeitsubjektive des Kausalsatzes hielt er unabrückbar fest. Wenn der Kausalsatz aber notwendig ist und dabei nicht aus der Erfahrung stammen kann, dann muss für ihn wie auch für die anderen Erfahrungssätze nach einem NotwendigkeitsgrundNotwendigkeitsgrund gesucht werden. Bei dieser Suche – bei der er sich auch an Francis BaconBaconFrancis orientierte5 – nimmt er Mass an Nikolaus KopernikusKopernikusNikolaus (1473–1543), „der, nachdem es mit der Erklärung der Himmelsbewegungen nicht gut fort wollte, wenn er annahm, das ganze Sternenheer drehe sich um den Zuschauer, versuchte, ob es nicht besser gelingen möchte, wenn er den Zuschauer sich drehen, und dagegen die Sterne in Ruhe liess“6. Auch in der MetaphysikMetaphysik könne es auf dieselbe Weise versucht werden:
Wenn die Anschauung sich nach der Beschaffenheit der Gegenstände richten müsste, so sehe ich nicht ein, wie man a prioria priori von ihr etwas wissen könne; richtet sich aber der Gegenstand (als Objekt der Sinne) nach der Beschaffenheit unseres Anschauungsvermögens, so kann ich mir diese Möglichkeit ganz wohl vorstellen.7
Auf diese Weise sucht KantKantImmanuel nachzuweisen, dass die Gegenstände der ErkenntnisErkenntnis sich nach den Menschen richten, und nicht umgekehrt. Folglich ist bei der „Entdeckung“ einer NotwendigkeitNotwendigkeitsubjektive in der Erfahrung davon auszugehen, dass der VerstandVerstand diese in das Objekt hinein gelegt hat. Doch da das philosophische ErkennenErkennen ein Erkennen a prioria priori sein muss – „denn sie soll nicht physische, sondern metaphysische, d.i. jenseits der Erfahrung liegende Erkenntnis sein“8 – bleibt die Frage: „wie kann Anschauung des Gegenstandes vor dem Gegenstande selbst vorhergehen?“9 Das ist nur auf eine einzige Art möglich, „wenn sie nämlich nichts anderes enthält, als die FormForm der Sinnlichkeit, die in meinem SubjektSubjekt vor allen wirklichen Eindrücken vorhergeht, dadurch ich von den Gegenständen affiziert werde“10. Für KantKantImmanuel ist es allein die Form der sinnlichen Anschauung, wodurch Dinge a priori angeschaut werden können. Woraus aber notwendigerweise folgt, dass die MaterieMaterie der Erkenntnis nur so erkannt wird, wie sie den Sinnen erscheint, jedoch nicht, wie sie an sich ist.
Es wäre jedoch ein Missverständnis, anzunehmen, KantKantImmanuel sei einzig darum bemüht gewesen, den EmpirismusEmpirismus zu überwinden. Um sein Motiv zu verstehen, muss man sich klar machen, in welcher Situation sich die Philosophie zu seiner Zeit befand. „In der Gigantomachie der Frühphase der Neueren Philosophie scheiden sich die Geister über der Frage, wie das Besondere der philosophischen ErkenntnisErkenntnis […] zu begründen sei.“11 Nicht nur die Position des Empirismus stand damals zur Debatte, es gab auch einen Kontrahenten, den RationalismusRationalismus. Dessen Anfang sieht man gemeinhin mit DescartesDescartesRené gegeben, dem es einzig um das lobenswerte ZielZiel der Klarheit und Deutlichkeit als Selbstausweis der Philosophie ging. Nichtsdestotrotz fanden sich bei ihm drei Unzulänglichkeiten, die als Grundlegung einer rationalistischen Position verstanden wurden: „Seine Rede von den ‚eingeborenen IdeenIdeen‘, sein damit zusammenhängendes Verkennen der Rolle der Erfahrung […] und sein AxiomAxiom von der Unmöglichkeit der WechselwirkungWechselwirkung zwischen Ausgedehntem und Geistigem, bzw. Personalem.“12
So entwickelte sich im 16. und 17. Jahrhundert ein Streit zwischen Empiristen und Rationalisten, in dessen Endstadium „die Rationalisten nichts anderes zu tun [wissen], als ihre zu Begriffen gewordenen IdeenIdeen aufeinander zu beziehen, auseinander zu entwickeln, durcheinander zu begründen“, währenddem die Empiristen „mit ihrer TheseThese, dass wir nichts eigentlich wirklich ‚haben‘ als unsere Sinneseindrücke“, in einen ähnlichen ImmanentismusImmanentismus fielen.13 Für beide Parteien wird die TranszendenzTranszendenz im Sinne der Beziehung zur wirklichen Welt zu einem blossen, unbeweisbaren Postulat.
Diesem Gegensatz von RationalismusRationalismus und EmpirismusEmpirismus stand KantKantImmanuel gegenüber. Es war seine Absicht, sowohl das inhaltliche AprioriApriori zu retten als auch Humes Prinzip zu akzeptieren, demzufolge nur die Erfahrung Erkenntnissen Gültigkeit verschaffen kann. So steht KantKantImmanuel am Ausgangspunkt, an dem er überlegt, wie es angegangen werden soll, gegenüber dem Rationalismus den Erfahrungserkenntnissen ins Recht zu verhelfen und gleichzeitig den Empirismus mit apodiktischen, jenseits der sinnlichen Erfahrung liegenden Erkenntnissen zu harmonisieren. KantKantImmanuel vermeint das „Bindeglied“ entdeckt zu haben, anhand dessen die polaren Auffassungen vereinbart werden können. Worin diese kantische Lösung genauerhin besteht, wird sich zeigen, wenn im Folgenden seine erkenntnistheoretischen und logischen Prinzipien in der hier relevanten Hinsicht analysiert werden.