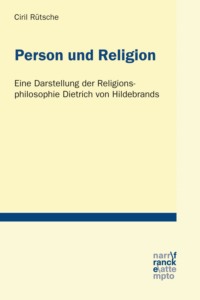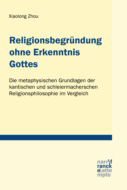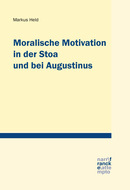Kitabı oku: «Person und Religion», sayfa 6
1.2 Von den Unterschieden zwischen analytischen und synthetischen Urteilen und Erkenntnissen a prioria priori und a posterioria posteriori
Allein Urteile mögen nun einen Ursprung haben, welchen sie wollen, oder auch, ihrer logischen FormForm nach, beschaffen sein, wie sie wollen, so gibt es doch einen Unterschied derselben, dem Inhalte nach, vermöge dessen sie entweder bloss erläuternd sind, und zum Inhalte der ErkenntnisErkenntnis nichts hinzutun, oder erweiternd, und die gegebene Erkenntnis vergrössern; die ersten werden analytische, die zweiten synthetische Urteile genannt werden können.1
Diesen Unterschied zwischen tautologischen und nichttautologischen Urteilen erkannt zu haben, darf zweifelsohne als echte EinsichtEinsicht Kants gelobt werden. Tautologische Urteile, also blosse Erläuterungsurteile, die lediglich das im Subjektbegriff bereits implizit enthaltene PrädikatPrädikat aussagen, werden von KantKantImmanuel als analytische Urteile bezeichnet. Solche Urteile sind zwar notwendig und allgemeingültig, aber sie sind nur eine erläuternde Begriffsanalyse und bedeuten keine Erweiterung des Wissens. Sie sagen nur aus, was im Subjektbegriff schon gesetzt war. Wenn jemand sagt: „Jeder Sohn stammt von Eltern ab“, so ist im Prädikat „von Eltern abstammen“ nur etwas wiederholt, das bereits im Subjektbegriff „jeder Sohn“ enthalten war.
Synthetische Urteile dagegen sind solcherart, dass im Subjektbegriff noch nichts vom Prädikatbegriff enthalten ist, bei denen durch Hinzufügung des Prädikatbegriffs der Subjektbegriff erweitert wird. Das KausalprinzipKausalprinzip, „jede Veränderung und jedes nicht-notwendige Sein bedürfen einer Wirkursache“, ist in Kants Terminologie synthetischsynthetisch. Denn das PrädikatPrädikat dieses Satzes, „einer UrsacheUrsache bedürfen“, fügt dem SubjektSubjekt, „jede Veränderung und jedes kontingente Seiende“, etwas Neues hinzu. Ebenso ist der SatzSatz „7 + 5 = 12“ nicht bloss analytischanalytisch, sondern synthetisch.2
Der BegriffBegriff von Zwölf ist keineswegs dadurch schon gedacht, dass ich mir bloss jene Vereinigung von Sieben und Fünf denke, und, ich mag meinen Begriff von einer solchen möglichen Summe noch so lange zergliedern, so werde ich doch darin die Zwölf nicht antreffen. […] Man erweitert also wirklich seinen Begriff durch diesen SatzSatz 7 + 5 = 12 und tut zu dem ersteren Begriff einen neuen hinzu, der in jenem gar nicht gedacht war, d.i. der arithmetische Satz ist jederzeit synthetischsynthetisch.3
A priori-Erkenntnisse sind für KantKantImmanuel durch „apodiktische GewissheitGewissheit“4, „NotwendigkeitNotwendigkeitsubjektive und strenge Allgemeinheit“5 charakterisiert. Es sind solche Erkenntnisse, die der Erfahrung vorangehen, von ihr unabhängig sind, die nicht auf ihr beruhen, ebenso nicht von ihr abstrahiert sind, die generell nicht aus ihr stammen, sondern von ihr unabhängig gewonnen werden. Solcherart sind sämtliche analytischen Sätze. Denn die Ausfaltung des im Subjektbegriff bereits implizit Enthaltenen wird sowohl unabhängig von der Erfahrung gewonnen als es sich auch durch strenge NotwendigkeitNotwendigkeitsubjektive und apodiktische Gewissheit auszeichnet. Davon unterscheiden sich die empirischen Erkenntnisse, die ihre Quellen a posterioria posteriori, nämlich in der Erfahrung haben. Sämtliche Urteile, die als objektives Korrelat einen durch a posteriori-ErkenntnisErkenntnis gewonnenen SachverhaltSachverhalt haben, sind synthetischer NaturNatur. Die Frage jedoch, die KantKantImmanuel vor allem beschäftigte, galt nicht den synthetischsynthetisch aposteriorischen, sondern den synthetisch apriorischen Urteilen.
1.3 Was also versteht KantKantImmanuel unter „synthetischen Urteilen a prioria priori“, und wie steht es mit der Möglichkeit derselben?
Unter einem synthetischen UrteilUrteil a prioria priori versteht KantKantImmanuel ein Urteil, das über einen gegebenen BegriffBegriff hinausgeht und einen anderen damit verknüpfen kann, der in jenem nicht enthalten ist, und zwar so, als wenn dieser notwendig zu jenem gehöre.1 Doch „wie ist es nun der menschlichen VernunftVernunft möglich, eine solche ErkenntnisErkenntnis gänzlich a priori zu Stande zu bringen?“, fragt KantKantImmanuel und fährt mit einer weiteren Frage fort:
Setzt dieses Vermögen [apodiktischapodiktisch gewisser Erkenntnisse], da es nicht auf Erfahrungen fusst, noch fussen kann, nicht irgend einen Erkenntnisgrund a prioria priori voraus, der tief verborgen liegt, der sich aber durch diese seine Wirkungen offenbaren dürfte, wenn man den ersten Anfängen derselben nur fleissig nachspürte?2
Diese ersten Anfänge vermeint KantKantImmanuel in den reinen Anschauungen gefunden zu haben. Doch: „Wie ist es möglich, etwas a prioria priori anzuschauen?“3 Oder anders formuliert: „Allein wie kann Anschauung des Gegenstandes vor dem Gegenstande selbst vorhergehen?“4
Es ist […] nur auf eine einzige Art möglich, dass meine Anschauung vor der WirklichkeitWirklichkeit des Gegenstandes vorhergehe, und als ErkenntnisErkenntnis a prioria priori stattfinde, wenn sie nämlich nichts anderes enthält, als die FormForm der Sinnlichkeit, die in meinem SubjektSubjekt vor allen wirklichen Eindrücken vorhergeht, dadurch ich von den Gegenständen affiziert werde.5
Damit ist die eigentliche kopernikanische Wendekopernikanische Wende vollzogen. D. h. der Versuch, nachzuweisen, dass die Gegenstände der ErkenntnisErkenntnis sich nach den Menschen richten müssen, und nicht umgekehrt. Folglich, wie bereits erwähnt, muss bei „Entdeckung“ einer NotwendigkeitNotwendigkeitsubjektive in der sinnlichen Anschauung geschlossen werden, dass der VerstandVerstand diese in das Objekt hinein gelegt hat. Woraus aber notwendigerweise folgt, dass die MaterieMaterie der Erkenntnis nur so erkannt wird, wie sie den Sinnen erscheint, jedoch nicht, wie sie an sich ist. Reine Formen der sinnlichen Anschauung sind ihm letzten Endes nur diejenigen von Raum und Zeit. Gelangen die aus der Sinneserfahrung gewonnenen Daten anschliessend in den Verstand, werden sie – spontan – kategorisiert. KantKantImmanuel unterscheidet zwölf logische Kategorien, denen er zuerkennt, „dass sie und die Grundsätze aus denselben a prioria priori vor aller Erfahrung fest stehen“6. Was den Sinnen die Anschauungsformen von Raum und Zeit, was dem Verstand die logischen Kategorien, das sind der VernunftVernunft schliesslich die IdeenIdeen. Mit dem Unterschied, dass die Ideen nicht a priori erkannt werden können, ja überhaupt nur eine Folge des falschen Gebrauchs der Vernunft seien, da man für konstitutivkonstitutiv halte, was in WirklichkeitWirklichkeit bloss regulativregulativ sei.7 „Konstitutiv“ versteht KantKantImmanuel dabei im realistischen, von ihm allerdings zurückgewiesenen Sinne, demgemäss die Erkenntnis der Ideen das WissenWissen auf transzendente Weise erweitert, während er „regulativ“ als dazu dienend versteht, die Erfahrung „durch nichts einzuschränken, was zur Erfahrung nicht gehören kann“.8
Vor diesem Hintergrund macht KantKantImmanuel die Wissenschaftlichkeit der MetaphysikMetaphysik bzw. der Philosophie abhängig von der BegründungBegründung der Möglichkeit synthetischer Erkenntnisse a prioria priori,9 d.h. von Erkenntnissen, die sich durch „apodiktische GewissheitGewissheit“10, „NotwendigkeitNotwendigkeitsubjektive und strenge Allgemeinheit“11 auszeichnen. Die dabei aber nicht analytischanalytisch sind, das in einem gegebenen BegriffBegriff implizit Enthaltene also nicht bloss erläutern, sondern einen anderen Begriff, der in jenem nicht enthalten ist, als notwendig zu jenem gehörig erfassen,12 deren Quellen dabei aber nicht empirisch, sondern apriorisch sind, also jenseits der Erfahrung liegen, der inneren ebenso wie der äusseren.13 Darin enthalten ist die Unterscheidung zwischen einem immanenten und einem transzendenten Wirklichkeitsbereich: zwischen einem Bereich möglicher Erfahrung und einem solchen, der den Bereich möglicher Erfahrung überschreitet.14 In Verbindung mit seiner Erkenntnisdefinition, dergemäss die Anschauung und die Begriffe die Elemente einer jeden ErkenntnisErkenntnis ausmachen,15 vermag er die Möglichkeit synthetischer Erkenntnisse a prioriSynthetische Erkenntnisse a priori für den immanenten Bereich – mit den genannten Anschauungsformen und Kategorien16 – zu begründen, verneint ihre Begründbarkeit aber hinsichtlich des transzendenten Bereichs. Denn wenn die Anschauung und die Begriffe die Elemente einer jeden Erkenntnis ausmachen, es im transzendenten Bereich jedoch keine sinnlichen Anschauungen mehr gibt – die Anschauungen des Menschen sind jederzeit sinnlich17 –, sind die jeweiligen Vernunftbegriffe oder IdeenIdeen blosse Gedankendinge oder Hirngespinste.18
Zweifelsohne darf es angesichts des damaligen Zustands der Philosophie als ein „Zeichen der Grösse Kants“ bezeichnet werden, „dass er die innere Ordnung der Probleme mit Klarheit erkannte“ und „die Frage der Tatsächlichkeit der Wesenserkenntnis von der ihrer BegründungBegründung, nämlich der Frage nach den ‚Bedingungen der Möglichkeit‘ solchen Erkennens, mit Eindeutigkeit absetzte“.19 Nur war der Preis, zu dem er die empiristische und die rationalistische Position harmonisierte, viel zu hoch. Er tat dies zum Preis der „Deformierung des Erkenntnisbegriffs“20. „Wenn KantKantImmanuel Recht hat, so ist uns das unserem GeistGeist transzendente WesenWesen der WirklichkeitWirklichkeit radikal unbekannt; wir müssen nur die Dinge immer unter bestimmten allgemeinen Formen begreifen“, wobei wir höchstens noch wissen können, „unter welchen unserem Geist immanenten Anschauungs- und Denkformen wir die Welt betrachten müssen“.21
Wie gesagt, kommt den IdeenIdeen keine konstitutive, sondern eine regulative Bedeutung zu. Mit anderen Worten, die Ideen sind keine Prinzipien, die die Anschauungen zu Begriffen aufbauen, vielmehr richten sie den Verstandesgebrauch auf ein problematisches ZielZiel hin aus. KantKantImmanuel versteht sie als PostulatePostulate der praktischen VernunftVernunft, d.h. als theoretische Annahmen, um sittliche TatsachenTatsachen verstehen zu können. Solche sind ihm namentlich die Ideen von GottGott, von der FreiheitFreiheit und von der UnsterblichkeitUnsterblichkeit.22 Und da er die Ideen nicht für unmittelbar erkennbar hält, trägt er dem BedürfnisBedürfnis nach TranszendenzTranszendenz insoweit Rechnung, als er die reine Vernunft erweitert, allerdings nicht in spekulativer Hinsicht, sondern nur in praktischer Absicht. Wenn er in diesem Sinne etwa sagen kann, dass „es […] moralisch notwendig [sei], das Dasein Gottes anzunehmen“23, so basiert diese Annahme nicht auf WissenWissen, sondern auf Glauben, auf reinem Vernunftglauben. Wie er andernorts sagt, musste er „das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen“24. Zu Glaubenssachen erklärt KantKantImmanuel allerdings nur das Dasein Gottes und die Unsterblichkeit,25 die Freiheit bildet eine Ausnahme, denn sie sei „[d]ie einzige unter allen Ideen der reinen Vernunft, deren Gegenstand Tatsache ist“26. Von da her versteht sich nun auch, wie Kants – oben angesprochene – DefinitionDefinition der ReligionReligion als „ErkenntnisErkenntnis aller unserer Pflichten als göttlicher Gebote“27 zu begreifen ist. Da er die Idee Gottes nicht für erkennbar hält, ist ihm auch die Religion als Ableitung „eines moralischen Gesetzgebers“28 nicht mehr denn „ein reiner praktischer Vernunftbegriff“29, ein Postulat.
Doch ist uns die WirklichkeitWirklichkeit tatsächlich radikal unbekannt? Können wir nur wissen, mit welchen dem GeistGeist immanenten Anschauungs- und Denkformen wir sie betrachten müssen? Doch warum nimmt KantKantImmanuel das ErkennenErkennen eigentlich nicht davon aus? Warum sagt er eindeutig nicht, die von ihm gebotene Erklärung des Erkennens sei eine spontane Setzung, eine KonstruktionKonstruktion? Warum geht er vom klassischen, vom rezeptiven Verständnis des Erkennens aus? Aus keinem anderen Grund, als weil er ebenso inkonsequent ist wie jeder andere SkeptikerSkeptiker auch: Was er leugnet, setzt er im selben Atemzug wieder voraus. Denn wird seine Theorie, dass wir alles konstruieren, konsequent weitergedacht, so gelangt man letztlich an den Punkt des Nichtwissens, ob die Menschen tatsächlich so denken, wie er es behauptet. Die TheseThese, dass die ErkenntnisErkenntnis eine Konstruktion aus einem amorphen Etwas ist, das sinnlich wahrgenommen wird, scheitert auch an der Frage nach dem Was der Sinne. Wie kann man wissen, was Sinne sind, wenn es sich verhält, wie KantKantImmanuel behauptet, wenn die menschliche Konstruktion der Welt ihrer Wahrnehmung tatsächlich vorhergeht? Ja wie kann man überhaupt wissen, dass der amorphe Stoff, der verarbeitet und aus dem die ganze Welt konstruiert wird, durch die Sinne geliefert wird? Wenn KantKantImmanuel Recht hätte, könnte kein MenschMensch ein WissenWissen über andere Menschen erlangen, er käme über die Inhalte seines eigenen Bewusstseins nicht hinaus und müsste diese als das einzig Wirkliche gelten lassen.
Auch Kants DefinitionDefinition der ReligionReligion als eines Postulats ist von da her zu verstehen. Denn wie soll etwa von einem schlechtweg unbekannten GottGott als einer moralischen NotwendigkeitNotwendigkeitsubjektive gesprochen werden? Das sagt doch offensichtlich nur jemand, der Gott erkannt hat, in welchem Mass auch immer. Zumal setzt er in den Sachen der Religion voraus, was er in seinen Kritiken verneint. Der Nachweis der Vernünftigkeit der Religion kann auf der Basis der Kantschen Theorien jedenfalls nicht erbracht werden, ist ihm das Transzendente doch gerade kein Gegenstand des Wissens. Das nachvollziehbare Begründen der Religion als einer lebendigen Verbindung des Menschen mit dem Transzendenten setzt vielmehr eine ErkenntnistheorieErkenntnistheorie voraus, die die reale Möglichkeit des Überstiegs über die Grenzen der ImmanenzImmanenz evident zu machen vermag.
2 Dietrich von Hildebrands Kritik an Kants transzendentalem ImmanentismusImmanentismus und seine BegründungBegründung der TranszendenzTranszendenz in der ErkenntnisErkenntnis
Wie zentral das WissenWissen um das Transzendente den Menschen betrifft, hat nicht erst MaslowMaslowAbraham zur Sprache gebracht, der das TranszendierenTranszendieren zum höchsten BedürfnisBedürfnis des Menschen erklärte. Vor ihm hatte bereits Heinrich von KleistKleistHeinrich von sich in einem Brief – den Friedrich NietzscheNietzscheFriedrich zitiert – zu den existentiellen Folgen der Kantschen Skepsis geäussert.
Verzweiflung an der WahrheitWahrheit. Diese Gefahr begleitet jeden Denker, welcher von der Kantischen Philosophie aus seinen Weg nimmt, vorausgesetzt, daß er ein kräftiger und ganzer MenschMensch in Leiden und Begehren sei und nicht nur eine klappernde Denk- und Rechenmaschine. Nun wissen wir aber alle recht wohl, was es gerade mit dieser Voraussetzung für eine beschämende Bewandtnis hat, ja es scheint mir, als ob überhaupt nur bei den wenigsten Menschen KantKantImmanuel lebendig eingegriffen und Blut und Säfte umgestaltet habe. Zwar soll, wie man überall lesen kann, seit der Tat dieses stillen Gelehrten auf allen geistigen Gebieten eine Revolution ausgebrochen sein; aber ich kann es nicht glauben. Denn ich sehe es den Menschen nicht deutlich an, als welche vor allem selbst revolutioniert sein müssten, bevor irgendwelche ganze Gebiete es sein könnten. Sobald aber KantKantImmanuel anfangen sollte, eine populäre WirkungWirkung auszuüben, so werden wir diese in der FormForm eines zernagenden und zerbröckelnden SkeptizismusSkeptizismus und RelativismusRelativismus gewahr werden; und nur bei den tätigsten und edelsten Geistern, die es niemals im ZweifelZweifel ausgehalten haben, würde an seiner Stelle jene Erschütterung und Verzweiflung an aller Wahrheit eintreten, wie sie z.B. Heinrich von KleistKleistHeinrich von als Wirkung der Kantischen Philosophie erlebte. ‚Vor kurzem‘, schreibt er einmal in seiner ergreifenden Art, ‚wurde ich mit der Kantischen Philosophie bekannt – und dir muß ich jetzt daraus einen Gedanken mitteilen, indem ich nicht fürchten darf, dass er dich so tief, so schmerzhaft erschüttern wird als mich. – Wir können nicht entscheiden, ob das, was wir Wahrheit nennen, wahrhaft Wahrheit ist oder ob es uns nur so scheint. Ist’s das Letztere, so ist die Wahrheit, die wir hier sammeln, nach dem Tode nichts mehr, und alles Bestreben ein Eigentum zu erwerben, das uns auch noch in das Grab folgt, ist vergeblich. – Wenn die Spitze dieses Gedankens dein Herz nicht trifft, so lächle nicht über einen andern, der sich tief in seinem heiligsten Innern davon verwundet fühlt. Mein einziges, mein höchstes ZielZiel ist gesunken, und ich habe keines mehr.‘ Ja, wann werden die Menschen wieder dergestalt Kleistisch-natürlich empfinden, wann lernen sie den SinnSinn einer Philosophie erst wieder an ihrem ‚heiligsten Innern‘ messen?1
NietzscheNietzscheFriedrich bezieht sich hier auf die populären Auswirkungen der Kantschen Philosophie: den zernagenden und zerbröckelnden SkeptizismusSkeptizismus und RelativismusRelativismus. Ihre Fortführung fanden sie in dem eingangs erwähnten BedürfnisBedürfnis nach TranszendenzTranszendenz sowie dem daraus resultierenden GefühlGefühl der SinnlosigkeitSinnlosigkeit.2 Auch von HildebrandHildebrandDietrich von spricht in einem Artikel aus den Jahren 1934/35 – Die Stellung der Wahrheitserkenntnis im Leben der Menschen – von den „tiefgehendsten Zersetzungserscheinungen“, die „die völlige Ignorierung der erhabenen grundlegenden Bedeutung der ErkenntnisErkenntnis der WahrheitWahrheit in sich und für den Menschen“ gezeigt habe.3 Um die folgenden Ausführungen, ja von Hildebrands Philosophie insgesamt im rechten Lichte sehen und verstehen zu können, sei gleich an dieser Stelle darauf aufmerksam gemacht, dass von HildebrandHildebrandDietrich von ein Vertreter der sogenannten Korrespondenztheorie der WahrheitKorrespondenztheorie der Wahrheit ist, wie sie im WortWort von der adaequatio intellectus ad rem, der „Angleichung der VernunftVernunft an den Gegenstand“, klar zum Ausdruck kommt.4 Von da her lässt sich auch „der erhabene Eigenwert der Wahrheit“ verstehen, der darin liegt, „dass ein Seiendes so erfasst wird, wie es tatsächlich ist“.5 Zudem „stellt das ErkennenErkennen des Seienden die unersetzliche Voraussetzung für die wahre VollkommenheitVollkommenheit des Menschen dar“6.
Das Aufstellen einer Behauptung ist das Eine, sie zu begründen, das Andere. So ist man unweigerlich zur Frage gedrängt, wie von HildebrandHildebrandDietrich von – über die genannten Behauptungen hinaus – die folgende TheseThese zu begründen sucht: „Die Fähigkeit, das Seiende zu erkennen und verstehend zu durchdringen, die Welt und sich selbst gleichsam im ErkennenErkennen ‚zu besitzen‘, ist einer der tiefsten Wesenszüge der geistigen PersonPerson und unlösbar mit ihrem WesenWesen als Person verknüpft.“7 In wissenschaftlicher Weise hat von HildebrandHildebrandDietrich von die Korrespondenztheorie der WahrheitWahrheit ebenso wie die TranszendenzTranszendenz des Menschen in der ErkenntnisErkenntnis und das verstehende Durchdringen des Seienden in seiner epistemologischen Hauptschrift Was ist Philosophie? begründet. Dabei charakterisiert er das Erkennen als „intentionale Teilnahme am Seienden“8, als „transzendierende geistige Berührung“9, „die nur eine Veränderung im SubjektSubjekt und nicht im erkannten Objekt bedeutet“10. Eng damit verbunden, das Merkmal des empfangenden Aufnehmens. „Zum SinnSinn des Erkennens gehört, dass ein Gegenstand, so wie er ist, von der Person erfasst, verstanden, aufgenommen wird, dass er sich erschliesst, sich in seinem Sein vor unserem geistigen Auge enthüllt.“11
Dieses Empfangen steht jedoch keineswegs für ein rein passives Verhalten. „Jedes ErkennenErkennen hat auch eine aktive Komponente, die wir als ‚geistiges Mitgehen‘ mit dem Gegenstand und seiner Eigenart bezeichnen können.“12 Dabei denkt von HildebrandHildebrandDietrich von nicht primär an die die ErkenntnisErkenntnis vorbereitenden Akte, wie die Aufmerksamkeit oder die Zuwendung zum Gegenstand. Er denkt vielmehr an ein Element im Prozess des Erkennens selbst, an ein KonspirierenKonspirieren mit dem Gegenstand, das umso mehr in den Vordergrund tritt, je komplizierter und sinnhaltiger der Gegenstand ist: „Es ist gleichsam ein intentionales Nachvollziehen des Seinsgestus des Gegenstandes, der Vollzug des Verstehens, das volle, ausdrückliche geistige Aufnehmen des jetzt real gegebenen Gegenstandes.“13
Diese Merkmale finden sich nun nicht alleine beim philosophischen ErkennenErkennen; sie finden sich vielmehr überall da, wo immer „sich uns ein Gegenstand unmittelbar oder mittelbar in seinem SoseinSosein oder Dasein erschliesst“14. Dennoch hat das spezifisch philosophische Erkennen einige Merkmale, die es von allen anderen Erkenntnistypen unterscheiden. Zu ihnen gehören die ausdrückliche Thematizität des Erkennens, die pragmatische Einstellung, der systematische und der kritische Charakter. Mit anderen Worten: Das philosophische Erkennen strebt „eine möglichst vollständige, möglichst gewisse und möglichst genaue ErkenntnisErkenntnis“15 an. Dabei ist es frei von jeder Einengung auf das, was für einen praktischen ZweckZweck wichtig ist. Überdies ist das philosophische Erkennen „ausdrücklich von dem methodischen Prinzip durchsetzt, nur von wohlfundierten, womöglich evidenten Prämissen auszugehen und nur stringente Schlüsse zuzulassen“16. Schliesslich wird dem „WissenWissen von dem jeweiligen SachverhaltSachverhalt […] nur die GewissheitGewissheit zugebilligt, die der Gegebenheitsstufe oder der Stringenz seiner indirekten Erschliessung durch Schlussfolgerungen entspricht“17.
Zum Aufweis des Spektrums des Erkenntnisphänomens ist an dieser Stelle auch der Hinweis auf den wichtigen Unterschied zwischen KennenKennen und WissenWissen am Platz. Erstens bezieht sich das Wissen – ebenso wie das ErkennenErkennen – ausschliesslich auf Sachverhalte. Es wird beispielsweise in Sätzen ausgedrückt wie: Ich weiss, dass 2 + 2 = 4. Oder: Im Jahre 49 v. Chr. hat Cäsar den Rubikon überschritten. Nur TatsachenTatsachen oder Sachverhalte sind Gegenstände des Wissens. Das Kennen dagegen bezieht sich „auf alles mit Ausnahme der Sachverhalte“18, wobei das Kennen eines Menschen, eines Buches etc. mehr oder weniger vollständig sein kann. Was sich etwa an dem SatzSatz zeigt: Ich kenne Peter, und ich weiss, dass er aus Italien stammt. Beim Kennen des Peter gibt es „Grade der Intimität wie des Verstehens“, so kann ihn der Eine besser kennen als der Andere; das Wissen dagegen hat „einen linearen Charakter, d.h., es ist direkter und schärfer umrissen“.19 Entweder stammt Peter aus Italien oder er stammt nicht aus Italien, tertium non datur. In seiner Dissertation hat von HildebrandHildebrandDietrich von den kognitiven Unterschied so gefasst, dass es beim Kennen ein „Näher oder Ferner“ gibt, währenddem das Wissen „eine konstante, nie variierende Ferne als solche“ hat.20 Beim Wissen, dessen Gegenstände ausschliesslich Sachverhalte sind, gibt es keine Grade des Verstehens, sondern Grade der GewissheitGewissheit. Was hier unterschieden wird, geht realiter jedoch ständig ineinander, denn „[m]it jeder Stufe des Kennens geht das Wissen bestimmter, dem Gegenstand geltender Sachverhalte Hand in Hand.“21