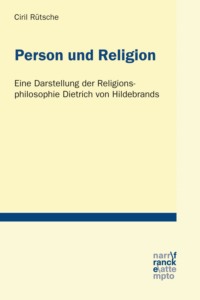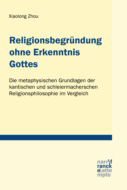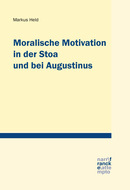Kitabı oku: «Person und Religion», sayfa 8
2.3 Absolute GewissheitGewissheit bei der ErkenntnisErkenntnis eines individuellen Sachverhalts?
Apriorische Sachverhalte besitzen einen allgemeinen Charakter. Im Bereich individueller Sachverhalte kann nur in einem einzigen Fall eine ähnliche absolute GewissheitGewissheit erlangt werden, nämlich in dem augustinischen Si fallor, sum1 oder in DescartesDescartesRené’ Cogito, ergo sum2. Ob das ArgumentArgument nun mit der TäuschungTäuschung (fallor) oder mit dem Denken (cogito) oder mit irgend einem anderen bewussten Vollzug – wie dem WissenWissen, der LiebeLiebe usw. – geführt wird, immer gestattet es die notwendige Folgerung auf die wirkliche ExistenzExistenz der sich täuschenden oder denkenden PersonPerson. „Denn wer nicht ist, kann sich auch nicht täuschen“3. Selbst dann, wenn angenommen wird, jede Wahrnehmung und jeder Gedanke sei eine blosse TäuschungTäuschung, selbst dann noch ist gewiss, dass sich nur täuschen kann, wer ist. Wer immer sich also täuscht, weiss mit Gewissheit: ich bin. Auch DescartesDescartesRené hat mit seinem Cogito, ergo sum den archimedischen PunktArchimedischer Punkt erreicht, an dem jeder ZweifelZweifel und jede Irrtumsmöglichkeit zerschellt. Das Sum ist unentthronbar. Selbst dann, wenn dieses nur ein ScheinSchein wäre, selbst dann setzt das Scheinsein die metaphysische Realität einer Person voraus. Denn sobald es einen Schein gibt, erscheint es jemandem, einem BewusstseinBewusstsein, „und dieses Bewusstsein selbst kann nicht wieder ein blosser Schein sein, sonst müsste es ja wieder einem anderen Bewusstsein erscheinen, und so ad infinitum“4.
Die ErkenntnisErkenntnis der eigenen ExistenzExistenz kommt auch nicht einem Verbleiben in der ImmanenzImmanenz des eigenen Bewusstseins gleich, vielmehr ist diese Erkenntnis „ein voller Schritt zur TranszendenzTranszendenz“5. „Denn die absolut sichere Erkenntnis eines konkreten, individuellen, realen Seienden enthält die Sprengung aller Bewusstseinsimmanenz und garantiert das volle TranszendierenTranszendieren zu einer objektiven Realität!“6 Von HildebrandHildebrandDietrich von hält die absolut gewisse Erkenntnis der eigenen Existenz jedoch nicht für das Wichtigste. „Das Wichtige ist nicht, dass ich es bin, das Wichtige ist, dass eine reale PersonPerson existiert.“7 „Weil es meine Person ist, so denkt man, sperrt man sich vielleicht in sich ein. Dies ist jedoch nicht der Fall, denn meine Person existiert ja in diesem Fall objektiv als Person, in der objektiven metaphysischen Welt.“8 Die metaphysische Existenzweise der Person wusste Blaise PascalPascalBlaise auf prägnante Weise zu charakterisieren, indem er den Menschen als ein Schilfrohr beschrieben hat, als „das schwächste der NaturNatur, aber er ist ein denkendes Schilfrohr“9. Das ganze Weltall brauche sich nicht zu wappnen, um ihn zu zermalmen, ein Wassertropfen schon genüge, um ihn zu töten. „Doch wenn das Weltall ihn zermalmte, so wäre der MenschMensch nur noch viel edler als das, was ihn tötet, denn er weiss ja, dass er stirbt und welche Überlegenheit ihm gegenüber das Weltall hat. Das Weltall weiss davon nichts.“10
2.4 Die Frage nach dem GewissheitskriteriumGewissheitskriterium, die Seinsweise der notwendigen Wesenheiten und ihr metaphysischer Ort
Der MenschMensch ist weder auf die ImmanenzImmanenz der sinnlich erfahrbaren Welt noch auf die seines eigenen Bewusstseins beschränkt. Er vermag die Grenze intentional zu übersteigen, die das Sinnliche und das Übersinnliche, die das Physische und das Metaphysische voneinander trennt. Wie sich gezeigt hat, vermag er dies auf zwei grundsätzlich verschiedene Arten: Einerseits mittels der absolut gewissen ErkenntnisErkenntnis eines allgemeinen Sachverhalts, der in einem intelligiblen und in sich notwendigen SoseinSosein gründet, andererseits durch die Erkenntnis des individuellen Sachverhalts der ExistenzExistenz der eigenen PersonPerson.
Doch wie kann man eigentlich wissen, ob es sich im gegebenen Fall um eine notwendige Soseinseinheit handelt, deren Verhalten von innen her verstanden und mit absoluter GewissheitGewissheit erkannt werden kann? Das Kriterium ergibt sich bei der Vertiefung in das SoseinSosein selbst. Es bedarf keines äusseren Kriteriums. „Der Charakter einer notwendigen, intelligiblen EinheitEinheit ist sein eigenes Kriterium.“1 Nach einem anderen Kriterium als der intelligiblen NotwendigkeitNotwendigkeitsubjektive eines Soseins zu fragen, ist absurdabsurd. Es kann kein höheres Kriterium geben.2
Wenn in diesem Sinne also mit GewissheitGewissheit erkannt werden kann, dass die VerantwortungVerantwortung FreiheitFreiheit und die Farbe den Raum voraussetzen, wo haben diese vier Soseinseinheiten dann eigentlich ihren Ort, ja, welches ist ihre Seinsweise? Als notwendige Entitäten gehören sie sicherlich nicht den morphischen EinheitenEinheitenchaotische, zufällige, morphische zu, die wohl sinnvoll, aber nicht innerlich notwendig sind. Solcherart geeinte Gegenstände wie z.B. ein Löwe oder der menschliche Körper sind in dem Sinne real, dass sie sinnlich wahrgenommen werden können. Die GerechtigkeitGerechtigkeit, die Freiheit, die Farbe, der Raum und alle notwendigen Soseinseinheiten dagegen „sind in der Tat so potent, dass es sie in bestimmter Weise gibt, selbst wenn gerade kein wirkliches Exemplar ihrer Art existiert“3. „Sie sind für ihre volle Gültigkeit weder darauf angewiesen, in einem wirklichen Gegenstand anwesend zu sein, noch von uns gedacht zu werden. Sie allein besitzen ideale Seinsweiseideale Seinsweise im vollen SinnSinn“4. Unabhängig von ihrem Realwerden im Menschen eignet beispielsweise dem SoseinSosein der Verantwortung eine ideale Seinsweise, sie ist etwas Objektives, das SeinsautonomieSeinsautonomie besitzt. Selbst wenn kein MenschMensch existiert, der Verantwortung übernimmt, selbst dann schliesst das Sosein der Verantwortung aus, eine blosse IllusionIllusion oder FiktionFiktion zu sein.
Was sodann den metaphysischen Ortmetaphysischer Ort der notwendigen Soseinseinheiten oder Wesenheiten betrifft, so zeigt sich von Hildebrands Ideologiefreiheit in aller Deutlichkeit. Denn während er einerseits die Leugnung der idealen Seinsweise der notwendigen Wesenheiten für unmöglich erklärt, begnügt er sich andererseits mit der Feststellung, „noch keinen metaphysischen Ortmetaphysischer Ort für diese notwendigen Wesenheiten [zu] haben“5. Damit zeigt er die Grösse, die alle jene nicht besitzen, die „im Sinne der Ausfüllung des nicht Erfassten“6 ein konstruktives Verhalten an den Tag legen. Wenngleich ein metaphysischer Ort der in idealer Weise seienden notwendigen Wesenheiten nicht auszumachen ist, eröffnen sowohl die Sphären der Zahlen oder der FarbenFarben ebenso einen Blick auf das Verhältnis zwischen dem idealen und dem realen Sein wie die Sphären des Ethischen oder des Personalen. Auch hier beabsichtigt er allerdings nicht, eine Lösung dieses Problems zu bieten. Bei den Zahlen lässt sich immerhin so viel sagen, dass sie „keineswegs von der realen Welt ausgeschlossen sind“7. Wenn drei Personen im Zimmer stehen, wird von einem realen, konkreten SachverhaltSachverhalt gesprochen. Dabei kann nicht verleugnet werden, „dass sie in spezifischer Weise in die reale Welt eintreten, obwohl sie nicht den Seinsmodus besitzen, der Substanzen und viele Akzidentien auszeichnet“8. Von einer analogen Weise, doch einem anderen Typus, muss bei den Farben gesprochen werden.9
Im Falle eines sittlichen Wertessittlicher Wert wiederum schliesst das ideale Sein bereits volle Realität ein. So zeigt alleine schon die Tatsache, dass menschliche HandlungenHandlungen gut sein sollen, „dass die Realität sittlicher WerteWerte durch ihre ideale Seinsweiseideale Seinsweise gewährleistet wird“10. Da sich im weiteren Verlauf dieser Untersuchung wiederholt zeigen wird, inwiefern sich bei der Setzung eines sittlich guten Aktes „eine völlig neue Art des ‚Herabreichens‘ des idealen Seienden in die Realität“11 ereignet, möge es an dieser Stelle mit diesen HinweisenHinweise sein Bewenden haben.
2.5 Das überaktuelle WissenWissen und die ReligionReligion
Am Beginn dieses Abschnitts stand die Frage, ob der MenschMensch überhaupt wissen könne, wie es um das Transzendente bestellt ist, oder ob seine Wissensmöglichkeiten auf den immanenten Bereich des sinnlich Erfahrbaren beschränkt seien. Wie sich erwiesen hat, kann der Mensch metaphysische Erkenntnissemetaphysische Erkenntnisse erlangen und um das Transzendente wissen. Mit dem apriorischen ErkennenErkennen ist der archimedische Punktarchimedische Punkt absoluter GewissheitGewissheit erreicht, an dem jeder ImmanentismusImmanentismus, jeder SkeptizismusSkeptizismus und RelativismusRelativismus scheitern muss.1
Aus dem ErkennenErkennen resultiert das WissenWissen über das Verhalten einer gegebenen Sache. Formalisiert gefasst: Erkannt wird das a-Sein oder das nicht a-Sein eines B, wodurch das Wissen um das Verhalten des B erworben wird. Quer durch von Hildebrands Schriften begegnet die Unterscheidung zwischen verschiedenen Arten des Wissens. Er zeigt auf, wie das Wissen in drei grundlegenden Formen auftreten kann: Es kann aktuellaktuell sein, so dass es das BewusstseinBewusstsein im gegenwärtigen Augenblick erfüllt, es kann potentiellpotentiell sein, so dass es aus dem GedächtnisGedächtnis in das aktuelle Bewusstsein gleichsam „zurückgeholt“ werden kann, und es kann überaktuellüberaktuell sein.
Das überaktuelle WissenWissen ist jedoch „nur hinsichtlich bestimmter Arten von Sachverhalten und Gegenständen möglich“2. Das Wissensobjekt muss von metaphysischer Bedeutung sein und „die existentiellsten und fundamentalsten Fragen betreffen, die sich auf alle Elemente einer WeltanschauungWeltanschauung beziehen“3. Selbstredend bildet es dadurch eine ständige Grundlage des Lebens, „einen kontinuierlichen Hintergrund für andere Erlebnisse“4. Mit anderen Worten, ist jedes GutGutdas Gegenstand überaktuellen Wissens, das eine solch existentielle Rolle im eigenen Leben spielt, dass ohne Kenntnis von ihm das Leben ein anderes wäre.5 „Es lebt in solcher Weise auf dem Grund unseres Geistes, dass sich jeder konkrete, aktuelle Augenblick unseres Lebens radikal ändern würde, falls wir es nicht wüssten.“6 Die Überaktualität des menschlichen Bewusstseins ist eine Tatsache, die von entscheidender Bedeutung für das Verständnis des Menschen ist.7
Zu denken ist dabei etwa an die LiebeLiebe, die sich nicht in der Gegenwart erschöpft, sondern sich über die Aktualität hinaus erstreckt. Hätte die PersonPerson nur eine Bewusstseinsart, so könnte ein Verliebter unmöglich ernsthaft seiner täglichen Arbeit nachgehen. Verfügte die Person nämlich nur über ein aktuelles BewusstseinBewusstsein, so hätte sie entweder ein aktuelles Bewusstsein vom Verliebtsein oder von der Arbeit, auf die sie gerichtet ist. Dass die Koexistenz von Verliebtsein und Arbeiten aber sehr wohl möglich ist, rührt daher, „dass nicht nur das in der Liebe gesprochene ‚WortWort‘ in seiner Gültigkeit fortdauert, dass nicht nur eine Position festgelegt wurde dem anderen Menschen gegenüber, die fortdauert, sondern dass diese StellungnahmeStellungnahme als solche fortlebt in unserer SeeleSeele“8. Und gerade weil die Stellungnahme fortlebt, weil sie „als diese identische psychisch-geistige Realität völlig lebendig in der Seele“ verbleibt, „verändert [sie] den Gesamtstatus unseres Erlebens“.9 Darum fällt das Arbeiten auch umso leichter, wenn man verliebt ist. Wie sich weiter unten noch verdeutlichen wird, kann der MenschMensch überaktuellüberaktuell in einer tieferen Schicht am WissenWissen um bestimmte Sachverhalte und Gegenstände bzw. WerteWerte und an der wertantwortenden Stellung festhalten. Auch wird sich zeigen, dass und warum die kontinuierliche Entwicklung der Person die Überaktualität voraussetzt.10
Das überaktuelle WissenWissen begegnet auch und vor allem in der ReligionReligion.11 Während die Sachverhalte und Gegenstände des überaktuellen Wissens nach von HildebrandHildebrandDietrich von „die existentiellsten und fundamentalsten Fragen betreffen, die sich auf alle Elemente einer WeltanschauungWeltanschauung beziehen“12, spricht HusserlHusserlEdmund von den „Fragen nach SinnSinn oder SinnlosigkeitSinnlosigkeit dieses ganzen menschlichen Daseins“13, welche sich in den Fragen konkretisieren nach der ErkenntnisErkenntnis, nach den Werten, nach der ethischen HandlungEthische Handlung, nach der FreiheitFreiheit, nach der UnsterblichkeitUnsterblichkeit und schliesslich nach GottGott, „der ‚absoluten‘ VernunftVernunft als der teleologischen Quelle aller Vernunft in der Welt, des ‚Sinnes‘ der Welt“14. Was dem einen die existentiellsten und fundamentalsten Fragen, das sind dem anderen die Fragen nach dem Sinn und der Sinnlosigkeit des ganzen menschlichen Daseins. Nicht nur spricht von HildebrandHildebrandDietrich von von der Religion als einer lebendigen Verbindung des Menschen mit Gott,15 dem absoluten personalen WesenWesen,16 auch für HusserlHusserlEdmund gründet der Sinn des Ganzen letztlich in der absoluten Vernunft, in Gott.
3 Die Frage nach der Erkennbarkeit der AussenweltErkennbarkeit der Aussenwelt und ihr Botschaftscharakter
Im Anschluss an die BegründungBegründung der Möglichkeit synthetischsynthetisch-apriorischen Erkennens seien zwei weitere Problemkreise diskutiert und ihre Zugehörigkeit zum philosophischen ErkennenErkennen geprüft. An erster Stelle das Problem der Erkennbarkeit der AussenweltErkennbarkeit der Aussenwelt. Dass es sich dabei um ein metaphysisches Problem handelt, darauf verweisen sowohl KantKantImmanuel als auch der sogenannte Wiener KreisWiener Kreis1. KantKantImmanuel sprach von einem „Skandal der Philosophie und allgemeinen Menschenvernunft, das Dasein der Dinge ausser uns […] bloss auf Glauben annehmen zu müssen, und, wenn es jemand einfällt es zu bezweifeln, ihm keinen genugtuenden BeweisBeweis entgegenstellen zu können“2. Der Wiener Kreis wiederum vertrat in seiner antimetaphysischen Einstellung die Auffassung, dass die Aussagen über Realität oder Nichtrealität der Aussenwelt sinnlossinnlos, weil nicht verifizierbar seien. Als sinnvoll galten in ihrem Kreis nur die Aussagen, welche sich in empirischer Überprüfung als wahr oder falsch erweisen lassen.3
Eines ist klar: Wären alle Gegenstände der Welt nur Erscheinungen (Phänomena) im Sinne Kants, so müsste ihnen die volle ObjektivitätObjektivität abgesprochen werden. Von HildebrandHildebrandDietrich von vertritt demgegenüber die „TheseThese, dass die existentielle Rolle, die alle bedeutungsvollen Aspekte im menschlichen Universum spielen – ob sie notwendige Wesenheiten sind oder nicht –, uns davor bewahrt, sie als eine Art von TäuschungTäuschung zu betrachten“4. Ihre bedeutungsvolle BotschaftBotschaft ist einer Täuschung offensichtlich entgegengesetzt. Sei dies nun die Wahrnehmung eines Sonnenuntergangs, sei es das Verkosten der alpinen SchönheitSchönheit oder sei es die Farbenpracht der Laubbäume im Prozess des Verfärbens: Was im Frühling und im Sommer grüner Farbe war, das erscheint im Herbst in einem Gemisch von grünen, bräunlich-gelben bis rötlichen FarbenFarben, welche ihre Pracht im Sonnenglanz voll entfalten können. Was die WirklichkeitWirklichkeit vom IrrtumIrrtum, was Täuschung von objektiver, gültiger ErscheinungErscheinung trennt, ist die Frage, ob eine solche Botschaft vorliegt oder nicht. Die elektromagnetischen Wellen sind jedenfalls nicht wirklicher als die Farben, sie haben vielmehr die Funktion der Basis, auf dass Farben erscheinen können.
Von HildebrandHildebrandDietrich von weiss die Botschaftsobjektivität auf überzeugende Weise anhand des Kunstwerks zu veranschaulichen. Wenn der Künstler verschiedene Mittel verwendet, um bestimmte Wirkungen hervorzubringen, dann sind diese Wirkungen der Grund, weswegen die Mittel zu ihrer Erlangung verwendet wurden. Und gesetzt den Fall, ein Betrachter erfasste den künstlerischen Gehalt nicht, so hätte er weder das Thema noch die BotschaftBotschaft des Kunstwerks verstanden. Dieselben Unterscheidungen weiss von HildebrandHildebrandDietrich von auch im Falle einer Symphonie zu machen. Hielte man nur die Instrumente und die Bewegungen, die die Musiker ausführen, für wirklich, die Musik selber aber für ein Nebenprodukt, so wäre die ganze Ordnung der Symphonie auf den Kopf gestellt. „Die Bewegungen der Musiker sind sinnlossinnlos und lächerlich, wenn man von der Musik absieht, die hervorzubringen sie bestimmt sind. Die Musik ist raison d’être dieser Bewegungen.“5
Die Frage nach der objektiven Gültigkeitobjektive Gültigkeit einer ErscheinungErscheinung erhält ihr besonderes Gewicht, wenn die Welt als SchöpfungSchöpfung Gottes und der MenschMensch als Herr der Schöpfung verstanden werden. Dann enthalten viele Dinge dieser Welt eine BotschaftBotschaft Gottes an die Menschen. „Botschaft bedeutet hier den gottgegebenen oder gottgewollten Aspekt eines Gegenstandes der NaturNatur.“6 An dieser Stelle ist jedoch nicht der Botschaftscharakter gewisser Erscheinungen in der Welt thematisch, davon wird weiter unten die Rede sein,7 sondern die Frage nach der Begründbarkeit der objektiven ExistenzExistenz der Aussenwelt. Um diese zu begründen, greift von HildebrandHildebrandDietrich von auf das SollenSollen zurück. Nicht auf das moralische Sollen, sondern auf das Sollen im Sinne des So-erscheinen-Sollens. So kann er sagen: „Die Berge sollen aus der Ferne blau aussehen, ebenso wie in einem Gemälde die Perspektive den Eindruck des Raumes geben oder der Kontrast gewisse FarbenFarben mehr hervortreten lassen soll.“8 Desgleichen, wenn ein NaturwissenschaftlerNaturwissenschaftler lehren würde, dass der Himmel in WirklichkeitWirklichkeit nicht blau, sondern schwarz sei. Dann wäre es falsch, die schwarze Farbe für objektiver und authentischer zu halten und die blaue Farbe zu einem blossen ScheinSchein zu erklären. „Die blaue Farbe des Himmels hat einen voll objektiven Charakter. Er soll so aussehen. Dies ist ein tiefes, bedeutsames Element in einer Weltsicht, die klassisch menschlich, aber gerade deshalb gültiger ist.“9
Ebenso verhält es sich mit der FormForm des Himmels als eines Gewölbes mit horizontaler und vertikaler Dimension. Auch sind die Kategorien von oben und unten kein blosser ScheinSchein, denen in der WirklichkeitWirklichkeit kein Platz zukommt. Wo der Empirist John LockeLockeJohn auf die sekundären Sinnesqualitäten gestossen ist – d.h. auf Vorstellungen, bei denen in den Körpern nichts existiert, was ihnen gleich wäre –, sie aufgrund seines immanenten Weltbildes aber nicht angemessen zu verstehen vermochte, da bezeichnet von HildebrandHildebrandDietrich von oben und unten als „Analogien zu zwei fundamentalen metaphysischen Kategorien“10. Selbst wenn der NaturwissenschaftlerNaturwissenschaftler mit seiner Behauptung Recht hat, die Kategorien von oben und unten hätten in der Aussenwelt keine Bedeutung, so tut das der Tatsache dennoch keinen Abbruch, dass oben und unten objektive Elemente der Wirklichkeit sind. Denn die Aussenwelt soll sich dem Menschen so darbieten, wie sie ihm erscheint. Was von HildebrandHildebrandDietrich von einerseits in der Intention des Schöpfers gründen und ihn andererseits vom humanen Aspekt der Aussenwelthumane Aspekt der Aussenwelt sprechen lässt. Doch deduziert von HildebrandHildebrandDietrich von den humanen Aspekt, das Für-den-Menschen-so-aussehen-SollenSollen nicht von dem Glauben an die SchöpfungSchöpfung, vielmehr wird er unmittelbar erfasst. „Jedoch leuchtet er in besonderer Klarheit auf, wenn wir ihn im Lichte der Schöpfung betrachten.“11
Wenn die ExistenzExistenz der Aussenwelt für KantKantImmanuel nur aufgrund eines gläubigen Fürwahrhaltens angenommen, welches selbst von keinem stützenden BeweisBeweis getragen werden kann, und wenn die Mitglieder des Wiener Kreises die Aussagen über Realität oder Nichtrealität der Aussenwelt als sinnlossinnlos erachten, weil sie empirisch nicht überprüft werden können, dann stellen von Hildebrands Argumente für die objektive Existenz der Aussenwelt einen existentiell begründeten Kontrapunkt dar. Der Botschaftscharakter bestimmter humaner Aspekte der Aussenwelt liess ihn vor dem Hintergrund einer objektiven, in ihrer Existenz vom menschlichen GeistGeist unabhängigen und für ihn auch erkennbaren WirklichkeitWirklichkeit zu der EinsichtEinsicht in die Gültigkeit und Realität der Aussenwelt gelangen.