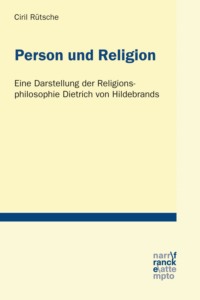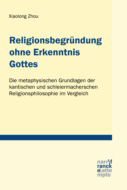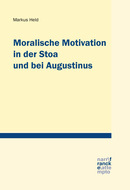Kitabı oku: «Person und Religion», sayfa 7
2.1 Die ÄquivokationÄquivokation des Begriffs der Erfahrung
Seiner Kritik an Kants TranszendentalismusTranszendentalismus und ImmanentismusImmanentismus legt von HildebrandHildebrandDietrich von den Aufweis der Vieldeutigkeit des Begriffs der Erfahrung zugrunde. In der Erfahrung liege keine NotwendigkeitNotwendigkeitsubjektive, kann als Leitprinzip der neuzeitlichen ErkenntnistheorieErkenntnistheorie bezeichnet werden. Man findet es bei René DescartesDescartesRené (1596–1650) ebenso wie bei John LockeLockeJohn (1632–1704), bei David HumeHumeDavid (1711–1776) ebenso wie bei Immanuel KantKantImmanuel (1724–1804), um hier nur einige der namhaftesten Vertreter zu nennen. Was als Leitprinzip fungierte, trug allerdings deutliche Züge eines schlichten Vorurteils. Denn einfachhin ging man von der Univozität des Erfahrungsbegriffs aus, und zwar von einer Erfahrung, in der tatsächlich keine NotwendigkeitNotwendigkeitsubjektive zu finden ist, nämlich der Sinneserfahrung. Insofern nicht ohne LogikLogik, verlegte HumeHumeDavid die Wissenschaftlichkeit alleine in die abstrakten Wissenschaften der Geometrie, der Algebra und der Arithmetik. Auch KantKantImmanuel erwartete von der Sinneserfahrung keine NotwendigkeitNotwendigkeitsubjektive, sondern ausschliesslich von den Voraussetzungen der Erfahrung, d.h. von den die Sinnesempfindungen spontan überformenden Anschauungs- und Denkformen. Dagegen kommt von HildebrandHildebrandDietrich von das Verdienst zu, die ÄquivokationÄquivokation des Erfahrungsbegriffs aufgedeckt zu haben. Er hat gezeigt, dass NotwendigkeitNotwendigkeitsubjektive auch in der Erfahrung gegeben sein kann. Und zwar dann, wenn die Erfahrung differenziert wird in das Erfahren des Daseins einerseits, des Soseins andererseits. Wobei NotwendigkeitNotwendigkeitsubjektive nicht darin zu finden ist, dass ein bestimmtes Seiendes existiert, sondern alleine im Was, im SoseinSosein des Existierenden. Nach von Hildebrands Terminologie also nicht in der RealkonstatierungRealkonstatierung, sondern alleine in der SoseinserfahrungSoseinserfahrung.1
Hätte KantKantImmanuel dafür gehalten, dass jedes SoseinSosein in dem Sinne ein synthetischsynthetisch-apriorisches ErkennenErkennen ermöglicht, dass die rezeptive Sinnesempfindung und die spontane Überformung dieses Soseins mit den Anschauungsformen von Raum und Zeit bzw. den Denkformen die Grundlage geschaffen hätte, um apriorische und wissenserweiternde Erkenntnisse über diese Vorgänge zu erlangen, dann jedoch nicht über das Sosein, über die MaterieMaterie der ErkenntnisErkenntnis selbst. Für KantKantImmanuel eröffnet jedes Sosein dieselben – formellen – Erkenntnismöglichkeiten wie jedes andere auch. Wenn KantKantImmanuel die „apodiktische GewissheitGewissheit“2, die „NotwendigkeitNotwendigkeitsubjektive und strenge Allgemeinheit“3 als die Merkmale des synthetisch-apriorischen Erkennens benennt, dann widerspricht ihm von HildebrandHildebrandDietrich von hinsichtlich der strengen Allgemeinheit, d.h. der AllgemeingültigkeitAllgemeingültigkeit. Denn da die apriorischen Erkenntnisse nicht von jeder Erfahrung unabhängig sein müssen, so vor allem nicht von der SoseinserfahrungSoseinserfahrung, „verträgt sich der apriorische Charakter einer Erkenntnis sehr wohl damit, dass jemand, solange ihm die entsprechende Soseinserfahrung fehlt, den apriorischen Bestand nicht einzusehen vermag“4.
Obwohl das synthetischsynthetisch-apriorische ErkennenErkennen – in Kants Terminologie: das philosophische Erkennen5 – das Erfahren des Soseins voraussetzt, in dem der zu erkennende SachverhaltSachverhalt gründet, ist es dennoch möglich, einen realen Kontakt mit einem Seienden zu haben, dabei aber einer Erfahrung des Soseins zu ermangeln. Dies soll anhand eines Beispiels aus der Literatur veranschaulicht werden. In seinem Roman Die Brüder Karamasow zeigt Fjodor DostojewskiDostojewskiFjodor auf eindrückliche Weise den Unterschied auf zwischen der RealkonstatierungRealkonstatierung und der SoseinserfahrungSoseinserfahrung.
In seinen Jünglingsjahren führte der nachmalige Starez Sossima ein ausschweifendes Leben. Einmal, er diente zu der Zeit als Offizier, wurde er aufgrund einer von ihm ausgesprochenen Beleidigung zum Duell aufgefordert. Als er am Abend vor dem entscheidenden Tag nach Hause zurückkehrte, ärgerte er sich über seinen Diener Afanasi „und schlug ihn aus aller Kraft zweimal ins Gesicht, so dass es mit Blut überströmt war“. Hernach legte er sich schlafen. Als er am nächsten Morgen, am Tag des Duells, aufwacht, hat er ganz neuartige Gedanken. Sind die Gedanken zuerst nebulös, verhüllt, unscharf, werden sie alsbald immer klarer. Er denkt nicht etwa an das bevorstehende Duell, sondern an die Schläge, die er seinem Diener erteilte. „Alles trat mir da plötzlich aufs neue vor die Augen, gleich als ob von neuem alles vor sich gehe: er steht vor mir, und ich schlage ihn, weit ausholend, gerade ins Gesicht; er aber hält die Hände an die Hosennaht, den Kopf gerade, die Augen hat er aufgerissen wie an der Front, er zittert bei jedem Schlag und wagt nicht einmal die Hände zu erheben, um sich zu schützen – und da ist ein MenschMensch bis dahin gebracht worden, und da schlägt ein Mensch einen Menschen! Was ist das für ein Verbrechen! Es war, als ob eine scharfe Nadel mir die ganze Brust durchstossen habe.“6
Was hatte sich wohl in dieser Nacht zugetragen? Was war geschehen? Hatte er es am Vorabend noch als angemessen erachtet, seinen Diener zu schlagen, wenn er sich ob diesem ärgert, so steht ihm am nächsten Morgen die Würde und die Kostbarkeit dieses Menschen klar vor Augen. Und in dem Moment, in dem sich ihm die Würde und der Wert des Menschen in aller Schärfe offenbart, kann er es nicht mehr verstehen, wie er das jemals hat übersehen können.
Der Unterschied zwischen den beiden Erfahrungsarten, der RealkonstatierungRealkonstatierung und der SoseinserfahrungSoseinserfahrung, tritt hier deutlich zutage. Am Vorabend des Duells nimmt er wohl, wie bis anhin, seinen Diener wahr (Realkonstatierung). Die jeder PersonPerson eignende MenschenwürdeMenschenwürde dagegen vermag er nicht zu erfassen. Erst am nächsten Tag, nachdem er eine zutiefst personale Stellungsumkehr vollzogen hatte, „sah“ er die notwendig mit jeder menschlichen Person gegebene Menschenwürde (Soseinserfahrung).7
2.2 Die verschiedenen Arten des Soseins und der Unterschied zwischen empirischer und apriorischer ErkenntnisErkenntnis
Mit der Unterscheidung verschiedener Arten des Soseins begründete von HildebrandHildebrandDietrich von auch den erkenntnismässigen Unterschied zwischen dem empirischen und dem apriorischen ErkennenErkennen. An den Beginn seiner Grundlegung stellt er das WortWort, dass jedes seiende Etwas eine EinheitEinheit sei, „und sein SoseinSosein irgendwie als Einheit charakterisiert sein“ müsse, um im nächsten Schritt nach „den Graden der Sinnhaftigkeit in den Soseinseinheiten“ zu fragen.1 Dabei steigt er vom Niederen zum Höheren auf und bringt drei grundsätzlich verschiedene Einheitsstufen zu BewusstseinBewusstsein. Da die EinheitenEinheitenchaotische, zufällige, morphische der niedersten Stufe, die chaotischen und zufälligen EinheitenEinheitenchaotische, zufällige, morphische, kein genuines Erkennen ermöglichen, braucht an dieser Stelle auch nicht auf sie eingegangen zu werden. Mit dem Verweis auf die entsprechende Quelle sei dieser Einheitsart Genüge getan.2 Die auf der nächsthöheren Stufe gelegenen EinheitenEinheitenchaotische, zufällige, morphische dagegen „haben ein sinnvolles Sosein, eine Washeit, die uns berechtigt, von wirklichen Typen zu sprechen“3.
Im Unterschied zu einer zufälligen EinheitEinheit, wie z.B. einem Gerümpelhaufen oder einer Notenfolge, die keine Melodie ist, wird der echte Typus „nicht von aussen zusammengehalten, sondern besitzt eine vom ‚ZentrumZentrum‘ ausgehende Einheit; seine Elemente sind nicht zufällig, sondern von innen her sinnvoll verbunden“4. Solcherart sind z.B. das Gold, der SteinSteinEdith, das Wasser, der Löwe oder das Pferd. Von HildebrandHildebrandDietrich von unterscheidet im SoseinSosein der Gegenstände dieser Art zwei Schichten: die Erscheinungseinheit und die konstitutive Einheit. Die erste Schicht bezeichnet er als das „‚Gesicht‘, als die Einheit der äusseren ErscheinungErscheinung“, und unterscheidet sie von der zweiten Schicht, „bei der es sich um das Sosein dieses Materietyps handelt, der dieses Gesicht trägt“.5 Um Erkenntnisse über das Gesicht eines solcherart geeinten Seienden – von HildebrandHildebrandDietrich von spricht von den morphischen EinheitenEinheitenchaotische, zufällige, morphische – erlangen zu können, muss es von aussen beobachtet werden. Die konstitutive Einheit dagegen kann durch Experimente und durch die Verwendung von Instrumenten – wie etwa des Mikroskops – sozusagen zusammengesetzt werden. Trotz aller Sinnhaftigkeit, tragen sie aber dennoch „das Merkmal des Kontingenten und ‚Erfundenen‘“6. Bei der ErkenntnisErkenntnis des Verhaltens eines Seienden mit einer morphischen Einheit wird im besten Falle der Gewissheitsgrad der HöchstwahrscheinlichkeitHöchstwahrscheinlichkeit erreicht, denn es „lässt für eine prinzipielle Ergänzungs- und Täuschungsmöglichkeit Raum“7. Wird dagegen der Einwand erhoben, dass es doch nicht kontingentkontingent, sondern vielmehr notwendig sei, dass dieser Löwe nicht gleichzeitig existieren und nicht existieren kann, oder dass das Gold immer räumlich ausgedehnt ist, so handelt es sich dabei zweifelsohne um Urteile, die keinen Raum lassen für eine Ergänzungs- oder Täuschungsmöglichkeit. Das hat seinen Grund letztlich aber nur insofern im Sosein des Löwen oder des Goldes, als es zugleich materielle Dinge sind, als sie, um mit John R. White zu sprechen, durch gewisse formal necessary features determiniert sind.8 Damit ist die Grenze erreicht, die den immanenten und den transzendenten Wirklichkeitsbereich voneinander trennt.
2.2.1 Das epistemologische AprioriApriori als absolut gewisse ErkenntnisErkenntnis höchst intelligibler und wesensnotwendiger Sachverhalte
Ganz anders liegen die Dinge beim apriorischen ErkennenErkennen, mit dem die Grenze der ImmanenzImmanenz überschritten und WissenWissen über Transzendentes erworben wird. Dabei ist die Unabhängigkeit von jeder Erfahrung nicht im umfassenden Sinne Bedingung, sondern nur im Sinne der Erfahrung des Daseins, der RealkonstatierungRealkonstatierung. Beim AprioriApriori geht es von HildebrandHildebrandDietrich von nicht um die Frage, ob es Gehalte gibt, die unabhängig von irgendeiner SoseinserfahrungSoseinserfahrung bekannt sind, so wie bei Kants transzendentalen Anschauungsformen und Kategorien, bei Platons WiedererinnerungWiedererinnerung1 oder bei DescartesDescartesRené’ eingeborenen IdeenIdeen2. Beim Apriori geht es von HildebrandHildebrandDietrich von um nichts weniger als um „die erkenntnistheoretische Frage schlechthin“: „die Frage nach der ExistenzExistenz und der Möglichkeit absolut gewisser ErkenntnisErkenntnis höchst intelligibler und wesensnotwendiger Sachverhalte“.3
Das objektive Korrelat des Erkennens bildet dabei das Verhalten eines Gegenstandes mit einem SoseinSosein, das in sich notwendig ist, bei dem die Wegnahme auch nur eines Elementes die ganze EinheitEinheit zerstören würde. Mit einem Beispiel: Während bei einem Löwen ein Bein fehlen kann und er noch immer ein Löwe ist, lässt sich anhand des Soseins des Verzeihens etwa verdeutlichen, inwiefern sich dies bei den notwendigen EinheitenEinheitenchaotische, zufällige, morphische anders verhält. Denn angenommen, einer PersonPerson wird von einer anderen Person ein ÜbelÜbel zugefügt, das diese Person aber nicht aus freiem WillenWillen getan hat, so wird sie sie auch nicht um VerzeihungVerzeihung bitten, ja nicht einmal bitten können, so fest sie sich auch darum bemüht. Was sie allenfalls kann, ist MitleidMitleid für sie empfinden. Das VerzeihenVerzeihen setzt das WissenWissen um die eigene Schuldigkeit voraus, welches hier gerade fehlt. Vor allem aber kann das notwendige Sosein der Verzeihung nur dann erfahren werden, wenn keines der Elemente fehlt, also weder das willkürliche Zufügen eines Übels noch die EinsichtEinsicht in die eigene Schlechtigkeit oder die Selbstanklage vor der anderen Person, welche diese nach dem Mass der Aufrichtigkeit des Selbstanklägers gegebenenfalls dazu bewegt, diesem das zugefügte Übel zu verzeihen. Mit dem freien Akt des Verzeihens wird die Tat, die zwischen den Personen eine objektive Unordnung begründete, nicht dem Vergessen übergeben, sondern vielmehr als ein Sieg des Wohlwollens im GedächtnisGedächtnis verankert. An diesem Beispiel zeigt sich, wie das Fehlen auch nur eines Elementes die ganze Einheit des notwendigen Soseins des Verzeihens zerstört.
Mit der Einführung eines Terminus, in diesem Fall des Terminus „VerzeihenVerzeihen“, ist ein UrphänomenUrphänomen bezeichnet – und Urphänomene sind die meisten Wesenheiten4 –, das sich nicht in dem Sinne in einer DefinitionDefinition niederschlägt, als liesse sich „eine philosophische Untersuchung mit dem Nachschlagen in einem Lexikon auf die gleiche Stufe stellen“5. Das philosophische Erkenntnisbemühen „dient nicht dazu, die notwendige Soseinseinheit so in ihre Bestandteile aufzulösen, dass eine Definition derselben das anschauliche Erfassen auch vom Standpunkt der Kenntnisnahme ersetzen könnte“6. Dieses Bemühen beinhaltet vor allem eine volle prise de conscienceprise de conscience7 des Gegebenen, ein voll bewusstes „Innewerden von TatsachenTatsachen, die wir in unserem lebendigen Seinskontakt voraussetzen und daher schon irgendwie kennen“8. Ein ZielZiel, das aber unmöglich erreicht werden kann, wenn in einer falschen reduktionistischen Einstellung all das verworfen wird, was sich nicht durch eine formale Definition erschöpfend erklären lässt.9 Was die Definition allein vermag, ist, sie zu umschreiben, „indem sie einige essentielle Merkmale anführt, die zur Unterscheidung dieser Wesenheit von einer anderen genügen“10.
Zu glauben, „wir hätten ein Seiendes geistig ‚erobert‘, weil wir eine korrekte DefinitionDefinition von ihm besitzen“11, nennt von HildebrandHildebrandDietrich von einen Selbstbetrug. Womit er nicht zuletzt sein eigenes Verständnis der Philosophie zum Ausdruck bringt, die ihm nicht ein rein begriffliches Unternehmen ist, sondern – ganz im Sinne Newmans – einen persönlichen, realen Kontakt mit den notwendigen Soseineinheiten voraussetzt, unter „Betonung des existentiellen, unmittelbaren, intuitiven Kontaktes mit dem Gegenstand“12. Was aber ist ein realer Kontakt mit notwendigen Soseinseinheiten, denen aufgrund ihrer NotwendigkeitNotwendigkeitsubjektive doch nicht eine reale, sondern eine ideale Seinsweiseideale Seinsweise zukommt? Diese kritische Frage sei nicht an dieser Stelle beantwortet, sie bleibt dem weiteren Verlauf dieser Untersuchung vorbehalten.13
Was nun „die Frage nach der ExistenzExistenz und der Möglichkeit absolut gewisser ErkenntnisErkenntnis höchst intelligibler und wesensnotwendiger Sachverhalte“14 betrifft, so hat erstmalig Adolf ReinachReinachAdolf in aller Deutlichkeit darauf hingewiesen, „dass die AprioritätApriorität primär weder den Sätzen noch dem UrteilUrteil noch dem ErkennenErkennen zukommt, sondern dem ‚gesetzten‘, geurteilten oder erkannten SachverhaltSachverhalt“15. Und wie im Sachverhalt alle Apriorität wurzelt, so kommt auch nur dem Sachverhalt NotwendigkeitNotwendigkeitsubjektive zu.16 Für die BegründungBegründung der Möglichkeit philosophischen Erkennens ist der Sachverhalt von grundlegender Bedeutung: Erstens bildet er das objektive Korrelat des Erkennens und zweitens ist er Träger von Modalitäten. Letzteres ist denn auch der Grund, weswegen „die Apriorität primär weder den Sätzen noch dem Urteil noch dem Erkennen zukommt, sondern dem ‚gesetzten‘, geurteilten oder erkannten Sachverhalt“17. Insofern sind die Sachverhalte nämlich apriorisch, als „die Prädikation in ihnen, das b-Sein etwa, gefordert ist durch das WesenWesen des A, insofern es in diesem Wesen notwendig gründet“18. Notwendig gründet ein Sachverhalt dann in einem Wesen, wenn dieses selbst innerlich notwendig ist. Wie z.B. im Falle des Menschen, der LiebeLiebe, der GerechtigkeitGerechtigkeit, der Ungerechtigkeit, der WahrheitWahrheit, der Erkenntnis, des Willens, der Zeit, der Zahl oder des Verzeihens, usw.19
Das ErkennenErkennen von Sachverhalten, die in einem SoseinSosein gründen, das durch eine „strikte innere, in den Wesenheiten gründende NotwendigkeitNotwendigkeitsubjektive“ charakterisiert ist, zeichnet sich aus durch eine „unvergleichliche IntelligibilitätIntelligibilität“ und eine „absolute GewissheitGewissheit“.20 Nil volitum nisi cogitatum – kein Wollen ohne vorhergehendes Erkennen21 – ist ein Beispiel eines wesensnotwendigen Sachverhalts. Es handelt sich dabei um einen Relationssachverhalt,22 d.h. um das Verhalten eines Gegenstands zu einem anderen Gegenstand. Das Verhalten des Wollens zum Erkennen ist nun ebenso notwendig wie die WesenWesen selbst, deren Verhalten erkannt wird. Während das Bestehen des Sachverhalts „Erwärmung dehnt die Körper aus“ nur von aussen erfasst werden kann, wird der SachverhaltSachverhalt „Kein Wollen ohne vorhergehendes Erkennen“ von innen her verstanden. Das lateinische WortWort intelligere – Thomas von AquinThomas von Aquin sprach von einem Lesen im Innern (intus legere23) – bringt das Gemeinte treffend zum Ausdruck.
IntelligibilitätIntelligibilität ist dabei nicht gleich Definierbarkeit. Die notwendigen Wesenheiten sind weder von anderem deduzierbar noch auf anderes reduzierbar. Es lassen sich aber verschiedene Arten der Intelligibilität unterscheiden. Von HildebrandHildebrandDietrich von grenzt die Intelligibilität der Zahlen von derjenigen der FarbenFarben ab, und während er die Intelligibilität der Zahlen als dünn und linear bezeichnet, ja als zu dünn, um sich in sie versenken zu können,24 spricht er den Farben eine qualitative Fülle zu. Davon scheidet er Entitäten wie die PersonPerson, den WillenWillen, das Versprechen, die Wirkursache usw., die sich von den erstgenannten Arten nicht alleine „durch ihre gleichsam dreidimensionale Fülle und ihre TiefeTiefe abheben“, denen zudem „ein Sinnreichtum gemeinsam“ ist.25 Damit ist auch ein erkenntnistheoretischer Vorrang gegeben, denn die Tiefendimension und der SinngehaltSinngehalt ermöglichen es, „uns wieder und wieder in seine Fülle vorzutasten und jedes Mal mit neuen, volleren Einsichten belohnt zu werden“26.27 Während das Merkmal der NotwendigkeitNotwendigkeitsubjektive, wie gesehen, auf den SachverhaltSachverhalt beschränkt und die Intelligibilität mit der Erkennbarkeit verbunden ist, ist das dritte Merkmal apriorischen Erkennens, die absolute GewissheitGewissheit, eines der Beziehung zwischen dem Sachverhalt und der ErkenntnisErkenntnis.
2.2.2 Sind die apriorischen Erkenntnisse blosse TautologienTautologien?
Nichtsdestotrotz – oder gerade deswegen? – können die apriorischen Erkenntnisse bzw. Urteile leicht verwechselt werden mit tautologischen Erkenntnissen bzw. Urteilen. Von HildebrandHildebrandDietrich von spricht KantKantImmanuel das grosse Verdienst zu, „im Bereich der Urteile zum ersten Mal einen wesentlichen und höchst bedeutsamen Unterschied herausgearbeitet zu haben, nämlich den zwischen tautologischen und nichttautologischen Urteilen“1. Die tautologischen nannte KantKantImmanuel analytische, die nichttautologischen bezeichnete er als synthetische Urteile. Bei den analytischen Urteilen wird im PrädikatPrädikat nur wiederholt, was im Subjektsbegriff schon enthalten ist. Wird z.B. gesagt: „Jeder Sohn stammt von Eltern ab“, so ist im BegriffBegriff des Sohnes die Beziehung zu den Eltern schon enthalten. Das WissenWissen wird damit nicht erweitert. Das Wissen wird nur mit den Erkenntnissen erweitert, die seit KantKantImmanuel synthetische genannt werden. Synthetisch ist z.B. der von KantKantImmanuel bezeichnete SatzSatz „7 + 5 = 12“2, denn weder im Begriff von 12 noch von 7 oder 5 findet sich ein expliziter Bezug auf den im Satz ausgedrückten SachverhaltSachverhalt. Im Unterschied zu den analytischen oder tautologischen Urteilen, die bloss erläutern, was im Subjektsbegriff bereits gesetzt war, erweitern die synthetischen Erkenntnisse das Wissen.3
Im Buch Gamma seiner MetaphysikMetaphysik hat AristotelesAristoteles auf einen notwendigen SachverhaltSachverhalt aufmerksam gemacht: Unmöglich könne dasselbe demselben und in derselben Hinsicht zugleich zukommen und nicht zukommen.4 Das Bestehen dieses Sachverhalts ist so evident, dass er eines Beweises weder fähig noch bedürftig ist. Worin aber gründet der Sachverhalt, dass ein Sachverhalt nicht zugleich bestehen und nicht bestehen kann? Das Materiale, das SoseinSosein der betreffenden Seienden scheint keine Rolle zu spielen, das WiderspruchsprinzipWiderspruchsprinzip ist in Bezug auf morphische EinheitenEinheitenchaotische, zufällige, morphische ebenso gültig wie in Bezug auf innerlich notwendige EinheitenEinheitenchaotische, zufällige, morphische. Beispielweise kann der Sachverhalt mit absoluter GewissheitGewissheit erkannt werden, dass der vor dem Fenster stehende Baum nicht zugleich belaubt und nicht belaubt sein kann. Diese ErkenntnisErkenntnis ist absolut gewiss, obwohl weder der Baum noch das Laub in notwendigen EinheitenEinheitenchaotische, zufällige, morphische gründen. Beide gründen in sinnvollen, aber nicht notwendigen, in morphischen EinheitenEinheitenchaotische, zufällige, morphische. Gründet die Gewissheit demnach in den oben angesprochenen formal necessary features? Oder ist das Widerspruchsprinzip letztlich bloss analytischanalytisch? Im Gegenteil, dass etwas nicht zugleich existieren und nicht existieren kann, ist „alles andere als analytisch“, es ist „ein prototyp synthetischer Urteile“.5 Diese TheseThese begründet von HildebrandHildebrandDietrich von mit dem folgenden ArgumentArgument: „Wäre es [sc. das Widerspruchsprinzip] selbst analytisch, eine blosse Wiederholung, die nichts über die WirklichkeitWirklichkeit sagt, auf die sie sich bezieht, so wäre es unmöglich, festzustellen, ob irgendein UrteilUrteil tautologisch ist.“6 In sich ist das Widerspruchsprinzip eine materiale WahrheitWahrheit. Auch in der LogikLogik oder der Ontologie ist der WiderspruchWiderspruch von Wahrheit und Nichtwahrheit, von Sein und Nichtsein ein materiales Prinzip. In allen anderen Erkenntnisgebieten hat es jedoch einen „formalen Charakter, weil es nicht in der jeweils das Thema bildenden spezifischen NaturNatur der Gegenstände gründet, sondern in dem Gehalt des Seienden, der für alle diese Seinsbereiche schon die stillschweigende Voraussetzung ist“7.
Wie wiederholt gesehen, ist es dem philosophischen ErkennenErkennen – zumal so, wie es der vorliegenden Untersuchung zugrunde gelegt wird – nicht um die formalen Voraussetzungen der Erfahrung zu tun, sondern um das Verhalten der innerlich notwendigen Gegenstände, die ein absolut gewisses Erkennen und ein VerstehenVerstehen von innen her ermöglichen. Dass die ImmanenzImmanenz des eigenen Bewusstseins bei der Erlangung einer philosophischen ErkenntnisErkenntnis transzendiert wird, zeigt sich an der Unerfindbarkeit. Was einen Charakter innerer NotwendigkeitNotwendigkeitsubjektive und höchster IntelligibilitätIntelligibilität besitzt, kann unmöglich eine subjektive ErfindungErfindung oder eine blosse ErscheinungErscheinung sein.8 Bei der Erkenntnis eines notwendigen Sachverhalts wird die Immanenz des eigenen Bewusstseins ebenso transzendiert wie der Bereich des sinnlich Wahrnehmbaren.