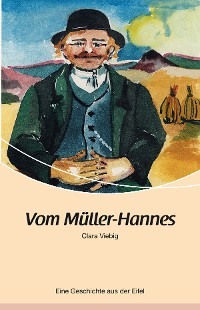Kitabı oku: «Vom Müller-Hannes», sayfa 2
»O je, ich kennen Dich,« schien sein Blick zu antworten. Müller-Hannes nickte, lässig zwar nur und leichthin, aber er grüßte doch: »Dag, Seph!«
Sie grüßte nicht wieder, sie war wie erstarrt. Mit offenem Munde sah sie ihm nach. Und sie hörte die junge Frau fragen:
»Wer is die?«
Und ihn antworten:
»Dat Landscheids Seph, hei aus’m Dorf! Dat es ehs mei Mädche gewest!«
Er sagte es recht laut; die Frau neben ihm zuckte, unangenehm berührt, heimlich zusammen. Und das Mädchen hinter ihm zuckte auch; Seph hätte aufschreien mögen vor Schmerz, Wut, Empörung und zugleich doch vor Freude, ja vor Freude: verleugnet hatte er sie wenigstens nicht, seiner Frau es ins Gesicht gesagt!«
»Dat Seph es ehs mei Mädche gewest« – das hörte sie die ganze Nacht. Das war doch wie eine Genugtuung. Aber dann durchfuhr es sie plötzlich schmerzhaft, gleich einem Stich: sie hatte es wohl gesehen, wie kurz auch die Begegnung gewesen war, sie hatte es gesehen, mit dem einen, alles unfassenden Blick – seine Frau war in Hoffnung!
Aber nicht nur Landscheids Seph warf sich diese Nacht hin und her auf ihrem harten Laubsack, auch die junge Müllerin fand keinen Schlaf in dem hochgetürmten Ehebett. Hannes schnarchte schon längst, da drehte und wendete sie sich noch in Herzensangst. Was war das für ein schwarzes Weibsbild gewesen mit bösen Augen?! Die war einmal ihres Mannes Schatz gewesen?!
»Och Jesus!« Sie stützte sich auf den Ellbogen und beugte sich so, halb aufgerichtet, fragenden Blickes über den Schlafenden. Der Mond warf ein falbes Licht in die Stube. Wenn sie doch jetzt in seinem Gesicht lesen könnte! Was war gewesen, was würde noch alles sein?! Sie seufzte. Ihn am Tage zu fragen, wagte sie nicht. Nicht, daß sie nicht zufrieden mit ihm gewesen wäre – o nein, es ging ihr ja sehr gut, das konnte sie ihrem Vater versichern in jedem Brief, das konnte sie sich selber versichern, und auch der lieben Mutter Gottes dort überm Weihwasserkesselchen – ihren Hannes wollte sie nicht verklagen, nein, der war nun mal so! Und doch machte ihr manches Sorge. Wenn der Hannes nur nicht so leicht mit dem Geld wäre! Neulich war er zur Dauner Kirmes gewesen, da hatte er Bekannte und Unbekannte traktiert: »trinken sollten sie, so viel sie wollten« – und das war viel – und hernach, als sie schrien: »Vivat dän Müller-Hannes! Hoch soll hän läwen hoch, hoch, hoch!« da hatte er noch ein paar Flaschen »Schambannijer« spendiert. So hatten sie es ihr erzählt; sie selbst fuhr jetzt nicht mehr mit auf die Kirmessen – ach je, ihr war es jetzt oft recht elendig! Die Brauttränen müssen geweint werden; die Braut, die sie nicht vor der Hochzeit weint, muß sie danach weinen – ach, sie hatte keine Brautträne geweint, keine einzige! Aber jetzt –?!
Seufzend zog sie die Stirn in Falten und drückte das Gesicht ins Kissen. Still nur, still! Sagen ließ er sich ja doch nichts. Und »das Weib hat’s Maul zu halten«, hatte ihr erst letzthin der Schwiegervater gesagt, als er kam und sie gerade saß und weinte.
Das junge Weib wühlte den Kopf immer tiefer ein; dann warf es sich rastlos.
Derweil träumte der Mann schön: ihm war der erste Sohn geboren, ein Knabe, groß und stark. Pfarrer Noldes von Maarfelden taufte ihn – »Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes …« tauchte den Finger ins Taufbecken, bespritzte des Kindes Stirn – da schrie der Knabe so durchdringen auf und strampelte so mit den Beinen, daß der erschrockene Pfarrer zurückfuhr und alle Paten lachten. So ein Filou, wahrhaftig, der wußte schon, was ihm gebührte! Solch einen Jung’, einen Sohn vom Müller-Hannes, den tauft man nicht mit purem Wasser, aus dem dreckigen Bach, aus dem alle Leut’ schöpfen!
Als der Müller am anderen Morgen erwachte, stieß er sein Weib an, das erst bei Tagesgrauen Schlaf gefunden hatte, und erzählte lachend seinen Traum. Das war ein Jung’! Schon im voraus war der Vater ordentlich stolz auf ihn.
Da sagte Tina schüchtern:
»Wann’t äwer nur e Mädche is?!«
Er sah sie an, als verstände er sie gar nicht, und dann wurde er grob:
»Maach! Onnerstieh Dech! Ech will en Jong haon, ech muß en Jong haon! Hörste? Dän soll de Mühl’ ärwen!«
[2]. gout
3.
Die Mühle lag am Bach, der sich aus den Abflüssen des Maares bildet und sich durch den schmalen Wiesenrain des engen Tales der Kleinen-Kyll zuschlängelt. Wenn das Maar hochstand und die Wiesen der Bauern überschwemmte, dann stürmte auch der Bach breit dahin, daß sich das große Mühlrad schwungvoll drehte. Aber wenn das Maar sich zurückgezogen hatte in seine geheimnisvolle Tiefe, eingesunken war wie ein Auge, das sich, alt und müde, schließen will, dann sickerte der Mühlenbach lässig dahin. Dann feierte das Rad. Der Herr feierte und die Knechte auch. Auf dem Lotterbett der Mahlstube dehnten sich die weißbestäubten Jungen, blinzelten träge nach den Mehlstäubchen, die im Sonnenlicht tanzten, und rissen gähnen das Maul auf. Es kam erst Leben in sie, wenn der Herr draußen rief: »Angespannt, ech faohren eweil!« Was? Der fuhr schon wieder aus?! No ja – die Burschen lachten sich zu – dann konnten sie ja auch im Dorfwirtshaus einkehren und die Seph karessieren, so sich die sehen ließ.
Wenn die runden Pferdchen mit dem leichten Wägelchen davongetänzelt waren und der Herr mit der Peitsche noch einmal lustig zurückgeknallt hatte nach dem verschlossenen Fenster der Wohnstube, stahlen sich auch die Knechte vom Hof; und die Magd folgte.
Einsam war die Mühle. Die starke Herrenstimme, die das Haus vom Giebel bis zum Keller füllte und muntere Nachklänge in allen Winkeln erweckte, tönte wo anders. Das leise Zittern und Schwanken der Dielen, das Schlagen und Pochen und Schaufeln des Rades hatte aufgehört: das Herz der Mühle stand still. Dann ging Frau Tina wohl hinaus aus der Stube, ums Haus herum bis zum Mühlgraben, stand mit hängenden Armen eine lange Weile und besah sich das stille Rad. So kolossal hing das da – ach, ihre Hände waren zu schwach, um in seine Speichen zu greifen! Sie konnte es nicht antreiben, es war ja so groß und schwer. Ach, wenn es sich doch wieder drehte! Wie anders sah es aus, wenn seine breiten Schaufeln wie rührige Hände ins Wasser faßten, immer wieder und wieder, und sich einen Gischt übergossen, einen perlenden Guß nach dem andern, der immer weißer und weißer wurde, leuchtend wie Schnee, hervorschäumend aus grünlichen Tiefen. Wie schön war das Rauschen und Brausen; die Musik, die hörte sie gern!
Daß mit dem Stillstehen des Rades auch das Surren und Brummen der Kreissäge verstummt war, schaffte ihr weiter kein Leid. Die machte ja keine Musik, wie das große Mühlrad im schäumenden Wasser, die schnurrte und kreischte ihr nur widrig in die Ohren.
Wenn nur die Kreissäge nicht wär’– die gab ihm immer die Ausrede! Bald mußte er zur Holzversteigerung – jetzt in den Gemeindewald, dann in den königlichen Forst – bald hierhin, bald dorthin; vor Morgengrauen brach er schon auf und kam längst nach Mitternacht erst wieder heim. Und dann mußte er hinunter an die Mosel, Aufträge einsammeln für seine Kreissäge, für das vielfräßige Ungeheuer mit den scharfen Zähnen; nie war genug Futter für das da! Bis an den Rhein gar, plante er, wollte er nächstens fahren, das Geschäft so erweitern. Jetzt blieb er schon Tage aus o je! – und dann am Ende gar noch länger! Und immer wurde getrunken. Das ist bei Geschäften nicht anders. Und immer war er der erste dabei, der Lustige, der Spendable!
Die junge Frau sah sich besorgt um: es lagen der Bretter so viele aufgestapelt, fast so hoch wie das Haus. Als wenn die alle schon einen Käufer gefunden hätten! In diesen schönen, glatten Brettern, die das weiße Fleisch der Bäume entblößt zeigten und noch den Duft des Waldes an sich hatten, steckte viel Geld, ein ganzes Kapital. Dabei hatte der Vater doch letzt geschrieben, heuer seien die Ernteaussichten schlecht an der Mosel; die Reblaus war drunten, es half kein Bespritzen und Gießen mehr mit dem und jenem, was der Herr Landrat verordnet hatte – da brauchten sie nicht viel Fässer.
Sie ging um die Stapel herum und betrachtete sie ängstlich unter hochgezogenen Brauen: wer sollte all das Holz kaufen?! Der Hannes hatte bar bezahlen müssen bei der Versteigerung – aber wer zahlte ihm? Die Kunden, die ihr Korn bei ihm mahlen ließen, zahlten meist nicht bar Geld, die gaben einen Molter vom Sack.
Ach, wenn der Hannes nur nicht so viel Holz kaufen möchte! Das wäre er seinem Renommee schuldig, sagte er, ordentlich einkaufen müßte man.
Sie fühlte hier an und dort an: hu, schon klamm, feucht! Und wenn all dies Holz nun hier liegen blieb, bis der Spätherbst kam mit seinen Regengüssen, und Berg und Grund vor Nässe trieften?! Wenn die durchdringenden Nebel alles bis ins Innerste aufweichten!? Wenn der endlos lange Eifelwinter kam, der weiter nichts kann als Schnee herunterschütten oder mit eisigem Frost alles zusammenpressen, daß es knackt und in sich reißt?! Wenn dann hier die Bretter Spalten und Fugen wiesen oder moderten und faulten, wer gab dann nur halb das Geld dafür, das sie gekostet?!
Frau Tina schüttelte betrübt den Kopf. Wenn der Hannes doch hören wollte, um was sie ihn bat: »Laß doch e Dächelche drüber ufschlaon!« Ausgelacht hatte er sie: wie konnte er wohl über so viel Bretter ein Dächelchen schlagen lassen? Bis Herbst waren die ja auch längst verkauft! Ein Schuppen hätte ihm freilich angestanden, vorzüglich fürs Chaischen, das jetzt notdürftig untergebracht war; aber wohin sollte er den setzen? Platz war nicht, gerade daß das Wohnhaus und der Stall sich eingequetscht hatten zwischen dem Bach und der Böschung der Landstraße; den Hofraum brauchten die Wagen, schwer genug war das Wenden zwischen Hauswand und Holzstapel. Als sie ihm den Platz vorgeschlagen, den das Gärtchen am Ende zur Not doch bot, war er heftig geworden.
»Ons’ schien Gärtche? Dat es mein Pläsier! Dat laoßen ech mer net verfumfeien!« Und er hatte wieder neue Rosenstöcke aus Trier kommen lassen und allerhand feines Gesäms, das nicht aufging.
Nein, die Rosen würden hier nie blühen! Tina ging in den Garten und richtete ein Stämmchen auf, das der Eifelwind umgestoßen. Sie suchte einen Bast, daß sie es anbinde, aber da wurde sie gewahr, es war eingeknickt, gebrochen in der Wurzel. Den Bast ließ sie fallen, und in einer plötzlichen Traurigkeit kehrte sie sich ab – dem half kein Anbinden mehr!
Die Sonne, die bis dahin noch geschienen, war hinter den Berg gesunken. Schatten düsterten im Tal. Wenn’s auch noch Sommer hieß, man dachte doch schon an Herbst. Fröstelnd ging die einsame Frau zwischen den Beeten auf und ab und suchte nach einigen Blumen. Viele fand sie nicht, die Beete waren verrast, Unkraut machte sich breit; das grüne, klammernde Moos, das so geschwind im Feuchten gedeih, fing schon an, den Pfad zu überziehen. Von der Brennenden Liebe, die sie im ersten Mai ihrer Ehe miteinander gepflanzt, blühte kein voller, rotglühender Busch mehr, nur noch ein einziger Stengel. Rasch knickte Tina den ab, er sollte vorm Muttergottesbild prangen.
Jesus, wie sah es hier bös aus! Geld genug hatte der Garten gekostet, aber da war keiner, der ihn in Ordnung hielt. Sie sah an sich herunter und streckte die schmalen Hände aus – graben und jäten, ja, das war keine Arbeit mehr für sie! Ach, seit einem Jahr nicht mehr! Die Geburt des kleinen Mädchens hatte sie schwach gemacht.
Sie mußte es doch dem Hannes sagen, daß der den Garten in Ordnung brachte – aber nein, nein, lieber nicht! In Ordnung bringen, das hieß für ihn: Arbeiter bringen, alles Alte herausschmeißen und Neues einsetzen lassen. Es mußte schon so bleiben.
Niedergeschlagen verließ die Frau den düstern Garten; sie hatte sich lange verweilt. Am Mühlengraben kam sie wieder vorbei – es rührte sich nichts – da hing noch immer das leblose Rad. Sie mochte es gar nicht mehr ansehen; ihr wurde so bang. Ein Lied, das sie oft in der Heimat gehört, schoß ihr auf einmal durch den Sinn:
»Da drunten in dem tiefen Tale,
Da steht eine Mühle zum mahle –«
und weiter?!
Mit einem scheuen Blick sah sie sich um.
»Das Mühlrad, das große, das Mühlrad blieb stehn,
Ach Gott, was ist in der Mühle geschehn?!«
Die Schatten dunkelten tiefer. Wie gejagt flüchtete die Frau in die Stube, wo das kleine Mädchen lag und greinte, setzte den Fuß auf die Schwinge der Wiege und brachte sie in Bewegung. Sacht schaukelte die hin und her und lullte das Kind wieder ein; aber die Gedanken der Mutter kamen so rasch nicht zur Ruhe.
Die Nacht sah finster zum Fenster herein. Wenn doch der Hannes bald wiederkäme! Tina hörte die Knechte endlich heimkehren, sie hörte deren Pfeifen im Hof; die Magd, die mit rasselnden Eimern zur letzten Melke ging, juchzte hell auf. Sie neckten sich. Kein Lächeln umspielte den Mund der jungen Frau.
Als alle schon lange schliefen, wartete sie noch immer auf ihren Mann. Die Stunden wurden ihr zu Ewigkeiten. Der Kuckuck hatte schon viele Male den Kopf aus seinem Uhrtürchen gesteckt, nun schrie er schier ohne Aufhören. Zuckenden Mundes zählte die Frau: Jesus, schon zwölf, Mitternacht! Wenn er doch käme, sie war ja so allein! Da, horch, rasselte nicht fern ein Wagen?! In der Stille der Einsamkeit meinte sie vertrautes Räderrollen zu erkennen. Nun litt sie’s nicht länger, ihr Herz klopfte. Hastig schlüpfte sie aus der Stube. Leise öffnete sie das Türgatter halb und lehnte sich lauschend hinaus. Nichts war mehr zu hören, auch nichts zu sehen, nur gerade ein Stück Landstraße, vom Licht der Sterne schwach beflimmert; dahinter eine dunkle Höhe. Vor Enttäuschung traten ihr die Tränen in die Augen – er kam noch nicht! Doch halt, war das nicht ein Tritt?! Wer schlich da noch herum?!
Eine Gestalt wurde sichtbar: ein langes, großes Frauenzimmer stand an der erhöhten Böschung der Straße, unbeweglich das Gesicht, das wie ein heller Fleck durchs Dunkel schimmerte, der Mühle zugekehrt. Auf wen lauerte die, gewiß auf einen Knecht?!
Als Frau Tina, die endlich in die Stube zurückgegangen war, noch einer halben Stunde wieder in die Tür trat, stand die unbewegliche Gestalt noch immer drüben auf der Landstraße. Tina wurde neugierig; sie faßte sich ein Herz und rief in die Nacht hinaus:
»’n Abend, auf wen wart’ Ihr dann hei?« – »Hä, uf mein Schatz!« – »Ach herrje!« Die junge Frau fühlte sich plötzlich hingezogen – warten, ach, das ist ein schlechter Zeitvertreib! »Geht nur heim, de Knecht schlafen als lang: Ech glauben, eweil kömmt keinen mieh heraus für zu karessieren!«
»Ech waarten aach uf ke Karessiere mieh!«
Das klang merkwürdig bitter; und dann folgte ein hartes Auflachen, das Tina erschreckte. Auf was wartete die denn sonst jetzt so spät noch, auf was anders als auf ein heimliches Stündchen, von dem niemand nichts weiß?! Die stand ja so erwartungsvoll, hatte die Arme übers Kreuz geschlagen und guckte unverwandt zum Haus hinüber. Tina glaubte den brennenden Blick jener Augen zu fühlen. Was wollte die denn? Ach, am Ende hatte der Schatz sie verlassen, und sie gedachte nun, ihm hier aufzulauern.
»Se sein all im Bett,« versicherte sie noch einmal treuherzig, und dann setzte sie teilnahmsvoll hinzu: »Jao, Jao, so sein die Mannsleut’! Ech raten Euch gut, laßt hän laufen. Ihr krieht en annern!«
»Spaort Eier Red’ – ech will ken annern!« Die Große fuhr auf und reckte sich, und dann streckte sie plötzlich den Kopf vor und schien mit geneigtem Ohr zu lauschen. »Dän Müller es net derhäm?« Sie fragte es, aber sie schien keiner Antwort zu bedürfen.
Tina stutzte. Der Müller, ihr Mann, freilich, der war nicht zu Haus, aber was ging das die an, warum fragte die? Eine plötzliche Unsicherheit übefiel sie, eine jähe Furcht – wovor, das wußte sie selbst nicht. Die Nacht war so düster, in den Lüften schien es zu seufzen; drohend ragte gegenüber der dunkle Berg, und die Große stand unbeweglich mit lauschendem Ohr.
»Gieht, gieht!« sagte die junge Frau hastig, »ech giehn eweil auch un legen mich hin.« Sie machte Anstalt, die Tür zu schließen, aber sie sah, die andere ging doch nicht weg. »Gieht heim, strolcht hei net mich herum. Ihr hatt hei nix verloren – gieht doch!« Ihre Stimme wurde scharf vor Ärger und Unruhe.
Die Große lachte wieder; kam dann ein paar Schritte näher. »Ech wünschen Eich en gude Ruh. Schlaoft wohl – allein!«
Trotz der Dunkelheit sah Tina ein paar wilde Augen funkeln, weiße, rollende Augäpfel und ein sprühendes Flackern. Angst kam sie an in der einsamen Nacht, sie stotterte: »Den Müller – den Müller – den is jao zu Haus, den liegt schons im Bett!«
»Ha, ha, wän’t glauwt! Ech net. Dän fährt eweil noch im Chaische. Läjt Ihr Eich eweil noren ganz kommod; ech waarten noch ebbes. On wann de Naacht drüwer zu End gieht, on de Sonn drüwer erufkömmt, on de Welt drüwer onnergieht« – die Worte überstürzten sich ihr –, »on wann alles kaputt gieht, on wann hän mech schlät – ech, ech haon noch en Rechnung met em ze maachen! On wann et währt bis zom Jüngsten Dag, heimgezaohlt krieht hän dat doch emaol. Wann net von mir, dann von’m annern! Waart dau«, – sie ballte die Faust und drohte in die Ferne – »waart!«
»Jesses!« Zu Tode erschrocken zitterte die junge Frau.
Da, von ferne Räderrollen! Sie horchten beide. Jetzt kam er!
»Hannes«, schrie Tina laut und sprang gegen den Wagen an.
Der Müller, der fest geschlafen hatte – die Pferde waren des Weges sicher –, fuhr auf aus seinem sanften Dusel. Seine Frau hing ihm schwer am Arm. Was war denn passiert, he, was denn?! Brannte es wo, kam die Maarfrau gelaufen und wollte sie beim Schopf fassen?!
Tina konnte nicht sprechen, sie war zu erregt. Den Arm nur streckte sie aus und wies ihm die Große, die noch immer dastand wie angewachsen.
»Kotzdonner, dat schwarz Luder!« Hannes riß die Augen weit auf: was, die jetzt bei Nacht und in der Positur?!
Sie sah ihn an, als wollte sie ihn umbringen.
Da nahm er seine Frau recht fest in den Arm, Landscheids Seph brauchte nicht zu denken, daß er sich vor ihr genierte.
»Tina, no, sei rohig,« tröstete er; und dann drehte er sich der andern zu und sagte ganz unbefangen: »’n Aowend, Seph! No, wat michst dau dann hei noch eweil esu spiet?«
Sie erwiderte nicht und rührte sich auch nicht, blickte ihn nur unverwandt an mit ihren schwarzen Augen.
Er lachte hell auf: »No, wat dann? Willste wat?«
Was sie wollte?! Was, was, er fragte noch?! Durch die starke Gestalt des Mädchens lief ein Beben. Da stand er, breit und frech, er, der sie verlassen, schlug nicht die Augen nieder, sondern lachte! Lachte!
Mit der einen Hand hielt er seine Frau, die andere hatte er in die Hosentasche gesteckt; die Pferdchen guckten ihm über die Schulter. Im Sterngeblinzel leuchtete hell sein rundes, blondes, lachendes Gesicht.
Seph wollte sprechen, schreien, schelten und konnte nicht. Der Mund war ihr plötzlich wie zugehalten. Nur ein kurzer heiserer Laut kam ihr aus der Kehle, anstatt all der langen lauten Vorwürfe, die sie ihm hatte ins Gesicht schleudern wollen. Sie boste sich. Also dafür hatte sie ihm aufgelauert seit Tagen, Wochen, Monaten, war hier ruhelos oft um die Mühle geschlichen, hatte ihm nachspioniert bei Tag und Nacht?! Also dafür hatte es ihr keine Ruhe gelassen, der Wunsch sie verzehrt, ihm nur einmal, ein einziges Mal noch gegenüberzutreten, daß sie jetzt, nun sie ihn so nahe vor sich hatte, wie sie es gewollt, Auge in Auge, nichts von all dem herausbrachte, was sie ihm sagen gewollt?! Eine ohnmächtige Wut überkam sie, gegen ihn, gegen sich selber am meisten – ei, warum stand sie denn hier und ließ sich zum Narren halten?!
Stumm reckte sie den Arm gegen ihn.
»Kreizdonnerparaplei, Mädche, biste dann eweil ganz doll,« sagte er belustigt. Und auch die Frau wagte jetzt ein leises, verlegenes Gekicher.
Da fiel dem Mädchen der Arm wie gelähmt herunter. Es hörte nicht mehr das gutmütige: »No, no, Seph! Gieh eweil schlaofen, maach der doch net esu vill Ambra[3]!« Mit einer letzten Willensanstrengung kehrte es sich kurz ab und rannte davon.
In die Nacht hinein lief Seph, so rasch, wie sie noch nie gelaufen war. Hinter sich glaubte sie den Hannes lachen zu hören und seine Frau dazu – nein, die waren es doch nicht mehr, das waren die Stimmen der Nachtvögel, die ums Maar strichen! Und aus der Tiefe klagte es.
Sie stolperte und fiel hart nieder beim Steinkreuz und blieb liegen und vermochte sich nicht aufzuraffen, so müde war sie auf einmal; ganz zerbrochen. Das, auf was sie gelauert all die Zeit, auf das sie gehofft hatte mit einer peinvollen und doch lustvollen Gier: der Augenblick war dagewesen, und sie hatte ihn ungenützt verstreichen lassen.
»O, ech dumm Fraumensch, wuh hatten ech dann mei Maul?!« Mit beiden Händen griff sie sich in die langen Haare und riß daran, und dann schlug sie sich ins Gesicht. So hätte sie ihm ins Gesicht schlagen sollen und ihn anspucken dazu! Tränen des Grimms und der Beschämung zugleich fingen an ihr übers Gesicht zu laufen. Ja, nun konnte sie nur von Maarfelden gehen, sie hatte verspielt. Was sollte sie denn noch tun?! Ihm fluchen?! Sie hatte ihm schon geflucht, und doch lebte er froh, lachte er froh – aber wart, der Herrgott oben im Himmel würde doch eine Einsicht haben und guterletzt dem Hannes austeilen, was der sich selber verdient!
»Waart noren, waart!« Sie packte in ihr Kleid an jener Stelle, wo es das unruhig pochende Herz deckte. Fest stemmte sie so die Faust gegen das dumme zuckende Ding. Nur Geduld! – Ha, und lachen wollte sie dann dazu, lachen! – Und doch wälzte sie sich jetzt im taunassen Gras und biß sich auf die Faust, um nicht laut herauszuheulen. – –
Vom Dorf her kam verschlafener Hahnenkraht; über der nackten Höhe im Osten begann ein schwachrötliches Glimmern, und der Kranz der Berge ums Maar ward dämmernd sichtbar, als sie endlich aufstand. Einen finsteren Blick schickte sie zum Dorf, zum blauen spitzen Dach des Kirchleins, zu den dunklen Hütten und Hüttchen, die sich um das weißgetünchte Gotteshäuschen scharten. Wie traurig, wie armselig! Hei, wo anders war es leicht besser!
»Noren Kurasch on net esu duß[4], eweil krieht mer Pläsier!«
Sie warf den Kopf in den Nacken, schüttelte ihre Röcke und biß die Zähne aufeinander, – was nun kam, das kam auch noch auf des Hannes Rechnung!
[3]. embarras
[4]. doux = hier im Sinne von: verzagt.