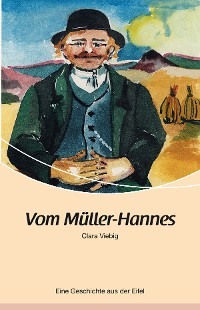Kitabı oku: «Vom Müller-Hannes», sayfa 3
4.
In dem vormals Landscheidschen Haus wohnte der Müller-Matthes nun schon an ein halb Dutzend Jahr. Er hatte es sich hübsch herrichten, die Stube dielen und die Kammer weißen lassen und seiner Frau einen neumodischen Kochherd gesetzt, statt des aus Steinen gemauerten mit dem rußigen Rauchfang darüber. Klare Glasscheiben waren in die Fenster gekommen, statt der trüben und papierverklebten; die alte, wurmstichige Tür, die gar keine Farbe mehr gewiesen, war einer neuen, frischgestrichenen gewichen mit blanker Klinke. Der Gartenwinkel zum Maar hinaus, über den das Vieh frei getrampelt, die Hunde und die Dorfkinder gelaufen waren, hatte einen schützenden Zaun bekommen, und in der Mitte, zwischen Stiefmütterchen-Rabatten prangte eine riesige Glas-kugel, in der sich alles, die Menschen, die Berge, das Maar, goldig widerspiegelten.
Wenn der Landscheid selig, der oben am Hang auf dem Kirchhof moderte, jetzt einmal herunterkommen könnte, er würde sein Haus nicht mehr kennen. Auch die Seph, die aus dem Dorf gezogen war – die einen sagten: nach Trier zur Tant’, der Köchin von Hochwürden zu Mattheis, oder sonstwo in Dienst; die andern sprachen: auf den Bummel –, ja, wenn die noch einmal wiederkäme, die würde sich auch nicht mehr heimfinden. So schön war das Haus.
Ein gut Stück Geld hatte es aber gekostet, der alte Müller empfand die Lücke in seinem Geldkasten, den er unterm Bett stehen hatte; es waren eine Menge Taler daraus fort und macher Papierschein. Und wenn’s nur das wäre! Aber was der Junge noch immer für ein Geld brauchte! Nun hatte der die Mühle und die wohlhabende Frau – reich könnt’ man die nennen, wenn die Weinjahre besser wären, aber sicher hatte sie genug mitgekriegt – und doch kam der Hannes in eins fort: »Vadder, leih’ mer ebbes! Vadder, ech brauchen hunnert Dahler! Vadder, ech sein justement in Verläjenheit! Vadder, dän on dän haot noch net sein Mahlschulden bezaohlt; äwer ech kann de Leut’ doch net pfände laoße! – Vadder, ech moß Gäld haon für dän Momang, dat siehste doch ein. Ech muß et haon für’t Geschäft zu bedreiwen, on – on aach sons noch. Ech kann doch net esu power ufdreten. Gel, Vadder, dau bis esu gut on hilfst mer aus der Bredullich?!«
Was sollte der Alte machen? Wenn sein Hannes so bat, wurde ja der störrichste Gaul zahm. Und den Jungen in der Verlegenheit sitzen lassen, das ging doch nicht an; dann würden die Leute gleich sagen: »De Mühl es neist mieh wert, dat gieht eweil net gud!« Ja, die waren immer bereit zu klatschen, weil die »powre Packasch« scheel sah aufs reiche Müllergeschlecht!
So zog der alte Müller immer wieder seinen Kasten unter dem Bett vor, und der junge Müller dachte, der Schatz könne nie ein Ende nehmen. Er hörte gar nicht hin, wenn sein Vater brummend und grummelnd dabei redete, er pfiff sich eins, und wenn er’s Geld hatte, war er flott. Hallo, das flog nur so unter die Leute.
Da war ein Mann zu Bleckhausen, dem hatte er längst ein Darlehen versprochen; und da war ein Weib zu Bettenfeld, dem war der Mann letzthin verstorben, und die Kinder kauten Hungerpfoten. Und da war ein Mädchen zu Wittlich, ein liebes Ding, dem hatte er versprochen was hübsches zu kaufen, wenn er’s nächste Mal wiederkam – wie, war er denn nicht der reiche Müller-Hannes?! Der Küster hielt ihm den Klingelbeutel immer länger hin als anderen – der wußte ja genau, der Müller-Hannes gab keinen Buxenknopf – und Pastor Cremer, das arme Männchen, das selber nichts hatte, kam bei ihm bitten für die Bedürftigsten der bedürftigen Gemeinde. Blicken sie nicht alle zu ihm auf, wie zum lieben Herrgott?! Wahrhaftig, er konnte sich nicht lumpen lassen! –
Heut war ein Fasttag. In der Mühle schrie der Kuckuck lustig die Mittagszeit; sie hatten zu den Kartoffeln Forellen aus dem Bach und Pfannekuchen für die, die noch nicht satt vom Fisch wurden. Es gab reichlich, aber die Knechte hieben auch gewaltig ein, und die kleine Tochter mit den Pausbacken stopfte sich mit beiden Händen den Mund voll.
Der Müller saß oben am Tisch, dick und satt. Sein rundes Gesicht war noch runder geworden, zu rund; zu völlig ließ sich seine Figur an. Ein leerer Krug stand vor ihm, bequem hob er ihn gegen seine Frau: »Tina, noch e Schöppche! mer krieht Dorscht vom Mehlstöb!«
Sie wollte Wein holen, da schrie er hinter ihr her:
»Bleiwste hei?! Laoß doch dat Lena laufen, wofor haste dann en Magd?!« Das fehlte noch, die Frau sollte selber in den dunklen Keller gehen?! Zudem hieß es ja, wenn man selber so viel arbeitete, dem armen Volk das Brot wegnehmen.
»Esu es et rächt,« sagte er frohgelaunt, als die Magd ihm den vollen Krug hinstellte, und kniff sie in den braunen Arm. »Dau solls aach ehs ene Mahn ganz for dech allein kriehn, Lena!«
Das Mädchen kicherte, und die Knechte grinsten. Die kleine Fränz fing an, als sie alle lustig sah, um den Tisch herumzuhüpfen auf einem Bein und jubelnd in die Hände zu klatschen:
»Eins, zwei, drei,
Nicke, nacke, nei …«
Da klopfte es an die Tür.
»Angtree,« sagte der Müller, und die Knechte drehten die Köpfe. Es war so viel Sonne in der Stube, daß alles in Glanz und Gold getaucht war.
Draußen stand ein Mann.
»Um Gottes willen,« sagte der und streckte, eine Gabe heischend, die Hand aus. Er war arg zerlumpt, Dorfhunde hatten seine Hosen zerfetzt, sein Gesicht war gelb und hager.
»Noren erein,« schrie der Müller, »kommt als noren erein, hei es zu äßen genug!« Jedoch, als er auf die Schüsseln wies, waren sie alle leer, kein Bröselchen mehr darin. »Dunnerkiel« – war das eine Verlegenheit! Aber dann fing er an, so mächtig zu lachen, daß sein ganzer Riesenkörper schütterte und die Stube dröhnte; er hielt sich die Seiten, und dann klatschte er auf die Knie: »Haha, alles ufgefräß! Haha, hoho!«
Der Bettler, von dieser laut ausbrechenden Heiterkeit verlegen gemacht, drehte sein hungriges Gesicht von einem zum anderen und wagte sich nicht näher. Da riß ihn der Müller an den Tisch: »Esu, setzt Eich eweil!« – und dann schrie er: »Tina, Tina!«
Die Frau kam aus der Küche gelaufen.
»Tina, gief dem Lena de Schlüssel. Im Rauch hängt en Schinke, dän giehste nehme, Mädche, on bringst hän heihin – wit, wit!«
»Et is heut Fasttag,« wagte die Frau einzuwenden.
»Äh wat, Fastdag oder net, dat schärt mech en Dreck. Dau wills nur dän Schinke net spendiere – Frauleider[5] seien alleweil knahschtig[6]. Ech saon der: här mit dem Schinke, mir haon des jao genug. On laoß Eier in de Pann schlaon! On Brod her! Dän Mahn soll net saon, dat hän hei net saot krieht!«
Es machte Hannes ein Hauptvergnügen, den Landstreicher recht vollzufüttern. Der konnte ihm gar nicht genug essen. Er saß dabei, die Ellbogen aufgestützt, und sah zu mit glänzenden Augen, wie es dem Hungerleider schmeckte.
»Äßt nor, äßt,« drängte er. »Gel, esu lecker hatt Ihr lang net gäß?« Erklopfte dem Bettler auf den Bauch: »Eweil is dän dick – jao, dat glauwen ech! Wann Eich de Leit fraon, dann saot nor: beim Müller-Hannes zu Maarfelden, lao es et gud sein.«
Als der Bettler gegangen war, seine armselige Gestalt und die barfußen Beine um die Wegbiegung verschwunden waren, stand Müller-Hannes noch lange in seiner Tür und ließ die Blicke rundum gehen. Was hatte er nicht alles?! Eine stattliche Mühle, Pferde im Stall, Kühe auf der Wiese, Wein im Keller, Schinken im Rauchfang und Forellen auf dem Tisch! Er pfiff hinter dem armen Teufel drein in unsäglichem Behagen.
Dort ritt ein Knecht die Pferdchen, die glatt und kugelrund gefüttert waren, in die Schwemme. Die große Dogge, ein Prachtexemplar, die Hannes sich jüngst um ein paar hundert Mark auf der Hunde-Ausstellung zu Koblenz erstanden, sprang tief belfernd um die Gäule herum und schnackte nach den hängenden Beinen des Reiters. Ja, der Nero hatte schon viel Hosen zerrißen – Hannes lachte – aber was taten die paar Mark, er war doch ein Staatstier!
Der Müller pfiff dem Hund. Der kam mit einem mächtigen Satz, sprang hoch und legte die breiten Tatzen auf die breiten Schultern seines Herrn; die rote dampfende Zunge hing ihm lang zum Halse heraus.
Das war ein Närren: »Fass’, Nero, fass’! Kätzchen … kß, kß, kß!« Wild sprang das junge, noch tolpatschige Tier im Hof herum. Gackernd stoben die Hühner nach allen Seiten; die Sperlinge, die sich’s am verstreuten Korn wohl sein ließen, flüchteten auf den höchsten First, der Stüpp riß kläffend an der Kette und wollte auch mit vom Spiel sein, im Stall entstand ein Brüllen und Muhen, ein Grunzen und Meckern. Die kleine Fränz kam aus dem Hause gelaufen, suchte mit Gekreisch den Nero am Stachelhalsband zu packen und tollte mit ihm um die Wette. Ein Rumoren war’s, daß die toten Steine hätten lebendig werden können. Der ganze Hof war erfüllt von Lärm und Leben und praller Sonne. Breit stand Müller-Hannes in seiner Tür und lachte sich eins.
Da kam ein Wägelchen vorgefahren. Darin saß der Laufeld, oben aus Manderscheid, der reichste Mann in der Runde. Er hatte eine Hypothek hier auf der Mühle, schon seit Menschengedenken; wären nicht Zinsen zu zahlen gewesen, alljährlich auf Martini, so hätte Hannes die längst vergessen.
Langsam stieg der Laufeld vom Wagen; er wartete, bis der Müller ihm entgegenkam.
Da konnte er lange warten. Müller-Hannes zog erst einmal das buntgewürfelte Tuch aus dem Sack und schneuzte sich umständlich. Der da sollte ja nicht denken, daß es ihm pressierte; war der reich, so war er ja auch reich! Aber dann kam doch die gewohnte gastfreundliche Lebhaftigkeit über ihn; er litt nicht, daß der Laufeld nicht ausspannte. Kotzdonner, das wäre doch eine Beleidigung, wenn der Gaul nicht an seiner Krippe fressen sollte; der Hafer war vom besten!
Mit gewaltigem Ton schrie er nach der Frau:
»Tina! Kaffee, Schnaps, frische Waffeln!« Einen »Momang«, und alles würde parat sein!
Er führte den Gast in das gute Zimmer, wo Tina rasch den Linnenbezug vom Kanapee gerissen, über dem der junge Hannes, als flotter Kavallerist abphotographiert und hübsch bunt ausgetuscht, stolz auf einem sich bäumenden Schecken zu sehen war. Über dem Bilde war auf zwei langen Nägeln die Jagdflinte am grünen Ledergurt befestigt, mit der Hannes so manchem Rehbock den Garaus gemacht und als Junggeselle zu frohem Hillig und zu mancher Kirmes und zu jedem Neujahr geschoßen hatte. Aus ihr hatte er auch den eigenen Hillig wohlgemut den Bergen verkündet.
Draußen tummelten sich die Frau und die Magd in der Küche; ein Knecht wurde noch zur Hilfe gerufen. Der mußte rasch Holzkolben ins Herdloch stopfen und frisch anfeuern. Rahm wurde abgeschöpft und Eier geschlagen. Mit hochroten Wangen stand Tina am Feuer, und dabei ängstigte der Gedanke sie: was wollte der Laufeld vom Hannes?! Der kam nicht in guter Absicht! Sie hatte immer Angst.
Drinnen saß der Laufeld auf dem Kanapee, bequem angelehnt, und musterte die Einrichtung. Er war noch kein alter Mann, einer mit frischfarbenem Gesicht und blanken Augen, aber doch ein gut Stück älter als Hannes, und er sah auf diesen mit dem Übergewicht, das ein ganz solides Besitztum gibt. Müller-Hannes fühlte das und blies sich auf.
Sie redeten hin und her: vom Wetter, von der Ernte, von der Kirmes und vom Viehstand. Auch von der Politik.
Der Laufeld, der alle Morgen, wenn Manderscheid noch im Nebel dampfte, zur Messe ging, fleißig den Rosenkranz betete und reichlich für die verfolgten Hirten der Kirch gab, spuckte auf die Maigesetze: Kaiser und Bismarck, die kamen gleich hinter dem Leibhaftigen. Aber Hannes, der gleich nach dem Krieg seinem Kaiser gedient, schwärmte für Siebzig und den »von Bismarck«. Das war mal ein Großer!
Sie kriegten bald das Zanken. Jakob Laufeld war ein Verbissener, der kaum die Lippen voneinander brachte, nur ab und zu ein Wort fallen ließ, als lohne es ihm nicht recht vor dem Hannes, der nichts wert war, wie die Maarfeldener sämtlich. Selbst deren Pastor war nicht besser. Zuckten nicht der Herr Dechant und die anderen Amtsbrüder über Arnoldus Cremer die Achseln, der in niedergetretenen Bastschuhen lief und von dem man munkelte, daß er bei Nacht der Bauern Weiden am Maar abschnitt?!
Auf Maarfelden ließ Hannes aber nichts kommen, das war ja seiner Mühle benachbart. Und auf den Cremer, das arme Männchen? Ei, da sollte doch die geistliche Obrigkeit, die selber im Fett saß, den besser stellen! Wenn er, der Müller-Hannes, Beginn Winters dem Alten nicht eine Fuhre Holz vor die Pfarre schickte und ab und zu eien Sack Hobelspäne, müßte der ja frieren. Und das bißchen, was seine Wirtschafterin, das Engelche, für die Körbe erlöste, die er von den Weiden flocht, war ihm wohl zu gönnen, dem Noldes, dem spaßigen Männchen!
Den Laufeld, was er auch selber denken mochte, entsetzte doch diese respektlose Rede. Gut, daß jetzt die Magd mit den goldgeränderten Tassen kam und Frau Tina einen Berg frischer Waffeln hereinbrachte.
Da langte der Laufeld wacker zu und trank auch verschiedene Schnäpse; dann, als er so recht dick, satt und befriedigt war, legte er die flache Hand auf den Tisch und sagte:
»Jao, wat ech eweil noch saon wollt, ech kündigen Eich de Hippothek. Martini muß ech mein Gäld haon!«
Hannes sah ihn ganz verdutzt an. Hypothek … kündigen … zu Martini … war der Laufeld schon besoffen?! Die Hypothek, die schon seit mehr als zwanzig Jahren auf der Mühle stand?!
»Haha, hoho … hohoho!«
Aber Jakob Laufeld blieb ganz ersthaft, erhob sich und knöpfte seine Weste zu, die er sich während des Schmauses ein wenig gelockert.
»Seid esu freindlich, Müller, laoßt anspannen. Eweil faohren ech.«
»Bleiwt doch noch, bleiwt doch noch en half Stund,« nötigte der Hausherr. »Ech haon noch des Bernkastler im Keller, dän müsse mir doch ehs prowiere!«
Aber der andere bestand darauf, jetzt fortzufahren. Dem Knecht, der das Pferd gefüttert und nun das Chaischen vor die Tür brachte, gab er fünf Pfennig Trinkgeld. Dann, schon mit einem Fuß auf dem Wagentritt, die Peitsche in der Hand, drehte er den Kopf noch einmal herum und sprach so über die Schulter:
»Also uf Martini – eweil wißt Ihr’t. Bringt noren dat sälwer, et soll mer angeniehm sein. Ech haon aach des Bernkastler im Keller. Hä, willste ziehen, hahrü« – er schlug auf den Gaul – »adjüs! Bis Martini – gud Zeit!«
Fort rollte das Wägelchen, und Müller-Hannes sah ihm nach mit offenem Mund und weitaufgerissenen Augen. Er kam sich ganz dumm vor – was hatte der Laufeld gefaselt? Hypothek – fünftausend Taler?! Das waren fünfzehntausend Mark – ein gehöriger Batzen!
»Kreizgewiederparaplei!« Ach, das war ja alles ein dummer Spaß, warum sollte der ihm denn auf einmal die Hypothek kündigen?!
Da legte sich eine zitternde Hand auf seinen Arm. Er sah um: seine Frau stand bei ihm und schaute ihn aus ängstlichen Augen an.
»Ich han’t gehört – ach Jesus, Hannes –, den Laufeld kündt Dir de Hypothek – wie viel is et dann? Kannste se zahlen?«
»Nä,« fuhr es aus ihm heraus. Aber dann, als er ihre Angst sah, machte er sich groß: »No, leicht! Wat meinste dann, sein en Hongerlieder, dän net piep saon därf, wann annre Vögel peifen?! Ech saon der, dän krieht sein Gäld uf Martini bei Heller on Penning. Dat es mer akkerat rächt met der Künnijung, duh haon ech aach kein Ambra mieh met de Zönsen!«
Sie glaubte es ihm nicht – er sah’s an ihrem Gesicht –, da packte ihn der Ärger. Wie durfte sie an ihm zweifeln?!
»Maach net esu en deierlich Wisasch wie Maria am Kreiz! Kotzdonner noch ehs, stieh net esu dao, wie de Katz, wann’t donnert!« Er herrschte sie gewaltig an. Sie war sein Herrschen gewohnt, manche Träne hatte sie schon still darum vergossen, aber heut war’s zu arg. Und die Sorge dabei im Herzen!
Laut aufweinend hielt sie sich die Schürze vor das Gesicht und lief davon, ins Haus, in die Kammer. Dort kniete sie nieder vorm Muttergottesbild.
[5]. Frauensleute
[6]. geizig
5.
»Sankt Martinus kommt zu Pferd und macht den Bauer alert«, heißt ein altes Eifeler Sprichwort.
Müller-Hannes mußte nun doch daran glauben, die gekündigte Hypothek zu bezahlen; es ging ihm diesen Martini wie so vielen anderen Bäuerlein, die mit Not und Mühe ihre paar Groschen zum Zahltag zusammenschrapen. Der Laufeld wollte um keinen Preis warten; er hatte noch was Schriftliches geschickt. Und Hannes, in dem dumpfen Gefühl, daß jener ihm nicht wohlwolle, hatte auch gar keinen Versuch gemacht, ihn zur Rücknahme der Kündigung oder wenigstens zu einem Aufschub zu bewegen. Das sollte ihm einfallen, dem Laufeld gute Worte geben! Vor dem einen Kratzfuß machen – nein, niemals!
Des Hannes Gesicht sah trotzig aus, als er am Vormittag des elften November gen Manderscheid fuhr. Das Tal war eng; noch hatten die Nebel darin sich nicht gelüftet, sie hockten auf dem gewundenen Pfad und hingen um die vorspringenden Nasen der Felsen wie nasse Schleierfetzen. Jetzt war alles Grün dahin. Die Brombeeren und wilden Rosenhecken hielten nur hier und da noch ein letztes rostbraunes Blatt, eine verschrumpfte Hagebutte fest; widerlich schrie ein Häher aus dem dürren Eichenbüsch. Ein ganzer Schwarm hungriger Krähen scheute auf vom Peitschenknall und strebte mit schwerfälligem Schlagen der nassen Flügel den winzigen Saatstreifchen auf der Höhe zu.
Wild brauste die Kleine-Kyll. Das war kein Bach mehr, das war ein Fluß, der die Wiesen rechts und links überschwemmte, fast die Breite des ganzen Tälchens einnahm und kaum die Straße freiließ.
Des Müller-Hannes Stirn umwölkte sich. Hier unten, dort jenseits, da wo der Mosenberg abstürzt und seine Geröllhalde in ein sammetweiches Uferland übergeht, baute sich einer an – ein Müller! Schon stand das Haus unter Dach – nächsten Sommer war’s wohl beziehbar – schon zeigte sich das Gestühl für das große Rad, und ein paar riesige Mühlsteine lagen schon auf dem Hof. Und hier, tausend Schritt bachaufwärts, kam noch ein zweiter Müller zu wohnen, der Bruder vom unteren. Der eine eine Schneidemühle, der andere eine Mahlmühle. Schöne Aussicht das!
Hannes blickte grimmig drein. Das war ja eine ganz infame Frechheit, sich ihm so auf die Nase zu setzen! Wie konnten die sich unterstehen? War er nicht da, er, der Müller-Hannes? Für so viel Mühlen war kein Verdienst hierzuland. Und das Wasser würden sie ihm abfangen! Wenn’s mit dem Zufluß aus dem Maar knapp geworden, hatte er doch immer sein gut Teil aus der Kleinen-Kyll gekriegt, nun sollte ihm die auf einmal nicht mehr allein gehören?! No, wart, das wollte er ihnen zeigen, was es heißt, den Müller-Hannes schikanieren! Das ließ er sich nicht gefallen, und sollte er vor Gericht gehen!
Zornig hieb er auf die Pferde ein: weiter, weiter, daß er nur nichts mehr von dem Ärgernis sah!
Heute waren beide Gäule eingespannt, trotzdem der Weg nicht weit und sie daheim schlecht zu entbehren gewesen. Ei, was, die Leute konnten eben einen Tag länger auf ihr Mehl warten, – lästig genug, daß man es ihnen noch vors Haus fahren mußte – der Laufeld war einspännig gekommen, nun kam er dem heute zweispännig. Fürnehm genug sah’s aus, das gelblackierte Chaischen; und alles Lederzeug blank gewichst, das Riemenzeug mit Silber beschlagen. Müller-Hannes schmunzelte. Ja, die Manderscheider würden Augen machen, akkurat wie gestern die Wittlicher! Dort war er gewesen und hatte sich aus der Sparbank dreitausend Taler geholt, die diese ihm als neue Hypothek auf die Mühle gegeben. Zweitausend Taler hatte ihm der Schwiegervater vorgestreckt, aber erst nach langem Zureden und Anhalten – die Tina hatte extra darum an die Mosel hinunterfahren müssen – wahrhaftig, es war nicht angenehm, zu jemandem »Danke!« zu sagen. Das brauchte man wenigstens bei der Bank nicht, die kriegte ja Sicherheit in der neuen Hypothek. Da war es gar keine Gefälligkeit, da war’s eben ein Geschäft.
Befriedigt war Hannes gestern durch Wittlich zurückgefahren, die Dreitausend im Sack, aller Sorgen ledig. Die Gäule waren dahingestoben, als hätten sie statt des Blutes Feuer im Leib. Das Pflaster hatte Funken gesprüht unter ihren Hufen. Hui, durch die Gassen, daß groß und klein an die Türen eilte und die Mädchen rasch die Gardinchen von den Fenstern beiseite rissen. Er hatte allen zugewinkt; sein rundes Gesicht blühte in einem jovialen Lachen, die Straße im grauen Novemberlicht wurde hell davon. »Kucktelhei, dän Müller-Hannes, dän Müller-Hannes!« Das hörte er gern.
Heute konnte er die frohe Laune von gestern nicht finden. Hatte der Wein, den er im Wittlicher Gasthaus »Zur Traube« getrunken, ihm den Kopf schwer gemacht? Er fühlte einen ungeheueren Brand. No, nur ein halb Stündchen Geduld, dann war er oben in Manderscheid, da gab’s was zum Löschen!
Schon fingen die großen Kehren an, die langsam zum Plateau hinaufführen. Es war derselbe Weg, den er einst in hochzeitlicher Seligkeit mit seinem jungen Weib hinuntergefahren. Dazumal hatte der Mond silberne Rosen gestreut, und alle Wunder der Maiennacht hatten sich geoffenbart. Er erinnerte sich heute nicht mehr daran. Aber wie damals guckte er hinüber zum Mosenkopf, der sich jetzt in ganzer Mächtigkeit über dem Vorland niederer Höhen erhob.
Der trug noch immer kein stolzes Haus auf dem Buckel, von dem man hinunterspucken konnte auf die Welt. Aber – des Müller-Hannes finsteres Gesicht hellte sich ein wenig auf – das würde schon noch kommen, ’s würde schon noch kommen; warum die Hoffnung aufgeben, wenn man stark ist und in den besten Jahren, und – wenn man noch mal was zu erwarten hat?! Nicht, daß er dem alten Knauserer an der Mosel das Leben mißgönnte, nein, nein! Es war nur schön, daß man doch noch einmal einen gehörigen Batzen kriegte. Was der Schwiegervater immer von schlechten Zeiten stöhnte, war einfach nicht zu glauben; und auf der Tina Gerede war erst gar nichts zu geben. Die sah alles schwarz. Hatte sie nicht gesagt, es käme dem Alten sehr sauer an, als sie mit den zweitausend Talern zurückkehrte? Ach, was war die für eine Wehklage geworden, eine »Quiesel« noch dazu! Wenn sie durchs Haus ging, bewegte sie oft still die Lippen, sie betete bei sich. War das nicht zum Ärgern?! Eine Betschwester hatte er doch nicht zu freien gedacht, sondern eine Junge, Frische, voller Lebenslust. Hübsch war sie auch nicht mehr, klapperdürr; und seit sie ein paarmal »Malheur« gehabt, kränkelte sie. War’s nicht eine Schande, nur einzig die Fränz im Haus und keinen Sohn?!
»Verflixt!« Der starke Mann sah an sich herunter und steifte die kräftigen Lenden. Nein, an ihm lag es nicht, er hätte der Jungen in die Welt setzen können, wie weiland der Erzvater Jakob, zwölf an der Zahl, ein gewaltiges Geschlecht, das die Welt bevölkert.
Ein Gefühl, das er bis jetzt noch nie so deutlich empfunden, erhob sich plötzlich in ihm. War es Enttäuschung, Zorn, Haß gegen die Schwache? Nein, nein, die Tina war ein kreuzbraves Weib, sie hatte keinen Willen und tat, wie er befahl. Aber Empörung war doch in ihm. Ja, Empörung. Warum gebar sie ihm keinen Sohn, einen gesunden, strammen, so einen, wie er selber war?! Die Fränz war hübsch und kräftig, ließ sich ganz gut an, aber was soll’s mit einem Mädel, kann die einmal regieren? Einen Sohn, einen Sohn!
Er ließ die Pferde gehen, wie sie wollten; so knapp bogen sie am Rand der Kehren um, daß oft ein Rad überm Absturz hing. Aber es war nicht sorgloser Leichtsinn mehr, der den Herrn also unachtsam machte; eine zornige Bitterkeit war in ihm aufgewallt, und das zu Kopf steigende Blut hatte seine Augen getrübt. Er nagte an der Unterlippe. Wenn er jetzt die Tina bei sich hätte, wahrhaftig, er könnte ihr einen Schlag geben, mitten hinein in das blasse, wehleidige Gesicht, das ihm nicht mehr gefiel. Unwirsch sah er hinter sich; aber da saß nur sein Hund, der Nero, breit auf dem Kutschsitz.
Nun hatten die Pferde die Höhe gewonnen. Da war schon das Waschhaus, das, wie auf Vorposten hinausgeschoben, die Nähe des Dorfes kündet. An der Quelle, die, durch die Mauer geleitet, drinnen in die steinernen Tröge plätschert, stand ein Mädchen und spülte Leinzeug. Sie war jung und drall und rief lachend: »Gud Zeit!«
Da machte der Müller: »Brr!« Die Pferde standen.
War wo ein Strählchen Sonne hinter den Wolken, hier oben am Waschhaus traf das. Hier sangen den ganzen Sommer über die Grillen im Gemäuer, und waren die im Winter gestorben, so sangen noch die jungen Mädchen von Manderscheid, und ein Summen und ein Gurren tönte weithin von emsig sich rührenden Zungen. Heut war die eine allein hier, aber sie galt für zehn, Hannes glaubte lange nicht, eine so hübsche gesehen zu haben. Sie bespritzte ihn zwar mit Wasser und schwenkte ein nasses Handtuch zur Abwehr vor sich her – aber es war ja der Müller-Hannes, dem schlug man ein Küßchen nicht ab.
Die Pferde scharrten schon ungeduldig, und der Hund bellte dumpf, da stieg ihr Herr endlich wieder auf. Noch ein Nicken, ein schäkernder Gruß, ein Lachen, das das Echo am Mosenkopf herausforderte, und Müller-Hannes raste dem Dorf zu. Nun war er wieder wohlgemut. Ihn dünkte schier, die Kleine am Waschhaus hatte die Sonne hervorgehext. Richtig, da guckte die bleiche Novembersonne auch schon aus den Nebeln! Jetzt zur Mittagszeit hatte sie noch Kraft und brannte ihn förmlich auf den breiten Rücken. Ein Behagen sondergleichen durchrieselte ihn: ah, nun war’s pläsierlich!
Aus dem ersten Häuschen des Dorfes rief ihn einer an. Es war der Bäcker Driesch; dürftig nur war sein Lädchen, dem Mann standen die Sorgen auf der Stirn. Schon lange war er schuldig fürs Mehlmahlen und für manchen Scheffel Korn, den er noch dazu beim reichen Müller entlehnt.
An die zwanzig Taler machte die Rechnung. Nun konnte er heut endlich zahlen, wenn es dem Hannes genehm war, das Geld selber mitzunehmen. Der sprang vom Wagen und ließ es sich in blanken Talern auf die Theke zahlen; fast reute es ihn, das einzustecken, denn dem Driesch schien das Geld an den Fingern zu kleben, und die Frau mit dem verarbeiteten Gesicht, die durch die Türspalte zusah, folgte jedem Talerstück mit einem langen Blick. Wie konnte man nur so an den paar Talern hängen!
Pfeifend schwang sich Müller-Hannes wieder auf seinen Wagen und hielt bald danach vor des Laufeld Haus.
Jakob Laufeld wohnte der Kirche gerade gegenüber. Sein Haus war stattlich und fein zartgrün gestrichen; Stallung und Remise gehörten dazu, und auf dem Hof breitete sich ein stattlicher Misthaufen.
Auf der Bank vor der Tür saß ein halbwüchsiger Knabe; Nero sprang vom Kutschsitz und fuhr ihm an die Hose. Aber da bekam er einen Tritt mit dem nägelbeschlagenen Absatz gegen die Schnauze, daß er winselnd unter den Wagen kroch. Diesmal hatte er sich geirrt, dies hier war kein armseliger Handwerksbursche oder ein elendes Bäuerlein, dies war des Laufeld Joseph.
Die Hände in den Hosentaschen, stand das Josephche und starrte den Müller an.
»Es Dein Vadder zo Haus?«
»Gieht sälwer kucken!«
Der Junge rührte sich nicht. Es blieb Hannes nichts übrig, als selber die Zügel der Pferde um den Haken in der Mauer zu schlingen und schweren Trittes in den Flur zu stampfen. Niemand kam ihm entgegen.
Der Laufeld saß in der großen Stube zu ebener Erde am Zylinderbureau, über dem die große Lithographie des Abgeordneten Windthorst hing, und hatte durchs Fenster alles draußen gesehen. Was, der von der lumpigen Mühle kam zweispännig, der wollte sich wohl gar vermessen, er sei reicher wie er? Oho, wenn die Leute auch sprachen: »Der reiche Müller – der reiche Laufeld« – der einzig Reiche in Wahrheit war doch nur er, er allein! Mochte der Hannes nur immer draußen ein wenig warten.
Mit leisen Schritten ging Jakob Laufeld rasch durch die Stube und machte die Tür zum Nebenzimmer breit auf, damit der Besucher die roten Plüschmöbel sehen könnte, die goldgerahmte Öldrucke an den Wänden und das breite Tafelklavier, das Prachtstück der Einrichtung, die im Dämmerlicht der immer geschlossenen Läden wie neu erschien.
Es pochte.
»Angtree!«
Müller-Hannes trat ein.
»Boschur,« sagte er unbefangen. Er hatte den schlechten Empfang wohl übel vermerkt, aber er war zu stolz, um das zu zeigen. »Boschur, Laufeld.«
Jakob Laufeld tat sehr überrascht.
»Ihr seid et, Hannes – nä, ech saon doch, esu en Üwerraschung! Ech haon neist gehört. Plaziert Eich! Wuh stechen dann de Knecht? Michel, Lorenz, Steffen!« Er machte die Tür zum Flur auf, und nun schrie er auch noch nach den Mädchen: »Bäbbche, Kättche, Adelheid! spannt dem Müller de Perd’ aus! Bringt des Bernkastler on zwei Gläser!«
»Laoßt nor dat Ausspannen,« sagte Hannes hochfahrend. Er hatte sich nicht gesetzt, aber während der andere ihm den Rücken kehrte, einen Blick in die gute Stube nebenan geworfen. Hei, war die nobel, viel nobler als seine zu Haus! Und ein Klavierchen! Kotzdonner, wahrhaftig ein Klavierchen! Schwer riß er den Blick davon los.
Aus der rechten Hosentasche zog er einen Beutel mit Geld, aus der linken auch einen. Mit einem Plumps ließ er beide auf die Platte des Zylinderbureaus fallen. »Hei, zählt noren, et stimmt,« sagte er nachlässig. »On dann, hei« – aus der Brusttasche brachte er nebst einem Bündel verknüllter Kassenscheine die ihm von der Bank vorgeschriebene Quittung zum Vorschein – »hei, unnerschreiwt dat, on dann sein mir quitt!«
»Hm,« machte der Laufeld; und dann fing er an, nachzuzählen: »Zwanzig, vierzig, sechzig, achtzig, hunnert,« bis die Fünftausend voll waren. Dabei ärgerte er sich; wahrhaftig, der Hannes machte ein Gesicht, als seien die Fünftausend ein Gassendreck! War der wirklich reicher, als man dachte? Das hätte er gern gewußt. Er schlug auf den Strauch.
»No, Müller-Hannes, Ihr seid sao gud geteert?«
»Gud geteert, noch besser geschmeert,« sprach der.
»Ihr haot woll dat gruße Los gezillt, dat Eich de Goldstückelcher esu ahfgiehn, wie annern Leit die Würm?«
»Kann sein!« Der Müller-Hannes lachte: nun wußte er’s, der Laufeld ärgerte sich, hatte wohl gar gedacht, er solle kommen und betteln und jammern. »En Zehr-, en Ehr-, en Not-, en Wehrpfennig muß mer immer im Haus haon,« sagte er höchst ehrenwert und klapperte mit den Talern, die er beim Driesch eingenommen, in der Hosentasche, während der Laufeld sein Geld packte und sorgfältig ins Zylinderbureau verschloß.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.