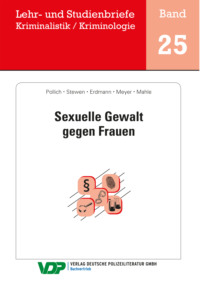Kitabı oku: «Sexuelle Gewalt gegen Frauen», sayfa 3
3Erklärungsansätze für sexuelle Gewalt
Die theoretischen Erklärungsansätze für sexuelle Gewalt gegen Frauen sind vielfältig. Im folgenden Abschnitt wird eine Übersicht über die wesentlichen Strömungen ursächlicher Erklärungen von Sexualdelikten gegeben. Die Übersicht ist auf solche Ansätze begrenzt, die sexuelle Gewalt gegen erwachsene Personen zum Gegenstand haben. Die Darstellung von Risikofaktoren, also von Merkmalen und Eigenschaften, die zwar mit sexuellen Gewalthandlungen gemeinsam auftreten, diese aber noch nicht erklären, wird in Abschnitt 5 vorgenommen.
Aufgrund der Fülle von Ansätzen zur Erklärung sexueller Gewalt erhebt die folgende Darstellung nicht den Anspruch, umfassend zu sein. Auch die gewählte Art der Systematisierung erhebt keinen Anspruch auf Absolutheit.
3.1Evolutionstheoretische und biologische Ansätze
Aus Sicht der Evolutionstheorie, die „Vergewaltigung [als] ein Relikt unserer unzivilisierten Vorfahren“77 sieht, ist es ein Drang männlicher Lebewesen, sich so oft wie möglich zu reproduzieren, um das Fortbestehen des eigenen Erbgutes sicherzustellen. Um diese Chance möglichst zu erhöhen, sei es aus männlicher Sicht erstrebenswert, möglichst viele Nachkommen zu zeugen. Frauen, die naturgemäß weniger Nachkommen haben können als Männer, legen dagegen bei der Fortpflanzung größeren Wert auf die Auswahl adäquater Partner. Durch diese widerstreitenden Interessen kann es den evolutionstheoretischen Ansätzen zufolge zu einer Mangelsituation für die Männer und in der Folge zu erzwungenen sexuellen Handlungen an Frauen kommen.78 In der aktuellen wissenschaftlichen Diskussion sind derartige Ansätze allerdings in den Hintergrund getreten.
Daneben existieren biologische Erklärungsansätze, welche die Ausübung (sexueller) Gewalt auf biologische bzw. körperliche Merkmale zurückführen. Derartige biologische Ursachen sexueller Übergriffe können beispielsweise ein erhöhter Testosteronspiegel oder Probleme im System der Neurotransmitter sein.79 Darüber hinaus werden in jüngster Zeit auch verstärkt genetische Faktoren sowie Aspekte der Gehirnentwicklung und Neurowissenschaften im Bereich der biologischen Theorien diskutiert.80 Nachweise kausaler, d.h. ursächlicher Zusammenhänge biologischer Faktoren und der Ausübung sexueller Gewalt sind allerdings, wie für alle Kriminalitätsphänomene, schwer zu erbringen und bislang wenig erhärtet bzw. Gegenstand aktueller Forschungsbemühungen.
3.2Psychologische Erklärungsansätze
Insgesamt sind bei den Erklärungen von Sexualdelinquenz psychologische bzw. psychiatrische Ansätze deutlich in der Überzahl. Regelmäßig wird zur Erklärung sexueller Gewalt auf Zusammenhänge mit Persönlichkeitseigenschaften81 sowie mit einer allgemeinen Dissozialität oder „Krankhaftigkeit“ der Täter hingewiesen, beispielsweise in Form von Persönlichkeitsstörungen oder Psychopathie.82 Aufgrund der Vielschichtigkeit der in der Literatur angeführten möglichen psychologischen und psychiatrischen Hintergründe83 wird im Folgenden lediglich eine selektive Auswahl einiger oft zitierter psychologischer Erklärungsansätze wiedergegeben.
Eng in Zusammenhang mit den oben genannten biologischen Theorien stehen psychologische Ansätze, die Gründe für sexuelle Gewalt in sexuellen Impulsen sehen. Sexuelle Gewalt folgt nach dieser Sichtweise, kurz gesagt, einem fehlgeleiteten und weitgehend unkontrollierbaren Sexualtrieb oder -impuls, der Befriedigung sucht und bei fehlender Umsetzungsmöglichkeit in (sexuelle) Aggression umschlagen kann.84 Besonders in frühen Ansätzen dieser Art wurde sexuellen Gewalttätern gleichzeitig eine „abnorme[.] Persönlichkeit“85 attestiert. Diese Ansätze gelten heute als recht vereinfachend86 und haben eher den Charakter von empirisch wenig bewährten „Alltagstheorien“87. Aktuell finden sie deshalb kaum noch Anwendung.
Mit „frühkindliche[n] Störungen in der psychosexuellen Entwicklung“88 befassen sich psychoanalytische bzw. psychodynamische Perspektiven. Problematische oder traumatische Erlebnisse in der Kindheit können sich diesen Ansätzen zufolge im späteren Leben in Form von sexuellen Gewaltdelikten manifestieren. Allerdings werden sie in der Zusammenschau psychologischer Ansätze heute ebenfalls als weniger bedeutsam angesehen.89
Darüber hinaus existieren Erklärungsansätze sexueller Gewalt, die sich mit „Störungen der Sexualpräferenz“ – auch als „Paraphilien“90 bezeichnet – als Ursache sexueller Gewalt befassen. Derartige Paraphilien können sich beispielsweise in einem sexuellen Interesse an nicht-menschlichen Stimuli oder in einem Bedürfnis nach Qual und Demütigung von anderen oder sich selbst äußern. Die wohl bekannteste Paraphilie – die in diesem Band von untergeordnetem Interesse ist – ist die Pädophilie. Jedoch ist zu bedenken, dass Paraphilien bei Weitem nicht immer mit einer zwangsweisen Umsetzung gegen den Willen anderer Beteiligter einhergehen müssen.91 Zudem zeigen Forschungsbefunde, „dass der größte Teil aller Sexualstraftäter scheinbar nicht als paraphil“92 einzustufen ist.
Weiter werden im Bereich der psychologischen Erklärungen kognitive Ansätze genannt, deren Kern darin besteht, dass sie die Gründe für sexuelles Gewalthandeln in der Informationsverarbeitung und der Wahrnehmung der Täter suchen. Beispielsweise kann Sexualität bei diesen Personen kognitiv stark mit Macht bzw. Dominanz verknüpft sein und so zum Erzwingen sexueller Handlungen führen.93 Ebenfalls im Bereich der kognitiven Ansätze sind so genannte kognitiv-behavioral ausgerichtete Erklärungen zu verorten. Diese beinhalten „kognitive[.] Verzerrungen [als] Denkmuster, die das kriminelle Verhalten rechtfertigen, beschönigen oder das Opfer für die Tat verantwortlich machen“94. Beispielsweise durch die Leugnung einer Schädigung der Opfer, eine abwertende Sicht auf Frauen oder die Darstellung der eigenen sexuellen Impulse als unkontrollierbar, versuchen Täter, ihre Taten mental zu rechtfertigen oder gar zu legitimieren.95
Daneben werden regelmäßig verschiedene lerntheoretische Ansätze herangezogen, um die Ausübung sexueller Gewalt zu erklären. Diese vertreten die Auffassung, dass sich „sexuelle Verhaltensweisen generell in Lernprozessen“96 entwickeln. Was als sexueller Reiz erkannt wird und wie darauf reagiert wird, ist demnach als erlernt anzusehen und damit auch auf das gesellschaftliche Umfeld zurückzuführen. Wesentlich dabei sind „Belohnungen“ und „Bestrafungen“, die durch
– potenziell abweichende – sexuelle Handlungen eintreten können. Beispielsweise kann eine den Lerneffekt verstärkende Belohnung darin bestehen, dass erzwungene Sexualität die Frustration von (männlicher) jugendlicher Identitätsfindung oder von Zurückweisungen subjektiv lindert oder positive Gemütszustände herbeiführt. Genauso kann durch das Ausbleiben von Bestrafungen nach der Ausübung sexueller Gewalt ein Lerneffekt bezüglich dieser Folgenlosigkeit eintreten. Daneben spielt das Lernen am Modell, also beispielsweise einem sexuell gewalttätigen Elternteil, eine wesentliche Rolle bei derartigen Erklärungsansätzen.97
Scully und Marolla kritisieren generell, dass die psychiatrisch geprägte Literatur zu Vergewaltigungen die Forschungslandschaft und damit auch die Deutung des Deliktes dominiere; dieses Argument lässt sich sicherlich in Teilen auf die psychologische Perspektive ausweiten. Sexualstraftäter würden in dieser Sichtweise als krank oder anormal gesehen, was gleichzeitig dazu führe, dass sie nicht als „normale“ Männer bzw. Straftäter wahrgenommen werden (siehe hierzu auch Abschnitt 2.1).98 Die Autoren sprechen sich daher für einen zusätzlichen sozialen und kulturellen Blick auf das Phänomen aus.99
3.3Soziologische und kriminologische Ansätze
Soziologische und/oder kriminologische Ansätze sind in der Forschungslandschaft zwar vorhanden, jedoch generell bis heute, besonders wenn es um täterbezogene Erklärungen geht, wenig ausdifferenziert.100 Die bedeutsamsten gesellschaftsorientierten Ansätze betrachten insbesondere die sozialen Rahmenbedingungen, innerhalb derer sich sexuelle Gewalt abspielt.
3.3.1Gesellschaftsorientierte und feministische Ansätze
Bei einer gesellschaftsorientierten Betrachtung sexueller Gewalt werden insbesondere die gesamtgesellschaftlichen Hintergründe und Einstellungen analysiert, die dazu führen, dass Frauen von Männern vergewaltigt werden.101 Die Ursprünge dieser Denktradition stammen aus der feministischen Vergewaltigungsforschung. Frühe Forscherinnen kamen etwa ab den 1970er Jahren zu der Erkenntnis, dass die westlichen Gesellschaften dieser Zeit durch die vorherrschenden Geschlechterrollenbilder und das dadurch entstandene gesellschaftliche Klima als eine so genannte „Rape Culture“102 charakterisiert werden könnten:103 Die althergebrachte (vermeintliche) Überlegenheit des Mannes über die Frau und das Verständnis der Frau als „Besitz“ des Mannes führe dazu, dass Männer, um ihre Machposition zu verdeutlichen, auch sexuelle Gewalt ausüben. Frauen fügen sich, gemäß ihrer gesellschaftlich vorgegebenen Rolle, oft ihrem Schicksal, durch die Männer dominiert zu werden. Insgesamt herrscht damit ein gesellschaftliches Klima, in dem sexuelle Gewalt gegen Frauen verharmlost wird und „normal“ erscheint.104 Einige Autorinnen gehen sogar so weit, Vergewaltigung als Hass- bzw. Vorurteilskriminalität105 gegen Frauen zu bezeichnen, die allein aus Gründen der Abwertung der Opfergruppe begangen wird.106
Obwohl die feministischen Ansätze ihren Ursprung in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts haben und seitdem ein deutlicher gesellschaftlicher Wandel hinsichtlich der herrschenden Geschlechterrollenbilder eingesetzt hat, ist die aktuelle Gültigkeit derartiger Ansätze nicht zu unterschätzen. Die gelegentlich immer noch vorhandenen tradierten Rollenvorstellungen gehen auch heute noch mit gesellschaftlich teilweise verankerten Vergewaltigungsmythen einher (siehe hierzu auch Abschnitt 2.1). Damit wird aus dem Blickwinkel der feministischen Ansätze bis heute sexuelle Gewalt verharmlost; es werden die Täter entschuldigt und den Opfern wird mindestens eine Mitverantwortung zugeschrieben.
3.3.2Kriminologische und viktimologische Erklärungsansätze
Nur wenige Autoren greifen auf Erklärungsansätze sexueller Gewalt zurück, die explizit etablierte Theorien aus der Kriminologie oder Kriminalsoziologie mit täter- oder auch opferspezifischen Blickwinkeln einbeziehen.107 Vereinzelt werden Verbindungen zur Theorie der differenziellen Assoziationen108, zu den Subkulturtheorien109, den Kontrolltheorien110 oder den Theorien rationalen Handelns111 hergestellt oder zumindest angedeutet.
Erklärungsmöglichkeiten aus einer viktimologischen Perspektive umfassen einerseits Opfertypologien112 – die meist wenig zur Erklärung von Opferwerdung geeignet sind –, andererseits Ansätze, die die Rolle des Opfers bei Sexualdelikten in den Mittelpunkt stellen, die so genannten Modelle der Opferpräzipation. Hierbei wird angenommen, das Opfer selbst trage durch sein Verhalten zur Entstehung der Tat bei, indem es beispielsweise den Täter provoziere, sexuell reize oder implizit der Vergewaltigung zustimme bzw. zumindest widersprüchliche Signale bezüglich der Freiwilligkeit sexueller Handlungen aussende. Diese Ansätze, die vielen Opfern eine Mitschuld an den Taten zurechnen und die Täter teilweise aus der Verantwortung nehmen, stehen stark in der Kritik.113
3.3.3Situationsbezogene Erklärungsansätze
Neben den täter- und opferbezogenen Ansätzen werden gelegentlich auch die situative Umgebung und die Rahmenbedingungen, in denen sich sexuelle Gewalt abspielt, zur Erklärung von Taten herangezogen. Insbesondere kann dadurch erklärt werden, wo genau im öffentlichen Raum ein Delikt stattfindet bzw. wie sich eine Tat zwischen Täter und Opfer situativ entwickelt.114
Einige Autoren betonen zwar die Bedeutung situativer Merkmale (wie beispielsweise Widerstand des Opfers, Einflüsse Dritter oder Frustrationserlebnisse während der Tat) für den Tathergang, bleiben dabei aber eher auf einer beschreibenden Ebene und binden diese Merkmale nicht in die ursächliche theoretische Erklärung ein.115 Wissenschaftliche Beiträge, die eine Erklärung der Bedeutung situativer Faktoren zu leisten vermögen, basieren meist auf etablierten kriminologischen und/oder kriminalsoziologischen Theorien wie beispielsweise den Theorien rationalen Handelns116 bzw. der Routine-Activity-Theorie117. Diese spielen auch bei der Erklärung des geografischen Täterverhaltens eine wesentliche Rolle (siehe hierzu auch Abschnitt 5.1.1).
3.4Integrative Ansätze
Insgesamt zeigt sich schon aufgrund der Fülle und Heterogenität vorhandener Erklärungsansätze, dass sexuelle Gewalt schwerlich durch nur einen einzigen Faktor zu erklären ist und dass Ansätze aus verschiedenen Disziplinen kombiniert betrachtet werden sollten, um dem Phänomen gerecht zu werden. Aus diesem Grund wenden sich zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den letzten Jahren so genannten integrativen Modellen zu, die verschiedene Sichtweisen und Erklärungsansätze vereinen. Diese Modelle sind allerdings sehr unterschiedlich hinsichtlich ihrer Reichweite, ihres integrativen Potenzials und ihres Erklärungsgehalts.
Die Modelle verbinden beispielsweise soziologische, psychologische, lerntheoretische, aber auch biologische und evolutionstheoretische Erklärungsansätze zu unterschiedlichen Erklärungsmodellen sexueller Gewalt. Darüber hinaus können – je nach Modell – auch situationsspezifische Faktoren wie Substanzeinfluss und Gelegenheitsstrukturen sowie zahlreiche andere Faktoren Berücksichtigung finden. 118
Ein komplexes und umfassendes Modell, das sowohl biologische als auch verschiedene psychische (z.B. neuropsychologische, psychopathologische und klinische) sowie soziale Wirkmechanismen berücksichtigt, legten beispielsweise Ward und Beech mit ihrer so genannten Intergrated Theory of Sexual Offending (ITSO) vor. Die Verfasser unterscheiden dabei zwischen mittelbaren, in der Person zeitüberdauernd verankerten (beispielsweise eigene Missbrauchserfahrungen in der Kindheit) und unmittelbaren bzw. tatauslösenden (beispielsweise Verlust des Arbeitsplatzes) Einflussfaktoren. Insgesamt werden Einflüsse der sozialen Umwelt und dadurch in Gang gekommene Lernprozesse mit psychologischen Faktoren wie „(a) Motivation/Emotionen, (b) Handlungsselektion und Kontrolle sowie (c) Wahrnehmung und Gedächtnis“119 verbunden, um die Ausübung sexueller Gewalt zu erklären. Die Verfasser betonen, dass zur Erklärung sexueller Gewalt ein oberflächlicher Blick auf die biologischen, psychischen und sozialen Schwierigkeiten, die bekanntermaßen oftmals mit der Ausübung sexueller Gewalt einher gehen, nicht ausreiche, sondern dass im Detail das konkrete Zusammenspiel der verschiedenen Wirkfaktoren erklärt werden müsse.120 Aufgrund der Vielschichtigkeit des Modells steht eine umfassende empirische Überprüfung jedoch noch aus.121
Im deutschsprachigen Raum schlägt beispielsweise Wieczorek ein integratives Modell vor, das unter anderem individuelle psychische Grundbedürfnisse (wie beispielsweise Selbstbestätigung, Kontrolle oder Lustgewinn) und so genannte „Schemata“ von Personen verbindet. Diese Schemata beschreibt der Verfasser als Routinen oder festgelegte Ablaufmuster von Handlungen, die Menschen im Laufe ihres Lebens erlernt oder verinnerlicht haben. Schemata, die mit Sexualdelikten zusammenhängen, können physiologisch bzw. biologisch (Auslösung körperlicher sexueller Erregung), affektiv (Zuwendungs- aber auch aggressive Gefühle), kognitiv (bestimmte Wahrnehmungen, beispielsweise die Akzeptanz von Vergewaltigungsmythen) oder motorisch (beispielsweise routinemäßige Handlungsabläufe wie „Verhaltensrituale[.] im sexuellen Kontakt“122) sein. Die individuelle Kombination von Grundbedürfnissen und Schemata einer Person bestimmt dann, in welcher Form diese ihr Sexualverhalten gestaltet.123 Dieses Modell ist jedoch eher als eine Heuristik, d.h. eine schlüssige Mutmaßung von Gesetzmäßigkeiten, zu sehen und weniger als eine ursächliche Erklärung von sexuellen Gewaltdelikten.
Auf die detaillierte Darstellung weiterer, meist komplexer integrativer Ansätze soll hier verzichtet werden. Viele der Ansätze sind noch nicht umfassend empirisch überprüft, auch sind die Entwicklungsstadien unterschiedlich. Dennoch werden die integrativen Ansätze aufgrund ihres umfassenden Blickwinkels in Zukunft für die theoretische Erklärung von sexueller Gewalt weiter an Bedeutung gewinnen.124
77Niemeczek, 2015, S. 32.
78Dern, 2011, S. 144-145; Niemeczek, 2015, S. 32.
79Niemeczek, 2015, S. 33.
80Ward/Beech, 2006, S. 48–54.
81Greuel, 1993, S. 27-28.
82Dern, 2011, S. 88-90, 132–138; Biedermann, 2014, S. 71–72; siehe kritisch Scully/Marolla, 1985, S. 298–300.
83Für eine ausführliche Übersicht siehe beispielsweise Mokros, 2007, 43–70; Eher/Rettenberger/Schilling, 2010; Müller/Turner/Retz, 2017, S. 147–150; Brochard, 2018.
84Scully/Marolla, 1985, S. 295–296; Greuel, 1993, S. 22–24; Wieczorek, 2006, S. 748–749.
85Greuel, 1993, S. 24; Suzuki, 2014, S. 1.
86Greuel, 1993, S. 24; Wieczorek, 2006, S. 749.
87Wieczorek, 2006, S. 749; siehe auch Scully/Marolla, 1985, S. 296.
88Greuel, 1993, S. 24.
89Siehe genauer Greuel, 1993, S. 24–27; Mokros, 2007, S. 40–43.
90Beide Biedermann, 2014, S. 68 (Hervorhebung nicht im Original).
91Biedermann, 2014, S. 68–71; siehe auch Mokros, 2007, S. 35–37.
92Biedermann, 2014, S. 70.
93Siehe genauer Mokros, 2007, S. 24–29.
94Niemeczek, 2015, S. 35.
95Biedermann, 2014, S. 66–67.
96Greuel, 1993, S. 28.
97Siehe genauer Greuel, 1993, S. 28–31; Mokros, 2007, S. 29–37; Suzuki, 2014, S. 2; Niemeczek, 2015, S. 34–35.
98Scully/Marolla, 1985, S. 294–295, 300; siehe auch Dern, 2011, S. 57; Sanyal, 2017, S. 147–155.
99Scully/Marolla, 1985, S. 306.
100Siehe hierzu schon Deming/Eppy, 1981, S. 374.
101Greuel 1993, S. 37–42; Mokros. 2006, S. 37–38; Niemeczek, 2015, S. 33–34.
102Sanyal, 2017, S. 40.
103Siehe ausführlich Brownmiller, 1978; Sanyal, 2017, S. 35–44.
104Deming/Eppy, 1981, S. 358–359; 363; Scully/Marolla, 1985, S. 295; Mokros, 2006, S. 37–38; Niemeczek, 2015, S. 33–34.
105Beispielsweise Coester, 2015, S. 333–338, 346–350.
106Carney, 2001, S. 319–320, 339–348.
107Felson/Krohn, 1990, S. 222, 238–239.
108Scully/Marolla, 1985, S 306; generell zur Theorie siehe Sutherland, 1947, 1974; Eifler, 2002, S. 38–39.
109Deming/Eppy, 1981, S. 360–361; 363–364; Greuel, 1993, S. 37–39; generell zur Theorie siehe Cohen, 1955; Cohen/Short, 1974; Eifler, 2002, S. 32.
110Felson/Krohn, 1990, S. 236; generell zur Theorie siehe Hirschi, 1969; Eifler, 2002, S. 44–47.
111Beauregard/Leclerc, 2007, S. 116–118; Beauregard/Rossmo/Proulx, 2007, S. 45; generell zur Theorie siehe Cornish/Clarke, 1986; Esser, 1999; Eifler, 2002, S. 52–54.
112Greuel, 1993, S. 31–33.
113Deming/Eppy, 1981, S. 369; Scully/Marolla, 1985, S. 302–306; Greuel, 1993, S. 33–34; Suzuki, 2014, S. 1.
114Greuel, 1993, S. 34–37; Dern, 2011, S. 57–58,
115Steck/Pauer, 1992, S. 187–188; Steck/Raumann/Auchter, 2005, S. 70–71, 74, 79.
116Beauregard/Rossmo/Proulx, 2007, S. 495; Beauregard/Leclerc, 2007, S. 118, 130; Mokros/Schinke, 2006, S. 208; generell zur Theorie siehe Cornish/Clarke, 1986; Esser, 1999; Eifler, 2002, S. 52–54.
117Felson/Krohn, 1990, S. 226, Mokros/Schinke, 2006, S. 208; generell zur Theorie siehe Cohen/Felson, 1979; Eifler, 2002, S. 54–55.
118Beispielsweise Greuel, 1993, S. 39–42; Dern, 2011, S. 157–170; Biedermann, 2014, S. 60–62; Niemeczek, 2015, S. 36–39.
119Biedermann. 2014, S. 60.
120Ward/Beech, 2006, S. 50–57; Biedermann, 2014, S, 60–61.
121Biedermann, 2014, S. 61–62.
122Wieczorek, 2006, S. 752.
123Wieczorek, 2006, S. 751–752.
124Niemeczek, 2015, S. 36–39.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.