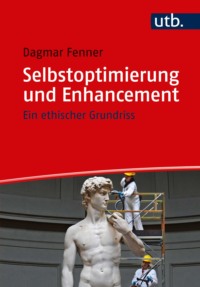Kitabı oku: «Selbstoptimierung und Enhancement», sayfa 11
2.3.2 Würde
In der Debatte um Selbstoptimierung und Enhancement spielt auch das normative Konzept der „Menschenwürde“ eine Rolle, das philosophisch-säkular gesehen in engem Zusammenhang mit dem Konzept „Freiheit“ steht. Formal und allgemein handelt es sich bei der Menschenwürde um eine diffuse, disparat gedeutete normative Leitvorstellung, die allen Menschen einen bestimmten moralischen Status und eine besondere Schutzwürdigkeit zuspricht. Inhaltlich existieren aber so viele verschiedene Interpretationen von „WürdeWürde“, dass sowohl Gegner als auch Befürworter sich darauf beziehen. In Francis Fukuyamas Worten ist der Grund für die Würde-Zuschreibung ein „Faktor X“ als essentielle Eigenschaft aller Menschen, die jedoch in verschiedenen Weltbildern jeweils anders bestimmt wird (vgl. 210ff.). Von BiokonservativenBiokonservatismus werden biotechnologische Optimierungsmaßnahmen häufig abgelehnt, weil sie in ihrem Verständnis die „Würde“ des Menschen oder menschlicher Aktivitäten gefährden (vgl. KassKass, Leon, 128f./KassKass, Leon u.a., 290f.). Im Hintergrund stehen dabei oft christliche Überzeugungen, auch wenn diese nicht explizit gemacht werden (Kap. 1.3): Bei einer Argumentechristliche/religiösereligiösen Auslegung der Menschenwürde kommt allen Menschen ein absoluter intrinsischer Wert und eine unhintergehbare Würde zu, weil alle Menschen von Gott geschaffen und Gottes Ebenbilder sind (vgl. dazu Fenner 2010, 83). Als Kinder Gottes und mit Vernunft und Wille ausgestattete Wesen haben sie Anteil an der göttlichen Heiligkeit und nehmen innerhalb der göttlichen Schöpfung eine Sonderstellung ein. BiokonservatismusDa der Würdestatus ausschließlich durch die Zugehörigkeit zur Gattung des Menschen, nicht aber durch die individuelle Ausprägung konkreter menschlicher Eigenschaften bedingt wird, handelt es sich um eine GattungsbetrachtungWürdeindividualisierende/Gattungsbetrachtung menschlicher WürdeWürde (vgl. ebd., 58). Wie FukuyamaFukuyama, Francis richtig bemerkt, kann diese Deutung allerdings nur diejenigen überzeugen, die an Gott glauben (vgl. 211). Eine auf den direkten Bezug auf Gott verzichtende biokonservative Argumentation macht demgegenüber eine konstante, gegebene menschliche NaturNaturmenschliche oder das „Wesen“ des Menschen geltend. Um eine absolute menschliche Würde sowie universelle Menschenrechte begründen zu können, komme nur die feste Grundlage der allen Menschen gemeinsamen „Natur“ in Frage (vgl. ebd., 160ff./KassKass, Leon u.a., 289f.). Wie sich in Kapitel 2.4 zeigen wird, sind aber Postulate einer normbildenden feststehenden Natur des Menschen begründungslogisch höchst problematisch. Wenn der X-Faktor wie bei FukuyamaFukuyama, Francis und KassKass, Leon nur äußerst vage konkretisiert wird als ein schwer beschreibbares komplexes Ganzes aus Vernunft, Bewusstsein, Empfindungsvermögen, Gefühlen und Soziabilität, scheint die Würde durch Biotechnologien aber ohnehin nicht bedroht werden zu können (vgl. ebd., 239/KassKass, Leon, 17f.).
BioliberaleBioliberalismus sehen die menschliche Würde in keiner Weise durch neue Optimierungsmaßnahmen bedroht, weil sie sowohl spezifische religiöse Begründungen als auch die Vorstellung einer konstanten und an sich wertvollen menschlichen Natur ablehnen (vgl. Althaus u.a., Teil 3). Betont werden stattdessen die Veränderbarkeit und Verbesserungswürdigkeit des Menschen und der hohe Wert seiner Selbstbestimmung, sodass das Konzept der „Würde“ eng an dasjenige der „Freiheit“ heranrückt. Aus einer säkularen philosophisch-ethischen Perspektive reicht der Hinweis auf die Zugehörigkeit zur Gattung „Mensch“ grundsätzlich nicht aus, um einen moralischen Sonderstatus des Menschen zu rechtfertigen (vgl. Fenner 2010, 83f.). Wenn den Menschen allein aufgrund ethisch irrelevanter biologischer Eigenschaften wie eines bestimmten Chromosomensatzes besondere Schutzwürdigkeit zugesprochen wird, handelt es sich nach einem berechtigten Einwand von Peter Singer vielmehr um einen „Speziesismus“. Genauso wie beim „Rassismus“ oder „Sexismus“ würden dann die Interessen der Mitglieder der eigenen Gruppe bevorzugt behandelt, ohne dass es dafür einen relevanten Grund gibt. Für eine hinlängliche Begründung eines moralischen Sonderstatus müssten sich ethisch relevante Eigenschaften oder Fähigkeiten der Menschen angeben lassen, die anderen Lebewesen fehlen. Im Anschluss an Immanuel KantKant, Immanuel wird der X-Faktor in säkularen Gesellschaften meist als die typisch menschliche Fähigkeit zur vernünftigen Selbstbestimmung definiert, die ethisch von Bedeutung ist. Denn wenn ein Wesen sich selbst Zwecke setzen, Vorstellungen von einem guten Leben entwickeln und persönliche, über das nackte Überleben hinausgehende Interessen verfolgen kann, ist es in vielfältigerer und tieferer Weise verletzbar und braucht deswegen mehr moralische Rücksichtnahme als ein weniger entwickeltes, nichtselbstbestimmungsfähiges Tier. Diese innere WürdeWürdeinnere, s. auch „Willensfreiheit“ als zentrales Leitprinzip der neueren Ethik wird also konstituiert durch die Willensfreiheit, Selbstbestimmung oder Autonomie der Menschen (vgl. ebd., 57). Entsprechend liegt eine Verletzung dieser Würde vor, wo ein Mensch etwa durch Gewaltanwendung oder Manipulation verdinglicht oder instrumentalisiert wird. Bei einer Würdeindividualisierende/Gattungsbetrachtungindividualisierenden Betrachtung ist WürdeWürde graduierbar und hängt vom individuellen Besitz der entscheidenden mentalen Fähigkeit zur vernünftigen Selbstbestimmung ab. Kleinkindern, Komatösen oder Demenzkranken könnte eine innere Würde höchstens mithilfe zusätzlicher Argumente wie etwa dem Potentialitäts-Argument zugesprochen werden, demzufolge sämtliche Mitglieder der vernunftbegabten Spezies „homo sapiens“ zumindest in einem potentiellen Sinn zur Selbstbestimmung fähig sind (vgl. ebd., 58).
Von dieser an Willensfreiheit gekoppelten „inneren Würde“ ist eine „äußere Würde“ oder „Würde-Darstellung“ zu unterscheiden, die vom Ausmaß an Handlungs- bzw. Willkürfreiheit abhängt. Würde-DarstellungWürdeäußere Würde-Darstellung bezeichnet die Möglichkeit eines Menschen, ohne innere und äußere Zwänge und Hindernisse seine selbstgesetzten Ziele in die Realität umsetzen zu können (vgl. Fenner 2010, 58f.). Diese Art von Würde ist offenkundig genauso graduierbar wie die Handlungsfreiheit, da sie durch die gleichen Hindernisse beeinträchtigt wird: Menschen können durch sozial externe Beschränkungen seitens von Einzelpersonen oder der Gesellschaft, durch interne natürliche Beschränkungen wie Krankheiten oder Behinderungen oder interne soziale Beschränkungen wie schlechte Ausbildung oder Arbeitsverhältnisse daran gehindert werden, ihre Würde zu realisieren oder zur Darstellung zu bringen. Damit ist auch schon deutlich geworden, dass eine im LiberalismusBioliberalismus weit verbreitete rein negative Bestimmung äußerer Würde genauso wenig sinnvoll ist wie die ausschließlich negativ als Abwesenheit von Handlungsschranken definierte Handlungsfreiheit. Wie gut jemand sein Leben selbstbestimmt gestalten und seine Handlungsziele verwirklichen kann, hängt vielmehr ab von positiv vorhandenen individuellen, materiellen, sozialen und institutionellen Bedingungen. Der Schutz äußerer menschlicher Würde verlangt daher nicht nur negative Freiheitsrechte wie das Recht auf Leben, freie Berufswahl oder Versammlungsfreiheit, sondern auch positive Sozialrechte wie Recht auf Existenzminimum, Bildung oder Gesundheit. Ethisch betrachtet muss der normative Gehalt oder die Bedeutung der Menschenwürde grundsätzlich durch Rechte näher bestimmt werden. Da Rechte zur Sicherung menschenwürdiger Lebensbedingungen für alle Menschen gefordert werden, spricht man von Rechte (auf)Menschen-Menschenrechten. Es wäre aber ein naturalistisches Missverständnis zu meinen, Menschenrechte seien „natürlich“ oder dem Menschen „von Natur aus angeboren“. Ein häufiger Denkfehler ist es auch, das Recht auf Schutz der Würde an den Besitz von Würde zu koppeln. Denn gerade Menschen, die aufgrund schlechter Ausbildung, Armut, Krankheit oder ausbeuterischer Arbeitsverhältnisse in geringerem Maß Würde darstellen oder verkörpern, sind besonders auf Schutz und Hilfeleistungen angewiesen (vgl. dazu Fenner 2016, 81f.). Aus bioliberaler Sicht fördern neue technologische Selbstoptimierungs-Maßnahmen menschliche WürdeWürde, weil sie interne natürliche Beschränkungen aufheben und damit die Möglichkeiten selbstbestimmten Handelns erweitern. Ob allerdings ein von radikalen Transhumanisten angestrebter rein siliziumbasierter „Posthumaner“ ohne Körper noch Würde darstellen kann, ist äußerst fraglich.
2.4 Normalität und Natur
Je mehr die medizintechnischen und computerbasierten Möglichkeiten der Selbstoptimierung und damit der Handlungsspielraum der Menschen expandieren, desto größer wird das Orientierungsbedürfnis der Menschen. Für viele fortschrittsoptimistische Liberale scheint zwar der zu einem bestimmten Zeitpunkt erreichte Stand der Technik den Maßstab dafür abzugeben, was der Mensch aus sich machen soll. Rational rechtfertigbar sind aus Biokonservatismusradikalliberaler Sicht lediglich Einschränkungen, die sich aus Nutzen-Risiken-Analysen ergeben (Kap. 1.4). Angesichts der immer schnelleren Verschiebungen dieser Maßstäbe infolge rasanter wissenschaftlich-technischer Fortschritte pochen aber Skeptiker und Warner zu Recht darauf, der Mensch dürfe nicht alles tun, was er kann. Um dem scheinbar schrankenlosen Bioliberalismusliberalen Streben nach Verbesserung und Selbstgestaltung klare Grenzen zu setzen, verweisen insbesondere Konservative vermehrt auf Konzepte wie die menschliche „Natur“, das „Natürliche“ oder „Normale“. Nachdem in der modernen Moralphilosophie eine solche Bezugnahme lange keine Rolle spielte oder sogar verpönt war, halten „Normalität“ und „Natur“ als vermeintlich einzig verbliebene stabile und verbindliche Orientierungsgrößen im postmetaphysisch-säkularen Kontext überraschenderweise wieder Einzug in den bioethischen Diskurs. Wie die folgende Untersuchung zeigen wird, sind aber beide scheinbar simplen und alltagstauglichen normativen Bezugsgrößen schon auf einer rein deskriptiven Ebene äußerst schwer zu fassen, vage und vieldeutig. Selbst wenn jedoch auf einer deskriptiven Ebene klar wäre, welche Eigenschaften oder Verhaltensweisen für Menschen „normal“ oder „natürlich“ sind, ist ihre normative „Aufladung“ problematisch. Diese Schwierigkeiten erinnern an diejenigen bei der scheinbar deskriptiven, aber verdeckt normativen Unterscheidung von „Krankheit“ und „Gesundheit“, die für die begriffliche Abgrenzung von „Therapie“ und „Enhancement“ unabdingbar ist (Kap. 1.3). Beide Begriffspaare setzen wie gesehen Vorstellungen von „Normalität“, „normalem Zustand“ oder „normalem Funktionieren“ der Menschen voraus (vgl. ebd./NagelNagel, Saskia u.a., 31f.). Aber auch dem Versuch einer Kontrastierung von „natürlichen“ und „künstlichen“ Methoden der Selbstverbesserung wird implizit oder explizit ein Verständnis von „Normalität“ zugrunde gelegt, sodass der Begriff der „Natürlichkeit“ von dem der „Normalität“ kaum zu trennen ist (vgl. BirnbacherBirnbacher, Dieter 2006, 103f.). Bevor ausführlich auf den notorisch unterbestimmten Naturbegriff eingegangen wird, soll daher zunächst ein Blick auf das scheinbar triviale, im Alltag omnipräsente Bewertungsprinzip der Normalität geworfen werden.
2.4.1 Mehrdeutigkeit von „NormalitätNormalität“
In der Enhancement-Debatte wird der Normalitätsbegriff geradezu inflationär verwendet und es werden häufig die deskriptivNormalitätdeskriptiver/normativer Begriff-beschreibende und normativ-wertende Bedeutungsebene verwischt, die es bei ethischen Fragestellungen auseinanderzuhalten gilt (vgl. Waldschmidt, 40/MetzingerMetzinger, Thomas 2012, 37): Normalität in einem deskriptiven Sinn oder als Ist-Wert meint entweder eine „Normalverteilung“ als statistisches Mittel oder ein „normales Funktionieren“ eines biologischen Organismus. Es lässt sich leicht anhand von Beispielen veranschaulichen, dass aus einem rein statistisch-deskriptiven Durchschnitt nicht ohne Weiteres normative Schlüsse gezogen werden können: Auch wenn Alkoholkonsum unter erwachsenen Männern und Karies geschlechtsunabhängig in allen Altersklassen statistisch gesehen „normal“ sind, sind diese Gewohnheiten oder Zustände nicht „gut“ für die Menschen und rechtfertigen kein moralisches „Sollen“. Eine unmittelbare Ableitung normativer Schlüsse aus empirischen statistischen Erhebungen bedeutete einen naturalistischen Fehlschluss (vgl. unten). Überzeugender als ein rein statistisches NormalitätsverständnisNormalitätstatistische scheinen biostatische funktionale Normalitätskonzepte zu sein, bei denen eine speziestypische Funktionsfähigkeit eines Organismus den Maßstab bildet (vgl. BoorseBoorse, Christopher, 567/DanielsDaniels, Norman, 28). NormalitätNormalitätbiostatischeNormalitätdeskriptiver/normativer BegriffNormalitätstatistischeDenn dysfunktionale Organe beispielsweise vermindern in aller Regel die Qualität eines menschlichen Lebens erheblich. Daher ließe sich zumindest nach unten hin eine moralisch und politisch relevante minimale Schwelle des „normalen Funktionierens“ definieren, deren Überschreiten allen Menschen ermöglicht werden sollte (Kap. 1.3). Sobald allerdings über diesen engen physisch-organologischen Kontext hinaus im psychischen und sozialen Bereich ein „normales Spektrum an Lebenschancen“ zur Richtschnur gemacht wird, gerät „Normalität“ in Abhängigkeit von gesellschaftlichen und kulturellen Anforderungen (vgl. DanielsDaniels, Norman, 33/BuchananBuchanan, Alan u.a., 122). Noch eindeutiger nimmt „Normalität“ eine normative Bedeutung an und fungiert als ein kritisierbarer und zu rechtfertigender Soll-Wert, wenn bestimmte als selbstverständlich geltende Handlungsweisen oder gesellschaftliche Ideale etwa von geistiger Leistungsfähigkeit oder Schönheit zur Norm erhoben werden. Bei allen drei Bedeutungen von „Normalität“ handelt es sich keineswegs um stabile und zuverlässige Bezugsgrößen, weil infolge wissenschaftlich-technischer Fortschritte, zeitbedingter Moden und immer anspruchsvollerer Vorstellungen von Gesundheit oder gutem Leben die statistischen Durchschnittswerte steigen und sich das gesellschaftliche „Normalitätsspektrum“ erweitert. Um eine Deckelung nach oben vorzunehmen und bestimmte Durchschnittswerte gleichsam einzufrieren, wäre argumentativ auszuweisen, wieso die Überbietung eines erreichten Niveaus eine Verschlechterung darstellte und ethisch verwerflich wäre.
2.4.2 Mehrdeutigkeit von „Natur“
Einer der häufigsten Einwände gegen die NaturNatur als normative Bezugsgröße betrifft die Mehrdeutigkeit der Begriffe „Natur“ und „Natürlichkeit“. Die große Vielfalt teils widersprüchlicher Verwendungsweisen erweckt den Verdacht, es handle sich um bloße „Leerformeln“ (vgl. BirnbacherBirnbacher, Dieter 2006, 18f./MüllerMüller, Oliver 2008, 16). Hilfreich sind dabei die klassifikatorische UnterscheidungNaturaußermenschliche/menschliche (klassifikatorische Unterscheidung) zwischen menschlicher und außermenschlicher Natur sowie die komparative UnterscheidungNatürlichkeitNatürlichkeit/Künstlichkeit (komparative Unterscheidung) zwischen „Natürlichem“ und „Künstlichem“ (vgl. Birnbacher 2006, 6). Hinsichtlich der komparativen Unterscheidung gibt es allerdings in der menschlichen und außermenschlichen Alltagswelt kaum etwas „rein“ Natürliches oder KünstlichesNatürlichkeitNatürlichkeit/Künstlichkeit (komparative Unterscheidung), sondern eine breite Skala von Abstufungen dazwischen. Denn einerseits finden sich zumindest in Europa kaum mehr unberührte Naturlandschaften, andererseits gehen alle materiellen Träger künstlicher Gegenstände auf vielfach bearbeitete natürliche Rohstoffe zurück. Da es aber verschiedene Hinsichten der Abgrenzungsmöglichkeiten von „Natürlichkeit“ und „Künstlichkeit“ gibt, kommt es oft zu ganz unterschiedlichen Einstufungen eines Objektes zwischen den beiden Polen (vgl. ebd., 8–16): Im Natürlichkeitgenetischegenetischen Sinn von „NaturNatur“ beispielsweise geht es um die Entstehungsgeschichte, d.h. darum, ob etwas einen natürlichen Ursprung hat und ohne Zutun des Menschen geworden ist oder vom Menschen gemacht wurde. Der Natürlichkeitqualitativequalitative Sinn von Natürlichkeit hingegen bezieht sich nicht auf die Genese einer Sache oder eines Lebewesens, sondern auf seine aktuelle Beschaffenheit und Erscheinungsform. Vom Menschen gezielt gestaltete „naturidentische“ Aromastoffe oder mit neusten raffinierten Techniken „gedopte“ Körper von Sportlern lassen sich von Vergleichsobjekten ohne menschliche Manipulation häufig nicht unterscheiden. Einige Enhancement-Technologien wirken in der Weise künstlich auf einen Körper ein, dass körpereigene Abläufe aktiviert werden und sich die Veränderungen somit innerhalb eines natürlichen Rahmens abspielen (Kap. 3.4). Eine Art genetischer FehlschlussFehlschlüssegenetische läge dann vor, wenn aus der Verschiedenheit der Genese automatisch auf Unterschiede in der Qualität oder Echtheit bzw. Authentizität von Objekten oder Sachverhalten geschlossen würde (vgl. Fenner 2008, 66/ BirnbacherBirnbacher, Dieter 2006, 40). Angesichts der hier nur angedeuteten Vielzahl an Facetten von „Natürlichkeit“ bzw. „Künstlichkeit“ und des Fehlens einer einheitlichen Skala aller Dimensionen trägt der komparative Naturbegriff kaum etwas zur Beurteilung von Enhancement-Technologien bei, die an unterschiedlichen Punkten der mehr oder weniger „künstlichen“ Wirklichkeit mit mehr oder weniger „natürlichen“ Mitteln ansetzen (vgl. HeilingerHeilinger, Jan-Christoph, 80).
Die Offenheit und Vieldeutigkeit des Naturbegriffs hat im Laufe der Geschichte immer wieder dazu verleitet, teilweise sehr unterschiedliche moralische Überzeugungen in die Natur hineinzuprojizieren (vgl. BirnbacherBirnbacher, Dieter 2006, 18f.). Im 18. Jahrhundert beispielsweise beriefen sich französische Philosophen wie Henry d’Holbach auf das „Gesetzbuch der Natur“ zur Stützung ihrer radikalen Kritik an der Institution der Monarchie, wohingegen Edmund Burke diese gerade wegen ihrer angeblichen Übereinstimmung mit der Welt- und Naturordnung verteidigte. Bei solchen Beweisfehlern eines logischen FehlschlüsseZirkelschlussZirkels wird das eigentlich erst zu Beweisende wie z.B. die gewünschte politische Ordnung bei der Begründung vorausgesetzt und gleichsam in die Natur hineingelegt, um daraus wieder abgeleitet zu werden. Aber auch wo die zum Beweis herangezogenen Naturvorstellungen nicht als inhaltlich willkürlich erkennbar sind, ist die Bezugnahme auf die NaturNatur rein formal betrachtet unzulänglich: Der erstmals von David Hume aufgedeckte naturalistische Fehlschluss oder Sein-Sollen-Fehlschluss FehlschlüsseSein-Sollen-besagt, dass von deskriptiven Tatsachenaussagen z.B. über Natur oder Natürlichkeit prinzipiell keine normativen Wert- und Sollensaussagen abgeleitet werden können (vgl. ebd., 45/Fenner 2008, 87f.). Ein prominentes und politisch folgenträchtiges Beispiel für solche Fehlschlüsse im Zeichen eines „ethischen Naturalismus“ wäre der Sozialdarwinismus, demzufolge das in der Natur herrschende Recht des Stärkeren auch in der Gesellschaft maßgebend sein soll. Allerdings wird der Vorwurf des naturalistischen Fehlschlusses in ethischen Debatten oft voreilig und als Diskussionsstopper eingesetzt, weshalb er als eine Art „Schreckgespenst“ in der Bioethik herumgeistert (vgl. EngelsEngels, Eve-Marie 2008, 176ff./Schockenhoff, 122ff.). Denn oft liegt der Argumentation nicht ein empirisch-deskriptives Verständnis einer Natur als Gesamtheit gesetzmäßig verlaufender Teilchenverbände wie in einem naturwissenschaftlichen Weltbild zugrunde, sondern ein normatives Verständnis einer Natur als strukturierter, vernünftiger und sinnhafter Ordnung wie in metaphysischen und religiösen Weltbildern. In diesem Sinn hat etwa die katholische Kirche gegen viele neue technische Errungenschaften opponiert und lehnt beispielsweise bis heute künstliche Methoden der Empfängnisverhütung ab, weil sie der göttlichen Schöpfungsordnung widersprechen und die Fortpflanzung als „natürlichen“ Zweck der Sexualität durchkreuzen. Obwohl hier der Vorwurf des Sein-Sollen-Fehlschlusses genaugenommen nicht zutrifft, kann sich die Kritik natürlich immer noch gegen die einen bestimmten Glauben voraussetzenden impliziten normativen Prämissen richten.
Ein naturalistischer Fehlschluss liegt strenggenommen auch dann nicht vor, wenn der Natur ein intrinsischer oder eigenständiger Wert zugesprochen wird (vgl. Birnbacher 2006, 38). Der Rekurs auf „Natur“ oder „Natürlichkeit“ erfolgt dann nicht in deduktiver Absicht, also um daraus konkrete Sollensforderungen oder Normen für das menschliche Handeln abzuleiten. Statt als ethische Begründungsstrategie dient diese Bezugnahme eher dem Anstoßen von „Wertbildungsprozessen“, damit Menschen das „Natürliche“ überhaupt erst einmal als wertvoll und berücksichtigungswürdig wahrnehmen (vgl. MüllerMüller, Oliver 2008, 29). Bei einem solchen schwachen PlausibilitätsargumentArgumentePlausibilitäts bleibt aber zum einen völlig offen, wann und mit welcher Dringlichkeit das „Natürliche“ geschützt werden soll wie im Fall der Geburtenkontrolle oder verbessert werden darf wie im Krankheitsfall. Zum anderen wäre zu begründen, wieso der Natur überhaupt ein Eigenwert zukommen soll. Nach einer gängigen Argumentationsstrategie kann die Natur als ein über enorme Zeiträume „eingespieltes“ System als genauso zuverlässig und sicher gelten wie alles andere in unserer Erfahrungswelt, das sehr lange getestet und optimiert wurde (vgl. dazu GesangGesang, Bernward, 134). Während sich die NaturNatur viel Zeit lässt und sich in kleinen Schritten vortastet, beunruhigt viele die enorme Beschleunigung des Tempos der Evolution durch die bahnbrechenden technischen Errungenschaften der Menschen. Sowohl in der Tradition als auch in der neueren Naturethik kursieren zudem zahlreiche idealisierende Naturbilder und Naturmetaphern wie die eines „natürlichen Gleichgewichts“ oder religiös-metaphysische Vorstellungen einer teleologisch strukturierten Ordnung, die auf ein höheres Ziel und einen Sinn des Ganzen angelegt ist. Sachlich betrachtet ist jedoch keine lineare Entwicklung hin zu einem guten Gesamtzustand erkennbar, weil nach Erkenntnissen der modernen Naturwissenschaft Naturprozesse immer auch vom Zufall geprägt sind und es aufgrund kosmischer Einwirkungen wie Meteoriten oder Eiszeiten mehrfach zum massenhaften Aussterben biologischer Arten kam (vgl. Fenner 2010, 170). Die außermenschliche NaturNaturaußermenschliche/menschliche (klassifikatorische Unterscheidung) ist keineswegs an sich wertvoll und gut und bildet keine „gerechte Naturordnung“ oder einen „Garten Eden“, sondern in den vom Menschen kaum berührten Untiefen des Meeres oder im Urwald herrscht höchstens ein „Gleichgewicht des Schreckens“ (vgl. BirnbacherBirnbacher, Dieter 2006, 49/HeilingerHeilinger, Jan-Christoph, 196). Mit gewaltigen Naturkatastrophen wie Erdbeben, Überschwemmungen, Epidemien und Hungersnöten hat sie den Menschen schon immenses Leid zugefügt, gegen das diese seit jeher mit technischen Hilfsmitteln wie z.B. Staudämmen und Medikamenten ankämpfen. Gegen eine Orientierung an der außermenschlichen Natur sprechen somit nicht nur die Vieldeutigkeit des Naturbegriffs und der naturalistische Fehlschluss, sondern auch starke ethische Gründe.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.