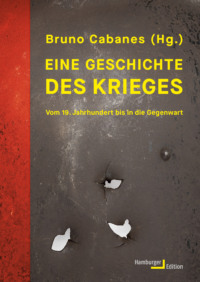Kitabı oku: «Eine Geschichte des Krieges», sayfa 18
Querverweise
Die Zeit der Bürgersoldat*innen78
Der Preis des Krieges166
Die Heimatfront181
1914–1945: Die Gesellschaften machen mobil611
Japan: der Krieg der anderen?624
Hunger als Waffe639
1Zit. n. Gary W. Gallagher (Hg.), Lee the Soldier, Lincoln 1996, S. 285.
2Erich Ludendorff, Der totale Krieg, München 1935, S. 9.
3Ebd.
4Cyril Falls, The Nature of Modern Warfare, London 1941, S. 7.
5John Maynard Keynes, Activities 1939–1945. Internal War Finance, hg. v. Donald Moggridge, Cambridge 1978, S. 11.
6Schmudt-Protokoll der Rede Hitlers vom 23. Mai 1939, https://www.ns-archiv.de/krieg/1939/schmundt/23-05-1939-schmundt.php [12. 6. 2019].
7John Maynard Keynes, Activities 1939–1945. Internal War Finance, hg. v. Donald Moggridge, Cambridge 1978, S. 218.
Jennifer Siegel
Der Preis des Krieges
Geld ist ohne Frage der Lebensnerv des Krieges. In der Moderne ist die Mittelbeschaffung zudem ständiger Streitgegenstand zwischen Vertretern einer Eigenkapitalfinanzierung und denen einer Schuldenfinanzierung gewesen. Am Ende hat sich, unterstützt von monetärer Manipulation, Letztere durchgesetzt.
Im Februar 1917, als der Erste Weltkrieg niemals zu enden schien, fand eine Ministerkonferenz der Alliierten in Petrograd, der Hauptstadt des russischen Kaiserreichs, statt. Drei Hauptthemen standen auf der Tagesordnung: die politische Zusammenarbeit; die Fragen der militärischen Koordination und der Versorgung; die Finanzierungsprobleme. Nach einer Woche Verhandlungen über eine ganze Reihe von Punkten, die teils weit von den ursprünglich vorgesehenen Themen abwichen, traf sich schließlich die Finanzkommission. Es heißt, dass Pjotr Lwowitsch Bark, der russische Finanzminister, sich der Versammlung vorstellte und die Sitzung eröffnete, indem er emphatisch verkündete, dass seit Langem bekannt ist, dass zur Kriegführung dreierlei unverzichtbar sei: primo das Geld, secundo das Geld und tertio noch einmal das Geld.
Bark hatte sich einen kurzen Augenblick der Eloquenz geleistet, doch seine Botschaft lag nicht weit ab von der Wahrheit, noch war sie sonderlich originell. Bereits zweitausend Jahre zuvor hatte Cicero in seiner fünften Philippischen Rede geschrieben, »unbegrenzte Geldmittel« seien das »Rückgrat jeder Kriegführung«1, der Lebensnerv des Krieges: nervos belli, pecuniam infinitam. Und als Ludwig XII. 1499 Vorbereitungen für den Krieg gegen Mailand traf, soll er gesagt haben, alles, was er brauche, sei »Geld, mehr Geld und immer Geld«. Die Geschichte ist voller Beispiele von Kriegen, die abgebrochen wurden, weil eine Seite sich aus Geldmangel gezwungen sah, sich um Frieden zu bemühen. Die moderne Finanzrevolution ist in vielerlei Hinsicht gerade als Antwort auf die Erfordernisse des modernen Krieges und zur Abhilfe gegen einige seiner Beschränkungen entstanden. Mit den technologischen Innovationen der militärischen Revolutionen des 16. und 17. Jahrhunderts stiegen die Kosten des Krieges exponentiell an. Um diese Ausgaben zu stemmen, waren die Nationalstaaten gezwungen, Finanzstrukturen und -institutionen zu schaffen, die in der Lage waren, die Geldmittel für ihre militärischen Abenteuer zu beschaffen. Diejenigen, die am besten dafür gerüstet waren, Kriege zu führen und zu gewinnen, verfügten auch über ausgefeilte Bankensysteme und konnten mittels Steuern Gelder eintreiben; vor allem konnten sie sich dank der ihnen zur Verfügung stehenden Finanzinstrumente wie der Ausgabe von Anleihen und von handelbaren langfristig verzinslichen Wertpapieren Geld leihen. Im modernen Krieg sind Kredite entscheidend, um Schlachten zu schlagen, Bündnisse und Koalitionen zu schließen und zu erhalten und um den Sieg davonzutragen. Eine hohe Kreditwürdigkeit bedingt den militärischen Erfolg.
Großbritannien war einer der ersten Staaten, die die strukturellen Herausforderungen des modernen Finanzwesens bewältigten. Die Gründung der Bank of England bot 1694 den Ausweg, um mit der Augsburger Allianz den Krieg gegen das Frankreich Ludwigs XIV. zu stemmen. Die britische Regierung benötigte dringend flüssige Geldmittel, um ihre Kriegsunternehmung und, noch wichtiger, die ihrer Verbündeten zu finanzieren. Sie gab eine ewige Anleihe von 1,2 Millionen Pfund aus, deren Zeichner den Namen »The Governor and Company of the Bank of England« erhielten. Diese ewige Anleihe war die entscheidende Innovation der Bank of England, die es der britischen Regierung erlaubte, sich über die gesamte Dauer des Krieges nur auf die Zahlung der Zinsen zu konzentrieren, ohne sich um die Erstattung des Kapitals zu sorgen. Dieser Vorteil bestätigte sich 1751, als die britische Regierung alle noch im Umlauf befindlichen Staatsanleihen mit hohem Zinssatz zu einem einzigen festverzinslichen Titel konsolidierte: dem Consol, einem nicht erstattbaren Rentenpapier, dessen Zinsen zeitlich unbegrenzt ausgezahlt wurden. Die Schaffung des ersten Consol erwies sich als äußerst vorteilhaft für die britische Regierung: Nun konnte sie wieder die Kontrolle über die öffentliche Verschuldung übernehmen, während sie bis dahin privaten Gläubigern ausgeliefert gewesen war, die Darlehen zu Wucherzinsen gaben. Die britischen Consols wurden bald als eine der sichersten und vertrauenswürdigsten Schuldforderungen am Markt nicht nur in Großbritannien, sondern auch außerhalb des Landes angesehen. Nach dem britischen Vorbild schufen auch andere Länder mit demselben Erfolg staatlich garantierte Wertpapiere.
Die Bank of England, ein Instrument des Krieges
Im britischen Fall wurde die Bank of England, die am Ende des 17. Jahrhunderts als Kriegsinstrument gegründet worden war, in Friedenszeiten zu einer Säule von Großbritanniens imperialen und industriellen Macht. Die Bank entwickelte sich zu einem Regulationswerkzeug für die Staatsverschuldung und zu einem Mittel, um jene Kredite anzuziehen und zu kontrollieren, die für die Entstehung des Militär-Industrie-Komplexes des britischen Weltreiches notwendig waren. Der Consol und sein ewiger Zins erlaubten Großbritannien, in seinen militärischen und imperialen Abenteuern Summen auszugeben, die deutlich über seinen wirklichen Ressourcen lagen, was eine umso interessantere Möglichkeit darstellte, als die Kosten für solche Unternehmungen im 18. und 19. Jahrhundert unaufhörlich stiegen. Paul Kennedy macht dies in Aufstieg und Fall der großen Mächte deutlich: »Die Kosten eines Krieges im 16. Jahrhundert beliefen sich auf einige Millionen Pfund; im späten 17. Jahrhundert waren sie auf einige zehn Millionen Pfund angewachsen; und am Ende der Napoleonischen Kriege stiegen die Ausgaben der Hauptparteien gelegentlich auf hundert Millionen Pfund im Jahr.«2
Die Staaten, die um die Wende zum 19. Jahrhundert an den immens kostspieligen Kriegen der Französischen Revolution und des französischen Kaiserreiches beteiligt waren, finanzierten diese auf verschiedene Weisen. Die Franzosen bemühten sich im Wesentlichen, auf die traditionellen Methoden des Auspressens eroberter Gebiete durch die siegreichen Armeen zurückzugreifen; so konnten sich einige von Napoleons Feldzügen nicht nur selbst finanziell tragen, sondern auch einen beträchtlichen Teil der laufenden Ausgaben der französischen Regierung durch Tribute der eroberten Länder decken. Für Frankreich war diese Möglichkeit, Erträge aus seinen Eroberungen zu ziehen, entscheidend. Üblicherweise bestand seine Steuerpolitik darin, zur Deckung der Militärausgaben eher die Schulden als die Steuern zu erhöhen. Dieses System hing von der Kreditwürdigkeit und dem Vertrauen ab, die die kreditnehmende Regierung genoss. Weder die Monarchie des Ancien Régime noch die Revolutionsregierungen, die ihr nachfolgten, waren in der Lage, zu den günstigen Zinssätzen zu leihen, derer sich die britische Regierung mit ihren Consols erfreute. Obwohl beide Länder Ende der 1780er Jahre dasselbe Schuldenniveau aufwiesen, zahlte Frankreich fast doppelt so hohe Zinsen wie Großbritannien. Nach der Revolution trugen die Regierungen durch Konfiszierung, Entzug von Kapitalmitteln und inflationistische Geldmanipulation dazu bei, die finanzpolitische Glaubwürdigkeit Frankreichs zu verspielen. Es kam zu einer starken Kapitalflucht nach Großbritannien. Traditionelle Geldgeber wie die Niederlande riskierten nur ungern ihr Geld für französische Regierungen. Außerdem verhinderten die fehlende Transparenz und Verantwortlichkeit, die das napoleonische Finanzsystem im Gegensatz zum parlamentarischen System Großbritanniens charakterisierten, dass Napoleons Regierung das Vertrauen aufbauen konnte, das sie benötigte. Infolgedessen verzichtete Napoleon darauf, sich auf Darlehen zu stützen, und nutzte stattdessen die Steuer als Mittel für fast alle Ausgaben, die nicht bereits durch Ersatzleistungen, Beschlagnahmungen und Ausbeutung der besiegten Länder gedeckt waren.
Die Gegner Frankreichs, ob sie sich im Aufstieg oder Niedergang befanden, finanzierten ihre Kriege auf verschiedene Weise, bevorzugt aber indem sie auf die Macht des britischen Schatzamts setzten. Die Engländer zahlten große Summen an fast alle Mitglieder der Koalition, während sie selbst sich auf Kolonialeinsätze, Seeblockaden und Küstenangriffe spezialisierten, wodurch perfekt illustriert wird, was Basil Liddell Hart später die »britische Kunst der Kriegführung«3 nannte. Großbritannien gewährte auch umfangreiche Kredite, doch der größte Teil der Finanzierung seiner Verbündeten fand in Form von Direktsubventionen mit einer Gesamtsumme von über 57 Millionen Pfund statt. Das Land nutzte mehrere Methoden zur Finanzierung seiner kostenintensiven Kriegsunternehmung und eines beträchtlichen Teils der Kriegsaufwendungen seiner Verbündeten. Zwischen 1793 und 1798 stützte sich die Regierung massiv auf Kredite, mit denen sie 90 Prozent ihrer Kriegsausgaben decken konnte, die allerdings auch die Staatsschulden verdoppelten. Schließlich wurde 1799 eine Einkommenssteuer eingeführt, um den Rückgriff auf geliehenes Geld einzuschränken. Letzten Endes spülte die Einkommenssteuer weniger Geld in die britische Staatskasse als andere Steuerformen, die zu der Zeit in Gebrauch waren. Und Steuern insgesamt trugen in Kriegszeiten weniger zu den finanziellen Aufwendungen Großbritanniens bei als die kurzfristigen Kredite, die von der Bonität und finanziellen Glaubwürdigkeit des Landes abhingen.
Während der Revolutionskriege und der Kriege des Kaiserreichs hatten die Verbündeten Großbritanniens von der Macht des britischen Kredits profitiert. Doch im nächsten Koalitionskrieg wurden die britischen Subventionen, die die Koalitionen des 18. und frühen 19. Jahrhunderts bestimmt hatten, durch Direktkredite und Garantien ersetzt, die in den Kriegen gegen Frankreich nur gelegentlich Verwendung gefunden hatten. Frankreich, dessen Zweites Kaiserreich im Krimkrieg zum Hauptverbündeten Großbritanniens geworden war, wünschte keine finanzielle Hilfe von seinem Partner, von dem es auch sonst nichts benötigte. Die weniger mächtigen Staaten, die an der Koalition gegen Russland beteiligt waren, zeigten sich weniger zurückhaltend. Das Königreich Piemont-Sardinien beispielsweise erhielt ein direktes Darlehen von 2 Millionen Pfund zu einem Zinssatz von 3 Prozent, das 1902 vollständig abbezahlt war. Das Osmanische Reich, das als stärker risikobehaftet angesehen wurde, musste sich mit 4 Prozent Zinsen auf ein Darlehen von 5 Millionen Pfund begnügen, das unter gemeinsamer englisch-französischer Garantie vergeben wurde; dennoch mussten nach dem Russisch-Türkischen Krieg von 1878 4 Millionen Pfund, die von dem Kapital noch zurückzuzahlen waren, abgeschrieben werden, da das ungeheure Sumpfloch der osmanischen Schulden die relativ läppischen Summen, die zur Finanzierung des Krimkrieges verliehen worden waren, verschlungen hatte.
Auch wenn Großbritannien im Krimkrieg die Methoden wechselte, mit denen es seine Verbündeten finanziell unterstützte, so blieben doch die Mittel, um diese Darlehen abzusichern – eine Mischung aus Anleihen und Steuern –, im Grunde dieselben. William Gladstone, britischer Schatzkanzler während der ersten Hälfte des Krieges, wagte, die Kriegskosten durch Steuern statt durch Erhöhung der langfristigen Schulden zu begleichen. »Die Kosten eines Krieges«, erklärte er vor dem Parlament, »sind der moralische Hemmschuh, welchen der Allmächtige, wie es ihm gefiel, dem Ehrgeiz und Eroberungsdurst, die so vielen Nationen innewohnen, auferlegt hat […]. Die Notwendigkeit, diese Kosten Jahr um Jahr auf sich zu nehmen, bildet einen vorteilhaften und heilsamen Hemmschuh, der sie spüren lässt, worauf sie sich einlassen.«4 Doch trotz der kernigen Reden Gladstones zugunsten der Steuer griff er nichtsdestoweniger von sich aus auf die Emission kurzfristiger Schuldtitel zurück, von denen ein Teil niemals beglichen wurde. Sein Nachfolger, Sir George Cornewall Lewis, hatte nicht dieselben Skrupel, was wachsende Staatsschulden anbelangte, insbesondere nicht im Krieg. Für Lewis nahmen die Risiken einer wachsenden Staatsverschuldung ab, je reicher das Land wurde. Außerdem bedeuteten Steuern ihrerseits eine Gefahr, da sie das notwendige Wachstum des nationalen Reichtums hemmten. Und so erklärte Lewis vor dem Parlament: »Die Steuern, die die Unternehmen lähmen und die Industrie behindern oder der normalen Verteilung des Kapitals im Wege stehen, sind schädlicher für die Gesellschaft als die Kredite, die die Regierung aufnimmt.«5 Also erhöhte Lewis die Schulden Großbritanniens, ob sie nun gedeckt waren oder nicht, beträchtlich, sodass schließlich fast zwei Drittel der britischen Ausgaben für den Krimkrieg durch Anleihen statt durch Steuern finanziert waren.
Der Finanzaufwand für den relativ kurzen Krimkrieg verblasst im Vergleich zu den Kriegen Anfang des 19. Jahrhunderts. Für Großbritannien schlug er mit kaum mehr als sechs Monaten der Kosten, im Vergleich zu jenen, die am Ende der Napoleonischen Kriege anfielen, zu Buche. Nichtsdestotrotz verdoppelten sich während dieses Krieges praktisch die Kosten pro Soldat, was an militärindustriellen Innovationen wie dem Miniégewehr und den Schlachtschiffen der britischen Marine lag. Dies kündigte bereits die Herausforderungen an, die von der Modernisierung der Militärtechnologie in der allgemeinen Entwicklung hin zu einer totalen Mechanisierung des Krieges an die Staatsfinanzen gestellt wurden. Der Amerikanische Bürgerkrieg, ein anderer, mehr oder weniger damit vergleichbarer großer Konflikt des 19. Jahrhunderts, kündigte seinerseits die Finanzierungsprobleme der Kriege des 20. Jahrhunderts an. Wie der Erste Weltkrieg begann er mit der Gewissheit, dass er nicht länger als ein paar Monate dauern würde, vor allem angesichts der ökonomischen Ungleichheit zwischen beiden Lagern. Die kaum industrialisierte Baumwollökonomie der Konföderation könne, so glaubte man, unmöglich mit der diversifizierten Wirtschaft der Unionsstaaten konkurrieren, die über zwei Drittel des nationalen Reichtums, des Einkommens und der amerikanischen Bevölkerung verfügten. Dennoch wurde der Konflikt langwierig und teuer: Die Ausgaben der Nord- und Südstaaten zusammengenommen lagen bei 6,7 Milliarden Dollar in vier Jahren Krieg, darunter die laufenden Ausgaben der Regierungen, die materiellen Schäden und der aufgrund des Verlusts von Menschenleben entgangene wirtschaftliche Zuwachs.
Letztlich gab die Konföderation fast eine Milliarde Dollar für den Konflikt aus, wovon nur 40 Prozent durch Anleihen oder Steuern finanziert werden konnten; die restlichen 60 Prozent wurden durch extensives Drucken von Papiergeld gedeckt, was zu einer verheerenden Inflation mit einem Preisanstieg von 92 Prozent zwischen 1861 und 1865 führte. Anfänglich wurden Kriegsanleihen sowohl zu Hause als auch im Ausland ausgegeben, doch als sich das Kriegsglück der Konföderierten wendete, versiegten diese Investitionen aus der Öffentlichkeit; außerdem gingen mit den militärischen Rückschlägen auch die Steuerzahlungen zurück. Der Union hingegen, die Siege verzeichnete und mit einer stärker industrialisierten Wirtschaft ausgestattet war, standen fast 2,3 Milliarden Dollar für den Krieg zur Verfügung; ihre Ausgaben ließen sich leichter finanzieren, ohne wie im Süden auf eine inflationistische Geldpolitik zurückzugreifen, selbst wenn auch hier nicht abgesicherte Geldscheine emittiert wurden: Man nannte sie greenbacks (mit »grüner Rückseite« oder »grün im Rücken«), weil Hartgeld aus Silber oder Gold fehlte, um ihren Wert zu stützen. Der Norden konnte auch auf seine Steuereinnahmen insbesondere aus Zöllen und auf Gelder aus Anleiheemissionen zählen, mit denen er ungefähr 60 Prozent seiner Gesamtausgaben decken konnte. Je mehr das Ende des Krieges in Sicht kam, desto mehr wuchs die Fähigkeit der Union, sich insbesondere auf den ausländischen Märkten Geld zu leihen. Die Kreditmacht, der sich die Unionsstaaten auf ihrem Territorium wie im Ausland erfreuten, trug entscheidend zu ihrem Sieg bei.
Der Erste Weltkrieg, kreditfinanziert
Keiner der Kriegsteilnehmer war auf den Krieg, der im August 1914 ausbrach, wirklich vorbereitet. Man hatte die Einschätzung, dass der auf der Offensive gründende Bewegungskrieg innerhalb weniger Monate, vielleicht auch schon innerhalb einiger Wochen zu Ende wäre. Die Kombattanten, die auf einen kurzen Krieg eingestellt waren, sahen sich in einen langen, erschöpfenden und verlustreichen Abnutzungskrieg verwickelt. Nach einigen Monaten wurde die Hoffnung, der Krieg würde ausreichend kurz, um ihn einfach durch Steuererhöhungen oder Ausschöpfung der nationalen Goldreserven finanzieren zu können, auf den Schlachtfeldern an der Marne, in Flandern, bei Tannenberg und an den Masurischen Seen ein für alle Mal davongefegt. Die Möglichkeit, Geld zu leihen und zu verleihen, erhielt schnell entscheidende Bedeutung.
Die Kosten des Ersten Weltkrieges waren ohne Beispiel, wie die New Yorker Mechanics and Metals National Bank 1916 in War Loans and War Finance deutlich machte: »Für jeden zusätzlichen Kriegsmonat belaufen sich die finanziellen Kosten auf 3000 Millionen Dollar. Das bedeutet, dass jeden Monat mehr Geld ausgegeben wird als für den gesamten Russisch-Japanischen Krieg, der achtzehn Monate dauerte. Und der Burenkrieg vor fünfzehn Jahren entspricht je zwölf Tagen des aktuellen Konflikts. Es ist der Deutsch-Französische Krieg in Dauerschleife …«6
Die ökonomischen und systemischen Zwänge, die ein Konflikt dieses Ausmaßes schon in seinen Anfängen hervorrief, zerstörten die Strukturen, die zu seiner Finanzierung beitragen sollten. Das Weltfinanzsystem, das auf freiem Kapitalverkehr und der goldbasierten Konvertibilität der Währungen beruhte, war von den ersten Tagen des Krieges an gelähmt, weil alle großen Börsen schlossen.
Vor dem Krieg hatte man gedacht, das Finanzwesen würde die Risiken eines zukünftigen Konflikts begrenzen, statt seinen plötzlichen Ausbruch zu erleichtern. In seinem wegweisenden Buch The Great Illusion von 1909–1910 legte Norman Angell überzeugend dar, dass die Verschränkungen des internationalen Finanzwesens in der modernen Welt den Krieg finanziell zu riskant hatten werden lassen, als dass sich eine der Mächte auf das Wagnis einlassen würde. Angells Voraussage zum Trotz ging man dieses Risiko offensichtlich doch ein und musste dann den erdrückenden finanziellen Erfordernissen des Krieges nachkommen. Die Fähigkeit, darauf eine Antwort zu finden, entscheidet über Sieg und Niederlage, schrieben 1916 Thomas Farrow und W. Walter Crotch, Präsident beziehungsweise Verwaltungsratsmitglied der Farrow Bank, in How to Win the War: »Der gewisse, endgültige und vollständige Sieg wird dem Lager zufallen, das am längsten aushält; anders gesagt dem Lager oder der Macht, die die größten finanziellen Ressourcen verbuchen kann und sie mit der tödlichsten Effizienz einzusetzen weiß.«7
Es handelte sich hier um einen Krieg, in dem die traditionellen Machtquellen – die Bevölkerung, das Territorium, der Nationalreichtum, das Kolonialreich – nicht dieselbe Wichtigkeit hatten wie die Fähigkeit, sich finanzielle Mittel zu erschließen, sei es aus der Wirtschaft oder durch internationale Bündnisse. Es handelte sich um einen Krieg, der fast ausschließlich über Kredit finanziert war: über kurzfristige Schatzanweisungen, von der öffentlichen Hand ausgegebene und auf dem nationalen Markt gekaufte Kriegsanleihen oder im Ausland geliehene Gelder. Unter den Hauptkriegsparteien verfügte einzig Großbritannien über ein effizientes Einkommenssteuersystem, und doch konnte es mit direkten Steuern, indirekten Abgaben und Zöllen zusammen nur ungefähr 20 Prozent seiner Kriegsausgaben abdecken; als sich der Krieg in die Länge zog, scheute man davor zurück, neue Steuern einzuführen, die zum »Blutzoll«, der auf den Schlachtfeldern entrichtet wurde, noch hinzugekommen wären. Der Hauptteil der Kosten, die der Krieg verursachte, schien auf kurzfristige Darlehen abgewälzt werden zu können, die nach Ende der Kampfhandlungen hauptsächlich aus Entschädigungen und Reparationen zurückgezahlt würden, die man den besiegten Mächten abverlangen wollte, wie es im letzten großen europäischen Konflikt, dem Deutsch-Französischen Krieg, der Fall gewesen war.
»Es gilt, dem ganzen Volke klarzumachen, daß dieser Krieg mehr als irgendeiner zuvor nicht nur mit Blut und mit Eisen, sondern auch mit Brot und mit Geld geführt wird«, erklärte der neue Staatssekretär beim deutschen Reichsschatzamt, Karl Helfferich, in einer Reichstagsrede 1915.8 Allerdings hatten die Mittelmächte deutlich weniger finanzielle Ressourcen zur Verfügung als die Triple Entente, das britische Weltreich und vor allem der Finanzplatz London, der nach wie vor das internationale Handels- und Finanzsystem dominierte. Außerdem begrenzte die föderale Struktur des Deutschen Reiches seine Fähigkeit, direkte Steuern bei seiner Bevölkerung zu erheben und auf nationaler statt nur regionaler Ebene Schuldtitel auszugeben. Für Deutschland, mit Abstand die treibende Wirtschaftskraft der Mittelmächte, war deutlich, dass Darlehen einspringen mussten, wo Steuern nicht hinreichten. Nachdem die deutsche Regierung 1914 erfolglos versucht hatte, ein sehr großes Darlehen in New York zu erhalten, sah sie sich zu der Entscheidung gezwungen, auf ausländische Finanzmärkte zu verzichten und stattdessen über die ganze Dauer des Krieges alle sechs Monate kurzfristige Kriegsanleihen auszugeben. Mit dieser Methode der inländischen Verschuldung brachte die deutsche Regierung fast 100 Milliarden Mark zusammen, die sich jedenfalls als ungenügend erwiesen, um die mit dem Konflikt direkt verbundenen Ausgaben zu decken, welche sich auf ungefähr 150 Milliarden Mark beliefen, ganz zu schweigen von den Zinsen auf die Kriegsanleihen und andere Schulden der deutschen Regierung, die sich über den Krieg ansammelten.
Dazu kam, dass Berlin über die meiste Zeit des Krieges monatlich 100 Millionen Mark an Österreich-Ungarn lieh. Noch mehr als auf deutsche Kredite stützte sich Österreich-Ungarn auf seine eigenen Kriegsanleihen, die fast 60 Prozent der Kriegsausgaben deckten. Im Oktober 1917 schuldete Österreich-Ungarn Deutschland mehr als 5 Milliarden Mark. Deutschland hatte auch dem Osmanischen Reich 2 Millionen Pfund in Gold dafür versprochen, zu seinen Gunsten in den Konflikt einzugreifen, und zusätzlich noch 33 Millionen Pfund, nicht gerechnet die 29 Millionen Pfund in Material und diversen Hilfsleistungen. Um diese ganzen Ausgaben zu leisten, schuf die deutsche Regierung ein Netz von Kreditbüros und erlaubte ihnen, eigene Banknoten auszugeben, die am Ende eine subsidiäre Form von Papiergeld darstellten. Das führte kaum überraschend zu einer massiven Inflation, die sich aus einem Verfahren speiste, das in Schüben immer neues Geld in die Wirtschaft pumpte.
Aufseiten der Entente stellte sich die Situation ein wenig anders dar. Während sich Deutschland gezwungen sah, die finanzielle Last des Vierbunds alleine zu stemmen, gelang es Frankreich, zu Kriegsbeginn die zweitstärkste Finanzmacht, sich auf Anhieb selbst zu finanzieren und seinen Verbündeten in den ersten Phasen des Konflikts auszuhelfen. Diese Rolle als Finanzpartner währte nicht lange. Zunächst weil Großbritannien über größere Finanzreserven und die Unterstützung seines Weltreiches verfügte und außerdem weil die Kämpfe, die in weiten Teilen Frankreichs entbrannten, seine Wirtschaft und Produktionskapazitäten stark in Mitleidenschaft zogen. So wurde Großbritannien zum großen Geldgeber der Entente, wie schon in so vielen Koalitionskriegen zuvor. Im Verlauf des Krieges verlieh es ungefähr 1852 Millionen Pfund an seine Verbündeten und an sein Dominion, wovon 10 Prozent an das Britische Reich und sein Dominion gingen, 32,6 Prozent an Russland, 25 Prozent an Frankreich und 23,7 Prozent an Italien. Dennoch stammten diese Millionen nicht aus den britischen Reserven. Zusätzlich zu Kriegsanleihen und direkten wie indirekten Steuern hatte das Land am Ende des Fiskaljahrs 1918–1919 insgesamt 1365 Millionen Pfund im Ausland geliehen. 75 Prozent dieser Darlehen stammten aus den Vereinigten Staaten, aber auch Kanada, Japan, Argentinien und Norwegen hatten dem Britischen Reich und vermittelt darüber auch dessen Verbündeten Geld geliehen. Großbritanniens Verbündete profitierten so von der britischen Kreditmacht auf dem internationalen Markt und erhielten Geld zu deutlich günstigeren Konditionen, als sie ihnen allein zur Verfügung gestanden hätten.
Allerdings bestärkte und vollendete der massive Rückgriff auf amerikanische Kredite auch die große Verschiebung der Finanzmacht von Europa in die Vereinigten Staaten. Vor deren Kriegseintritt im April 1917 hatten die Entente und ihre Verbündeten amerikanische Waren im Wert von ungefähr 7 Milliarden Dollar gekauft und sie mit Exporten, Goldverkäufen, der Liquidation kurzfristiger Auslandsschulden der Vereinigten Staaten und vor allem über Kredite bezahlt, die Washington in einer Gesamthöhe von 2,4 Milliarden Dollar gewährte. Alle diese Käufe und Darlehen dienten einem zusätzlichen Zweck, nämlich der direkten Verwicklung der amerikanischen Wirtschaft mit dem alliierten Lager – ein Kalkül, das sich als klug erwies, da die Vereinigten Staaten tatsächlich am Ende zum großen Teil wegen dieser finanziellen Beziehungen in den Krieg eintraten. Ab April 1917 verlieh die amerikanische Regierung weitere 7,47 Milliarden Dollar an ihre neuen Verbündeten, wovon das Gros zum Kauf amerikanischer Waren ausgegeben werden musste, was der amerikanischen Industrie und Produktion einen beträchtlichen Aufschwung verschaffte und zum Ausbau der wirtschaftlichen Überlegenheit des Landes beitrug. Die von den Vereinigten Staaten gewährten Darlehen und ihre Kriegsanstrengungen wurden durch Emission von Liberty-Bonds genannten Kriegsanleihen und durch merkliche Steuererhöhungen finanziert. Diese Finanzierung profitierte vor allem von den Bemühungen zur Inflationsbekämpfung der amerikanischen Federal Reserve, die Geld aus ihrer neuen Währungsreserve an die Banken verlieh, die dieses Geld ihrerseits an Private verliehen, um sie zum Kauf der Liberty-Bonds zu ermutigen. Dadurch konnten die wirklichen Kosten des Krieges vor der Öffentlichkeit verborgen gehalten werden.