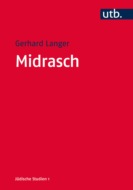Kitabı oku: «Qumran», sayfa 4
|27|2 Wie liest man ein Fragment? Anatomie der ältesten jüdischen Bücher
S. auch Literatur zu Kapitel 3
Cross, Frank, The Development of the Jewish Script. In: Wright, George Ernest (Hg.), The Bible and the Ancient Near East. Essays in Honor of William Foxwell Albright, Garden City 1961, 133–202.
Cross, Frank, Palaeography and the Dead Sea Scrolls. In: Flint, Peter/VanderKam, James (Hgg.), The Dead Sea Scrolls After Fifty Years, Leiden 1998, Bd. 1, 379–402.
Doudna, Greg, Dating the Scrolls on the Basis of Radiocarbon Analysis. In: Flint, Peter/VanderKam, James (Hgg.), The Dead Sea Scrolls After Fifty Years, Leiden 1998, Bd. 1, 430–471.
Johnson, William, Bookrolls and Scribes in Oxyrhynchus, Toronto 2004.
Jull, Timothy/Donahue, Douglas/Broshi, Magen/Tov, Emanuel, „Radiocarbon dating of scrolls and linen fragments from the Judean desert“, Radiocarbon 37 (1995) 11–19.
Leach, Bridget/Tait, John, Papyrus. In: Nicholson, Paul/Shaw, Ian (Hgg.), Ancient Egyptian Materials and Technology, Cambridge 2000, 233–253.
McLean, Mark, The Use and Development of Palaeo-Hebrew in the Hellenistic and Roman Periods, (unpubl. Ph.D. diss., Cambridge, Mass: Harvard University, 1982).
Nir-El, Yoram/Broshi, Magen. „The Red Ink of the Dead Sea Scrolls“, Archaeometry 38 (1996) 97–102.
Nir-El, Yoram/Broshi, Magen. „The Black Ink of the Qumran Scrolls“, Dead Sea Discoveries 3 (1996) 157–167.
Poole, John/Reed, Ronald, „The Preparation of Leather and Parchment by the Dead Sea Scrolls Community“, Technology and Culture 3 (1962) 1–26.
van Strydonck, Mark/Nelson, D. Erle/Crombé, Philippe/ Bronk Ramsey, Christopher./Scott, E. Marian/van der Plicht, Johannes/Hedges, Robert, Les limites de méthode du Carbone 14 appliquée à l’archéologie. In: Evin, Jacques/Oberlin, Christine/Daugas, Jean-Pierre/Salles, Jean-François (Hgg.), Actes du 3ème Congrès International 14C et Archéologie, Paris 1999, 433–448.
Tov, Emanuel, Scribal Practices and Approaches Reflected in the Texts Found in the Judean Desert, Leiden 2004.
Yardeni, Ada, Textbook of Aramaic, Hebrew and Nabatean Documentary Texts from the Judaean Desert and Related Material, Jerusalem 2000.
Wer liest, dass in Qumran Reste von etwa 1000 Schriftrollen gefunden worden sind, ist sich vielfach nicht im Klaren darüber, dass davon nur fünfzehn Texte wirklich noch wie Rollen aussehen. Fast alle anderen „Rollen“ sind in Wirklichkeit aus kleinen Fragmenten (ca. 15000 allein für Höhle 4) von der Größe einer Linse bis zu |28|einer DIN A4-Seite rekonstruiert und manche würden sogar sagen konstruiert (Tigchelaar).
Die ca. 15 wirkliche Qumranrollen15 wirklichen Qumranrollen sind die beiden Jesajarollen (1QIsaa und 1QIsab), das Genesisapokryphon (1QGenAp), der Habakukkommentar (1QpHab), die Gemeinschaftsregel (1QS), die Kriegsregel (1QM) und die Hymnenrolle (1QHa) aus Höhle 1, die Kupferrolle (3Q15) aus Höhle 3 und die Levitikusrolle (11Q1 = 11QpaleoLev), eine (ungeöffnete) Ezechielrolle (11Q4), die Psalmenrolle (11Q5 = 11QPsa), die Apokryphen Psalmen (11Q11), die Sabbatopferlieder (11Q17), das Neue Jerusalem (11Q18), die Tempelrolle (11Q19) aus Höhle 11. Dazu kommen einige wenige Einzelblätter wie 4Q175.
Jedes noch so kleine Detail, das man über den ursprünglichen Aufbau einer Schriftrolle in Erfahrung bringen kann, hilft bei der Editionsarbeit. Zunächst wusste man nur relativ wenig über den Aufbau von jüdischen Schriftrollen aus dieser Zeit. Einiges konnte man im rabbinischen Traktat Sopherim und aus dem Talmud lernen (doch sind diese viel jünger), anderes aus den griechischen Papyri aus Ägypten übertragen (doch gab es dort kaum Pergamente). Heute, nach Vollendung der Arbeit und dank der hervorragenden Studie von Emanuel Tov haben wir es leichter. Gutes Verständnis der hier nur sehr skizzenhaft erwähnten Grundlagen der Buchkunde der Rollen vom Toten Meer ist unabdinglich dafür, Fallstricke der Arbeit an höchst fragmentarischen Texten zu umgehen.
Eine ParabelParabel, um die unvorstellbare Schwierigkeit der Edition der Qumranrollen greifbar zu machen: eine Prinzessin schenkt ihrem Verehrer 1000 Puzzles (die 1000 Schriftrollen). Jedes Puzzle hat zwischen zehn und 10000 Teile (die Fragmente). Einige Puzzles zeigen das gleiche Bild wie ein anderes, aber nicht das gleiche Format oder nicht die gleiche Pappe (verschiedene Manuskripte der gleichen Komposition). Sie schüttet jedes vollständige Puzzle in eines von elf großen Fässern (die elf Höhlen), allein in Fass 4 sind zwei Drittel aller Puzzles. Dann wirbelt sie die Puzzleteile in jedem Fass durcheinander. Schließlich wirft sie 95 % der Puzzleteile aus jedem Fass weg (Verlust durch Ratten, Insekten, Feuchtigkeit, Wind und Plünderer)! In Fass 4 bleiben so fünfzehntausend Puzzleteile von ca. 600 Puzzles. Nun verlangt sie von ihrem Verehrer, ihr zu sagen, welche Teile einmal zu welchem Puzzle gehört haben und was auf den Puzzles für Motive und Details dargestellt waren.
|29|2.1 Buchform und Layout (Kodikologie)
Für Texte ein überzeugendes Layout zu erstellen ist eine hohe Kunst und beeinflusst nachhaltig unsere Rezeption des Inhaltes. Eine schön gesetzte Buchseite und ein gekritzeltes Notizblatt mögen exakt dieselben Worte enthalten, doch die Präsentationsform entscheidet, wie wir sie aufnehmen. In einer textorientierten Gesellschaft hat jeder Text „sein“ Format. Ein wissenschaftliches Buch sieht anders aus als ein Roman, eine Bedienungsanleitung ist anders aufgebaut als ein Comic.
Seit der Spätantike werden Bücher als Kodex veröffentlicht. Das wissenschaftliche Studium der Buchformen heißt Kodikologie. Vor der allmählichen Verbreitung des Kodex ab dem zweiten Jahrhundert n. Chr. war die klassische Buchform der Antike überall die Schriftrolle, lat. volumen (Johnson), so auch in Qumran. Daneben gab es für sehr kurze Texte noch das Einzelblatt. Dies ist jedoch selten (z.B. 4Q175).
Eine RolleRolle besteht aus einem oder mehreren Bögen aus Papyrus, Pergament oder Leder. Anstelle von Seiten wie in einem Kodex muss der Text einer Rolle in Spalten oder Kolumnen (engl. columns) aufgeteilt werden. Zunächst berechnet der Schreiber daher, wie viel Bögen (engl. sheets) er benötigen wird, und kauft die entsprechende Menge präparierten Beschreibmaterials. Dann markiert er Kolumnen, so dass Kolumnen und Zwischenraum möglichst gleichmäßig breit sind und das Auge die Textblöcke gut trennen kann. Bei Pergamentrollen werden zumeist auch die Zeilen mit einem scharfen Knochen o.ä. in den Beschreibstoff eingeritzt (s. KhQ 2393 in DJD 6, 25). Oft sind Bruchkanten von Fragmenten an exakt diesen Linien! Bei Papyrusrollen ist dieser Arbeitsgang nicht nötig, denn die Fasern auf der meist verwendeten Vorderseite (recto) verlaufen in Schreibrichtung. Als dritter Schritt wird die Rolle beschrieben. Zuletzt werden die Bögen miteinander verklebt (Papyrus) oder mit Flachs oder Sehnen vernäht (Pergament). Manchmal geschieht dies auch schon vor der Beschreibung.
Das FormatFormat steht in engem Verhältnis zur Textmenge, zur Qualität und zum Sitz im Leben. Lange Texte benötigen großformatigere und längere Rolle als kurze. Wertvolle Texte haben einen breiteren Rand und engere Spalten. Desweiteren hängt die Höhe stark von der Länge ab. Damit die Rolle eine Rolle bleibt, durfte sie nach dem Aufrollen nicht zu dick im Verhältnis zu ihrer Höhe sein. Aber auch für die Handlichkeit war es wichtig, die Proportionen zu wahren. Liturgische Rollen waren weniger hoch (Tov 90).
Oben und unten wird Freiraum gelassen, die sogenannten MargenMargen, da hier die größten Chancen bestehen, dass die Rolle beschädigt |30|wird und Text verloren geht. Aus dem gleichen Grund haben Rollen oft vorne und hinten eine oder mehrere unbeschriebene Spalten als eine Art Schutzumschlag, das Protokoll und das Eschatokoll. An das Eschatokoll kann ein Stab (griech. omphalos, lat. umbilicus) befestigt werden, um die Rolle leichter unbeschädigt eng rollen zu können. In Qumran sind davon nur zwei gefunden worden. Wahrscheinlich hatten viele Rollen keinen fest verbundenen Stab.
Ähnlich wie bei modernen Puzzles spielen die Randstücke bei der Rekonstruktion eine große Rolle, da man aus ihnen oft die Breite oder Höhe einer Spalte oder die Position eines Fragments auf der ursprünglichen Rolle berechnen kann. Wenn man wiederum die Höhe einer Rolle kennt, kann dies Schlüsse über den möglichen Umfang der Rolle erlauben, denn Höhe und Länge einer Rolle stehen wie gesagt in gewissen Proportionen zueinander.
Wenn wir also nur noch das Anfangsblatt einer Rolle mit geringer Höhe und nur jeweils acht bis neun Zeilen Text in einer Spalte finden, können wir daraus schließen, dass sie wohl zu klein war, um z.B. das ganze Buch Genesis enthalten zu haben. Findet man ein Fragment mit Nahtresten, weiß man, dass diese Rolle aus mindestens zwei Pergamentbögen bestand, usw.
Gegenüber Kodizes haben Rollen den Nachteil, dass man Stellen nicht einfach aufschlagen kann, sondern suchen muss, wie man es noch heute in Synagogen erleben kann. Auch muss man den Text nach der Lektüre wieder zurückrollen (ähnlich wie man es früher mit Videokassetten oder Mikrofilmen machen musste). Der Anfang des Textes sollte außen stehen, das Ende innen. Durch nur einseitige Beschriftung wird bei Rollen die Hälfte des Schreibmaterials verschwendet. Dafür scheint nie Text von hinten durch.
Für die Lektüre einer Rolle benötigt man zwei Hände, um den gelesenen und den noch zu lesenden Teil zu trennen. Hingegen ist die Berechnung der benötigten Bogenzahl einfacher als bei einem Kodex, da man bei Bedarf ein weiteres Blatt ankleben kann. Es ist nicht möglich, ein Blatt aus der Mitte einer Rolle herauszureißen, ohne dabei die Rolle zu zerteilen. Aber wenn man will oder dies wegen eines beschädigten Blattes nötig ist, kann man leichter als bei einem Kodex ein Blatt ausschneiden, ein anderes einsetzen und die Enden wieder zusammenfügen. So ein Reparaturblatt ist z.B. in der Tempelrolle eingesetzt worden (11QTa I–V). Auch eingerissene Stellen können genäht werden (z.B. 1QIsaa XII oder XVI). Manchmal wurden beschädigte Stellen auch mit einem Flicken geflickt (z.B. 11QTa XXIII–XXIV).
Pergamentrollen können mit einem Lederriemen zusammengebunden werden, damit sie sich nicht von alleine ausrollen. Dieser kann fest am Protokoll angenäht sein (wie bei 4Q448 zu sehen).
 |31|Abb. 1:
|31|Abb. 1:
4Q448 mit Verschluss
 Abb. 2:
Abb. 2:
Rekonstruktion einer Schriftrolle
|32|Festes Zusammenrollen schützt die Rolle vor Schäden. Für längere Verwahrung konnten Rollen in Tücher eingehüllt werden und in Holzkästen (capsa) oder in Krüge gelegt werden, wie das Zitat von Jeremia 32,14 oben, S. 10 belegt. Zedernöl war ein zusätzlicher Schutz vor Nagern und Insekten.
In antiken BibliothekenBibliotheken wurden Rollen wie heute Weinflaschen in ein paar Lagen übereinandergelegt. Anzeichen für derartige Regale sehen viele in den in regelmäßiger Höhe angebrachten Löchern in Höhle 4. Wie konnte man die gewünschte Rolle finden? Dazu waren in griechischen Bibliotheken an der Seite der Rolle mit einer Schnur Etiketten mit Angaben zum Inhalt des Buches angehängt. In Qumran haben wir dafür allerdings gar keine Belege. In fünf Fällen ist der Titel einer Rolle quer auf ihre Rückseite geschrieben, so dass man, ohne die Rolle öffnen zu müssen, erkennen kann, was sie enthält (z.B. 1QS, 4Q249). In den meisten Fällen scheint dies aber nicht der Fall gewesen zu sein. Wir wissen also nicht, wie die jeweilige Rolle lokalisiert werden konnte.
Unterschiedliche Materialien dienen zum Schreiben. Man unterscheidet zwischen SchreibgerätSchreibgerät (z.B. Calamus, Feder, Finger, Meißel, Stein), BeschreibstoffBeschreibstoff (z.B. Leder, Pergament, Papyrus, Stein, Metall, gebrannte und ungebrannte Keramik, Holz, Palmblätter, Knochen, Wachstafeln) und SchreibstoffSchreibstoff (z.B. Rußtusche, Eisengallustinte, Zinnobertusche, Kohle, Kreide).
Die meisten Qumranrollen sind auf präparierten TierhäuteTierhäuten geschrieben, die mindestens seit 2000 v. Chr. als Beschreibstoff benutzt werden. Zu Leder oder Pergament verarbeitet hat Haut hervorragende Qualitäten. Sie ist weich, glatt, je nach Tier großflächig, relativ dünn und doch reißfest und kann Tinte und Tusche gut aufnehmen. Je nach Tier ist die Farbe homogen hell und bietet einen augenfreundlichen Kontrast zum Schreibstoff. Die Qumranrollen zeigen, dass sie unter optimalen Bedingungen extrem lange hält. Durch Zusammennähen können Bögen zu Rollen vernäht werden, um auch umfangreiche Texte aufzunehmen. Nur die Handlichkeit setzt dem Grenzen.
Bei der Präparierung wird zunächst die abgezogene Haut für die Konservierung in eine Salzlösung eingelegt. Dann wird sie eingeweicht, um das Salz und möglichst viele Haare, Fett und Verunreinigungen zu entfernen. Danach wird sie auf einem Rahmen befestigt, getrocknet und noch einmal mit Messern oder Bimssteinen sehr gründlich glatt gerieben. Möchte man die Haut zu Leder machen, wird sie abschließend gegerbt, d.h. mit speziellem Gerbstoff behandelt. Anders als Leder wird PergamentPergament gewöhnlich nicht gegerbt, sondern durch sehr große Spannung, bei der sich die Kollagenfasern in Schichten parallel legen, hergestellt (Poole/Reed). Dies |33|macht Pergament im Gegensatz zu Leder extrem formbeständig. Die meisten Qumranrollen sind wie Pergament durch Spannung hergestellt worden, doch sind sie – anders als die meisten antiken Pergamente – mit Gerbstoff behandelt worden, im Unterschied zu Leder allerdings nur sehr oberflächlich.
Die beiden FleischseiteSeiten einer Haut haben unterschiedliche Qualitäten. Die Fleischseite ist glatter, die HaarseiteHaarseite weist Poren auf. Spätere rabbinische Vorschriften unterscheiden zusätzlich zwischen ungespaltenem Leder, (gvil, auf der Haarseite beschrieben), feinem gespaltenem Leder (klaf, auf der Fleischseite beschrieben) und dyskhistos/dixystos/dixestos (auf der Haarseite beschrieben). Fast alle Qumranrollen sind aus ungespaltenem Pergament. Dieses wurde fast immer auf der helleren Haarseite beschrieben, die zur Rußtusche den stärkeren Kontrast bietet.
Um PapyrusPapyrus herzustellen, werden entrindete Papyrusstauden in dünne gleichmäßig breite Streifen geschnitten und in Wasser eingelegt (Leach/Tait). Die nassen Streifen werden eng längs nebeneinandergelegt. Auf diese erste Schicht wird eine zweite ebensolche Streifenschicht quer aufgelegt. Mit Druck werden beide Schichten übereinander geklebt und bilden ein haltbares Ganzes. Schließlich schneidet man die Ränder so, dass gleichformatige Bögen entstehen, die zu Rollen zusammengeklebt werden können. Dabei werden die Blätter so gelegt, dass auf einer Seite die Papyrusfasern immer in Schreibrichtung verlaufen. Diese nennt man recto. Die andere Seite heißt verso. Die Recto-Seite des Papyrus hatte also gegenüber Pergament den Vorteil, dass man wegen der Faserrichtung keine zusätzlichen Linien ziehen musste, um gerade zu schreiben. Das erste Schutzblatt, das Protokollon, wurde gewöhnlich mit recto nach außen angeklebt.
Nur etwa ein Achtel aller Qumrantexte sind auf Papyrus geschrieben. Davon sind viele Dokumente oder Privatabschriften in semikursiver Schrift. Papyrus ist leichter korrigierbar als Pergament, da man die Tinte nur abwaschen muss, während sie in das Pergament tief eindringen kann. Die spätere rabbinische Halakha verbietet, biblische Texte auf Papyrus zu schreiben. Im Vergleich zu Pergament zerfällt Papyrus in viel kleinere, oft rechteckige Fragmente, die den Rändern der Papyrusstengel folgen (s.o. das Zitat von Baillet, S. 21f). Dafür bleibt normalerweise der gute Kontrast zwischen Tinte und Hintergrund erhalten, so dass man weniger auf Infrarotfotos angewiesen ist. Sowohl bei Leder/Pergament als auch bei Papyrus gibt es große Qualitätsunterschiede im Blick auf Dicke und Festigkeit, Glätte und farbliche Homogenität, Weichheit sowie Narben, Löcher und Sichtbarkeit von Adern.
|34|Um Materialkosten zu sparen, wurden Papyri manchmal komplett abgewaschen oder Leder/Pergamente abgeschabt und mit einem anderen Text wieder beschrieben. Dies nennt man PalimpsestPalimpsest von griech. palin (wieder) und psēstos (abgeschabt) (4Q249, 4Q457a, 4Q457b, 4Q468e, s. Tov, 73). Wenn eine Rolle beidseitig beschrieben ist (vgl. Ez. 2,10 und Apk. 5,1), spricht man von Opisthograph, von griech. opisthen (von hinten) und graphein (schreiben) (Tov, 68–73). Das ist abgesehen von Gebetsriemen und Dokumenten selten. Fast immer enthalten Qumranrollen nur einen einzigen Text (Ausnahmen sind z.B. 1QS und das Opisthograph mit 4Q509 + 4Q505 auf der einen Seite und 4Q496 + 4Q506 auf der anderen).
Dokumente wurden oft zunächst auf eine Tonscherbe als eine Art Kladde geschrieben. Glatte Tonscherben gab es im Überfluss und umsonst. Man nennt derartige Texte Ostrakon (pl. Ostraka). Andere weitverbreitete Medien sind Stein und Mosaik. Inschriften auf Stein gibt es in Qumran kaum, auf Mosaik gar nicht. Die Kupferrolle ist auf Metall geschrieben worden (s.u. S. 163f), das – abgesehen von Amuletten – nur selten für Texte verwendet wurde.
Fast alle Qumranrollen wurden mit schwarzer RußtuscheRußtusche geschrieben (Nir-El/Broshi, „The Black Ink“). Eisengallustinte ist in Qumran noch nicht bezeugt. Wie moderne chinesische Stangentusche wurde Rußtusche in festen Blöcken verkauft. Vor jeder Benutzung wurde ein kleines Stück von diesem Block an einem Stein zu Pulver zerrieben und dann in einem Tintenfass mit Wasser vermischt, in welchem die Rußteilchen und Bindemittel schweben. Einmal auf dem Beschreibstoff aufgetragen verdunstet das Wasser und die kleinen Rußteilchen haften dank Bindemittel auf der Oberfläche und bieten einen hervorragenden Kontrast. Anders als Tinte, in der der Farbstoff völlig aufgelöst ist und die Flüssigkeit selbst farbig ist, dringt Tusche nicht in den Beschreibstoff ein und kann einfach wieder abgekratzt oder abgewaschen werden.
Einige wenige Rollen wie das Genesisapokryphon zeichnen sich durch ein Kupferfraß genanntes Phänomen aus: das Leder ist genau dort zerfressen, wo ursprünglich einmal Buchstaben standen. Diese Rollen sind sehr viel schwerer zu entziffern und in einem wesentlich schlechteren Erhaltungszustand. Vielleicht liegt dies an anderen Bindemitteln oder an Metallen – wie Kupfer –, die der Tusche zugesetzt wurden. Schließlich wurde ganz selten, genau gesagt in vier Fällen (z.B. 4QNumb), auch zinnoberrote Tusche benutzt, um Textabschnitte farblich ähnlich wie Rubriken in mittelalterlichen Handschriften zu kennzeichnen.
|35|Als Schreibgerät diente wahrscheinlich hauptsächlich ein aus Schilf geschnittenes Schreibrohr, lat. calamus, hebr. qulmus. Die Schøyen-Sammlung besitzt einen angeblich aus Höhle 11 stammenden CalamusCalamus. Schilfrohre sind billig und praktisch und relativ leicht herzustellen sowie individuell anpassbar. Man kann die Spitze eines Schreibrohrs unterschiedlich anspitzen, um die Ansatzpunkte und die Proportionen von waagerechten und senkrechten Strichen zu ändern oder individuellen Schreibwinkeln gerecht zu werden (s.u. Paläographie).
2.2 Vom Fragment zur Transkription
Da der Text nicht überall lesbar war, entwickelten die Editoren ein System, um sichere, wahrscheinliche und mögliche Lesungen von Rekonstruktionen zu unterscheiden.
| Lücken im Fragment werden durch eckige Klammern angedeutet. Text[ ]TextText[ ]Text |
| Wird in derartigen Lücken Text rekonstruiert, wird er in die eckigen Klammern der Lücke gesetzt, und zwar sowohl im hebräischen Original als auch in der Übersetzung. Text[Rekonstruierter Text]TextText[Rekonstruierter Text]Text |
| Ein von einem der antiken Schreiber als gelöscht markiertes Wort wird mit geschweiften Klammern angezeigt. Text{gelöscht}TextText{gelöscht}Text |
| Wenn ein Teil einer Zeile leer ist, steht dort vacatvacat (lat. leer). |
| Margen oben oder unten werden explizit gekennzeichnet (z.B. „top margin“). |
| Eine wahrscheinliche Lesung eines unvollständigen Buchstabens wird durch einen kleinen Punkt über diesem Buchstaben angedeutet. א̇א̇ |
| Eine mögliche, aber unsichere Lesung eines unvollständigen Buchstabens wird durch einen offenen Kreis über diesem Buchstaben angedeutet: ד֯ד֯ |
| Bei beiden Fällen ist speziell für Nichthebraisten besondere Vorsicht geboten, denn dies wird in den Übersetzungen im besten Fall mit einer Fußnote angegeben, im Normalfall gar nicht. |
| Ist der Buchstabenrest so klein, dass man nur noch angeben kann, dass hier etwas stand, aber nicht was, steht statt eines Buchstabens nur ein großer Kreis.○ |
| Wird in der Übersetzung ein Wort ergänzt, das im Original dort nicht steht, aber für die Verständlichkeit notwendig ist, steht diese (Ergänzung)(Ergänzung) in runden Klammern. |
Als Grundregel gilt: Je kleiner die Fragmente, desto mehr unvollständige und daher unsichere Buchstaben und Worte. Steht in einer |36|Zeile nur ein Wort oder gar ein Teilwort ohne Kontext oder sind viele Buchstaben „bepunktet“ ist die Übersetzung oft hypothetisch. Auch wer kein Hebräisch kann, sollte immer auch auf die Transkription des Fragmentes schauen. Die Zeilennummer lässt klar erkennen, wo der Editor die Lesart für sicher oder nur für möglich hält.
Wer des Hebräischen mächtig ist, kann sich an folgendem Fragment spielend einüben. Andere können zumindest ihr Verständnis des Transkribierungssystems testen. Wie viele Zeilen hat das Fragment? Können wir seinen Platz in der Kolumne bestimmen (oben, unten, rechts, links)? Gibt es andere Merkmale (z.B. Linierung oder Nahtlöcher)? Können Sie den Leerraum zwischen Wörtern von dem zwischen Buchstaben unterscheiden? Welche Schriftart ist in der Schriftentabelle der Schrift dieses Fragments am ähnlichsten? Machen Sie sich dann an die fünf klar lesbaren Wörter. Zwei Hinweise: Waw und Jod werden in dieser herodianischen Schrift nicht unterschieden. He unterscheidet sich von Chet darin, dass es links ein Vordach hat, während Chet zwei Stangen mit durchhängender Wäscheleine ähnelt. Lassen Sie sich bei der Entzifferung des letzten Wortes der dritten Zeile nicht durch das Loch und die für Sie etwas ungewöhnliche Orthographie verwirren!
 Abb. 3:
Abb. 3:
4Q286 fr 20a
Wenn Sie die fünf ganzen Worte entziffert haben, versuchen Sie sich an den Buchstabenresten. Wie viele Buchstaben sind vor dem |37|Wort in der ersten Zeile erkennbar? Spielen Sie alle Möglichkeiten durch! Warum kann es (normalerweise) kein Nun oder Tzade sein? Welcher Buchstabe bleibt als einzige Möglichkeit übrig? Wie viele Buchstabenreste sehen Sie in der zweiten Zeile vor den beiden gut lesbaren Worten? Für den ersten Buchstaben gibt es nur eine Möglichkeit und für den letzten auch! Sehen Sie den relativ undefinierbaren Buchstabenrest in der vierten Zeile? Wie viele Buchstaben können Sie in der fünften (!) Zeile ausmachen, zwei oder drei? Besuchen Sie die Webseite des Leon-Levy Archivs der IAA und lokalisieren Sie 4Q286! Finden Sie ein Foto mit „Ihrem“ Fragment? Vergrößern Sie es, bis Sie die drei Buchstabenreste sehen! Ähnelt Ihre Transkription der unten angegebenen? Achten Sie vor allem auf die Punkte und Kreise. Wenn Sie wissen wollen, wie die Editorin auf die umfänglichen Rekonstruktionsvorschläge gekommen ist, schauen Sie sich den Kommentar der Editorin Bilhah Nitzan in DJD 11, S. 42 an.
| 4Q286 20a 1–5 | |||
| 1 | מחשב]ת֗ צדק | ] [ | ] gerechtes [Denke]n |
| 2 | מצות]מה יוכיחנו וירחם | ] [ | nach] ihren [Geboten] wird er uns ermahnen und er wird sich erbarmen |
| 3 | מיום] ל֗[יו]ם֗ לוא | ] [ | von einem Tag] zum [ander]en [wird er] nicht |
| 4 | אנש]י֯ היחד | ] [ | die Männ]er der Gemeinschaft (jachad) |
| 5 | מעשי] ר֗מ֯[י]ה֯ | ] [ | Taten] der Arg[li]st |