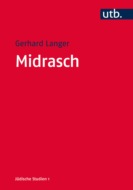Kitabı oku: «Qumran», sayfa 6
Wie auch immer es sei, viele Sätze in 4Q431 und 4Q491 Frag. 11 sind gleich. Allerdings längst nicht alle Sätze, und oft erscheinen sie in anderer Reihenfolge. Eine maximalistische Position der Mehrheit deutet 4Q431 und 4Q491 als zwei Rezensionen eines Textes. Die minimalistische Gegenposition sieht dagegen zwei getrennte Texte. Maximalisten benutzen Daten aus einer Rezension für die Interpretation der anderen, in der diese fehlen. Minimalisten lehnen dies ab (s. den Forschungsbericht bei García-Martínez, in diesem Fall selbst ein Minimalist). Die Konsequenzen sind immens: Für die Maximalisten handelt es sich um einen menschlichen Sprecher, der bei Gott wohnt und sich den Göttern/Engeln überlegen fühlt, vielleicht den Lehrer der Gerechtigkeit, vielleicht einen eschatologischen Priester, vielleicht jedes die Hymne rezitierende Gemeindemitglied. Für den Minimalisten ist es eine engelhafte Figur, z.B. Michael. Wie gesagt, dies ist ein Extrembeispiel, wenn auch ein besonders wichtiges (wir werden es im Teil über die Geschichte des Jachad genauer besprechen, S. 274). Die meisten Fälle sind wesentlich klarer.
3.2 Von der Fragmentengruppe zur Reihenfolge
Wenn ein Editor eine Fragmentengruppe, eine „Rolle“, zusammengestellt hat, liegt vor ihm immer noch die Aufgabe, die Fragmente in eine Reihenfolge zu bringen. Für die biblischen und anderen bekannten Texte (also alle Paralleltexte zu den „großen“ Rollen) ist dies, wenn die Fragmente nicht allzu klein waren, eine lösbare Aufgabe. Gibt es mehrere Handschriften mit parallelem Text, helfen die Details jedes Zeugen zur Entschlüsselung der Lesungen und Reihenfolge der anderen (so z.B. besonders für das Apokryphon Jeremias C und für 4Q434–438 Barkhi Nafschi). Ansonsten kann der Inhalt dem Ordnungsbewusstsein des Editors Hilfestellung leisten. Im schlimmsten Fall bleibt nur die Zuflucht zur Sortierung nach Größe.
Für die Rekonstruktion einer Rolle ist der Nachvollzug des Zerstörungsvorgangs entscheidend, ähnlich wie für Polizisten die Tatrekonstruktion. |54|Hartmut Stegemann und seine Göttinger Schüler, allen voran Annette Steudel, haben diese Methodologie am weitesten entwickelt. Dabei sind weniger der Text, sondern vielmehr die Konturen der Fragmentränder und wiederkehrende Löcher in den Fragmenten entscheidend. Oft sind Fragmentenstapel das Endresultat einer ursprünglich zusammengerollten Schriftrolle, die von Nagern zerfressen, von Würmern durchbohrt oder von Feuchtigkeit von innen oder von außen zersetzt worden ist. Ist sie zum Beispiel stehend in einem Krug aufbewahrt worden, wird ein Teil der Zerstörung durch ihr eigenes Gewicht verursacht und es fehlt dann der untere Teil (Pfann). Oft haben Rollen von innen so starken Druck gegen ihren eigenen Verschlussriemen ausgeübt, dass sie sich selbst zweigeteilt haben. Nähte, immer etwas dicker als der Rest eines Pergamentbogens, haben auf den Rücken der darüber gelegenen Windung gepresst – bis dort ein Riss entstanden ist. Vielfach verlaufen Bruchkanten gerade entlang der Linien, die mit einem scharfen Gegenstand gezogen worden waren, um dem Kopisten den Zeilenabstand oder die Spaltenmargen anzudeuten.
Der Stapel repräsentiert die Abfolge der Fragmente in den einzelnen Windungen der Rolle. Zwar war der Text stets auf der Innenseite, doch wissen wir nicht, ob die Rolle nach ihrer letzten Benutzung korrekt zurückgerollt worden war (wie man es früher oft und heute manchmal noch bei einem Mikrofilm in der Bibliothek vorfinden kann). War der Textanfang (das rechte Ende der Rolle) außen und das Textende (das linke Ende der Rolle) innen, konnte sie mit ihrem Verschluss verschlossen werden. Dann war sie oft enger zusammengerollt als eine Rolle, die nach dem Lesen nicht wieder korrekt zurückgerollt worden war. War der Textanfang innen, liegt das textlich erste Fragment im Stapel zuunterst.
Manchmal kann man derartige Stapel auch aus Einzelfragmenten rekonstruieren. Hier kommt die Stegemann-Methode ins Spiel. Die zerstörerische Arbeit der Nager und Mäuse hat nämlich oft mehrere Schichten sehr ähnlich betroffen. Man kann es anhand eines zusammengerollten Crêpes leicht zu Hause ausprobieren.
Ursprünglich übereinander lagernde Fragmente haben dann ähnliche Konturen oder einen Fleck, ein Loch, einen Spalt an der Stelle, wo sie früher einmal übereinander gelegen hatten. Die gleichen Konturen oder der gleiche Schaden wiederholen sich in berechenbaren Abständen. Es lohnt sich, auf der Website des Shrine of the Book die dort präsentierten fünf kompletten Schriftrollen anzuschauen und ihre Ränder auf wiederkehrende Zerstörungsmuster zu prüfen. Eine Rolle ist eine archimedische Spirale, oder vereinfacht gesprochen eine Gruppe konzentrischer Kreise, deren Umfang (nach der Formel U = 2∙π∙r) mit nach innen abnehmendem Radius |55|immer kleiner wird. Von außen nach innen wird der Abstand zwischen jeder Schicht immer um 0,1 bis 0,3 cm geringer. Wie viel genau hängt von der Pergamentdicke ab, und davon, wie fest die Rolle zusammengewickelt gewesen ist. So lassen sich plötzlich aus scheinbar völlig unverbundenen Fragmenten ganze Rollen rekonstruieren. Viele Editoren haben diese erst nach 1960 entwickelte, sehr zeitaufwendige Methode nicht verwendet, so dass hier in der Zukunft noch neue Erkenntnisse zu erwarten sind.
3.3 Abkürzungssystem
Das Transkriptionssystem haben wir oben schon erklärt. Zur eindeutigen Identifizierung eines jeden Fragments auf den Glasplatten in der Scrollery und in der vorläufigen Konkordanz brauchten die Teammitglieder ein genaues Abkürzungssystem. Das heutige AbkürzungssystemAbkürzungssystem ist angesichts der sehr komplexen Daten sehr einfach: Von links nach rechts vom Groben ins Feine: Zunächst Höhle, Ort, Rolle. Für genaue Angaben einer Stelle arbeitet man nicht mit Kapitel und Vers, sondern mit Fragment und/oder Spalte und Zeile.
| Ort | Rolle | Fragment | Spalte | Zeile | ||
| 11Q5 XXVII 4 | = | Höhle 11 in Q(umran) | 5 | 27 | 4 | |
| 4Q387 2 iii 5 | = | Höhle 4 in Q(umran) | 387 | 2 | 3 | 5 |
| 1Q19 8 2–3 | = | Höhle 1 in Q(umran) | 19 | 8 | 2–3 |
Wenn ein Fragment nur eine Spalte hat, wird die „I“ nicht angegeben, und wenn eine Rolle nur aus einem Fragment besteht, wird die Fragmentnummer „1“ nicht angegeben. Manche schreiben vor die Fragmentnummer ein kleines „fr.“ oder „frag.“ oder setzen die Zeilennummer in einem kleineren Schrifttyp. Nun gibt es manchmal die Situation, dass ein großes Fragment Text von mehreren Spalten enthält, man aber nicht weiß, welche Spalten dies im ursprünglichen Originaldokument einmal waren (4Q387 oben). Dann benutzt man statt Großbuchstaben Kleinbuchstaben für die römischen Zahlen (i,ii,iii, etc.). Römische Zahlen in Großbuchstaben trifft man eher bei den gut erhaltenen Schriftrollen an, denn aus einer Spalte in einem Fragment auf die Stelle der ursprünglichen Spalte in der Rolle schließen zu können, ist sehr schwierig. Leider halten sich nicht alle Forscher an diese Konvention.
Eine Rolle ist über ihre Nummer eindeutig identifizierbar. Diese Nummer ist nicht willkürlich. Bei jeder Höhle erhielten die biblischen |56|Fragmente die niedrigen Nummern in der Reihenfolge der biblischen Bücher. Auch die anderen Handschriftengruppen sind nach Möglichkeit mit aufeinander folgenden Nummern versehen worden. So sind z.B. 4Q256 bis 4Q264 neun Handschriften der Gemeinschaftsregel (S) und 4Q266 bis 4Q273 sind acht Kopien der Damaskusschrift (D). Für das Finden der Edition zu einer mit Nummer angegebenen Schriftrolle ist die von Emanuel Tov veröffentlichte Liste aller Rollen vom Toten Meer (Tov, Revised ListsTov, Revised Lists), die die Angaben im Einleitungsband zu Discoveries in the Judean Desert (DJD 39) auf den neuesten Stand bringt, ein unabdingliches Arbeitsinstrument. In Revised Lists findet man für jede Schriftrolle geordnet, nach Fundort, Höhlennummer und Rollennummer:
1 ihren offiziellen Namen (z.B. 1Q8 = 1QIsab)
2 ihre Inventarnummer (um zu wissen, in welchem Museum oder in welcher Sammlung man die physischen Fragmente heute unter welcher Nummer einsehen kann)
3 eine Liste aller Fotos (um die Editionsarbeit nachvollziehen zu können)
4 den Literaturnachweis einer Edition
5 Verweise auf nicht mehr gültige Abkürzungen aus der Zeit der Scrollery, die manchmal in vorläufigen Veröffentlichungen verwendet worden sind.
Hier eine Liste der wichtigsten Fundorte (s.u. S. 129–132) und ihrer Abkürzungen:
XQXQ (X = Qumran, aber unbekannter Fundort – meist für Fragmente in Privatsammlungen vom Schwarzmarkt).
KhQKhQ für Ostraka aus Khirbet Qumran (Khirbet = Ruine), d.h. der Siedlung.
WDSPWDSP = Wadi Daliyeh (Samaritanische Papyri), etwa 25 km nördlich vom Toten Meer.
MurMur = Wadi Murabbaat. Texte aus der Zeit der zweiten jüdischen Revolte, unter Bar Kosba.
5/6Hev5/6Hev = Nahal Hever, die Höhle mit Eingängen 5 und 6, ca. 38 km südlich von Qumran, etwa 5 km südlich von Ein Gedi. Texte aus der Zeit der zweiten jüdischen Revolte, unter Bar Kosba
34Se34Se = Nahal Seelim Höhle 34, etwa 50 km südlich von Qumran. Texte aus der Zeit der zweiten jüdischen Revolte, unter Bar Kosba
MasMas = Masada, die Festung Herodes etwa 55 km südlich von Qumran. Texte vom Ende der Epoche des Zweiten Tempels.
CC = Cairo (nur für die Damaskusschrift aus der Kairoer Geniza). Mittelalterliche Dokumente, von denen einige aus der Antike stammen.
Nur in Masada und in der Geniza wurden mit Qumrantexten verwandte nicht-biblische Rollen gefunden.
|57|Wer sich auch nur nebenbei mit Qumran beschäftigen wird, für den wird die Liste mit den offiziellen Namen und einer wichtigen Edition zum ersten Anlaufpunkt werden. Manchmal stellt sich aber das umgekehrte Problem. Ein Artikel zitiert eine Schriftrolle mit Namen und man möchte wissen, welche Nummer sich hinter diesem Namen verbirgt.
Viele Forscher benutzen verschiedene Namen für die gleiche Rolle (oder den gleichen Namen für unterschiedliche Rollen). Um die Identifikationsnummer einer mit einem Namen angegebenen Schriftrolle zu finden, sollte man entweder Maiers Übersetzung oder die Liste im Anhang der Study Edition von García Martínez und Tigchelaar konsultieren. In Zukunft wird vermutlich das Internet diese Katalogfunktion übernehmen, vor allem die Großprojekte des Qumranwörterbuchs in Göttingen (s.o. S. 63) und des Leon-Levy Archivs in Jerusalem, die jetzt über Scripta Qumranica Electronica verbunden werden. Auch DJD 39 enthält noch viele andere Listen, die von bleibendem Wert sind.
Die meisten Abkürzungen der Kompositionsnamen erschließen sich von selbst. Ist es nur ein Großbuchstabe S, D, M, H, T(S, D, M, H, T), handelt es sich um eine der wichtigen großen Rollen. Ein kleines Präfix pp vor einer Abkürzung für ein biblisches Buch steht für Pescher (z.B. 1QpHab, 4QpPs). Wenn eine „Handschrift“ nicht der Standardgruppe der hebräischen Texte in judäischer Schrift auf Pergament zugehört, die ca. 80 % des Materials darstellen, enthalten Namensabkürzungen auch immer wertvolle Informationen über Material (pap
paleo
cryptA
gr
ar
nabpap = Papyrus), Schrifttyp (paleo = Paläohebräisch; cryptA = kryptisch Typ A) und/oder Sprache (gr = griechisch, ar = aramäisch, nab = nabatäisch).
Zwei Fälle verdienen eine Erklärung:
1 Gibt es mehr als eine Rolle der gleichen Kompositionen in ein und derselben Höhle wird durch einen hochgestellten Kleinbuchstaben nach dem Namen oder der Abkürzung angezeigt, ob es sich um das erste, zweite etc. Exemplar dieser Komposition aus dieser Höhle handelt, z.B. 2QExa2QExa = 2QExodusa = 2Q2; 2QExb = 2QExodusb = 2Q3.
2 Manchmal lassen sich Handschriften formell und inhaltlich ungefähr einem Genre zuweisen. Dann erhält der Text gewöhnlicherweise einen recht allgemeinen Namen wie etwa „Halakha“ oder „Calendrical Document“. Wenn man nun aufgrund von Schrift und Material derartige Fragmente auf mehrere Handschriften aufteilt, kann man oft nicht sicher sein, ob diese Handschriften Kopien des gleichen Werkes waren oder unterschiedliche Werke des gleichen Genres darstellen. Letzteres wird durch einen Groß|58|buchstaben nach dem Namen angezeigt: Z.B. 4QHalakha A4QHalakha A (4Q251), 4QHalakha B (= 4Q264), 4QHalakha C (472a). Der Unterschied zwischen dem kleinen hochgestellten a und dem Großbuchstaben A ist also signifikant.
3 Beide Fälle können auch zusammen vorkommen. Zum Beispiel gibt es drei unterschiedliche Kompositionen, die Apokryphon Jeremias genannt worden sind, also ein Apokryphon Jeremias A, ein Apokryphon Jeremias B und ein Apokryphon Jeremias C. Von der dritten Komposition gibt es mehrere Handschriften, z.B. 4Q387 = 4QApocJer Cb = 4QApokryphon Jeremias Cb. Dies ist also die zweite Handschrift vom Apokryphon Jeremias C aus Höhle 4.
Beide Systeme, Nummern und Namen, haben ihre Vor- und Nachteile. Nummern sind eindeutig und inhaltsneutral. Sie sind aber ähnlich undurchschaubar für Außenstehende und Neulinge wie Angaben für neutestamentliche Papyri (z.B. P66). Namen wiederum sind einfacher verständlich, doch implizieren sie eine Deutung des Inhalts oder Genres, die oft hypothetischer ist als die Nummer. Außerdem hat im Laufe der Editionsgeschichte manch eine „Handschrift“ verschiedene Namen erhalten, und es ist vor allem bei älteren Veröffentlichungen nicht immer ganz einfach zu ergründen, welche Handschriftennummer sich hinter welchem Namen verbirgt.
3.4 Alte Fotos und neue Bildtechniken
Gute Fotos gehören seit Trevers Fotografien im Februar 1948 untrennbar zur Editionsarbeit an den Qumranrollen und -fragmenten (ebenso wie zu archäologischen Ausgrabungen). Tiefergehende Einblicke verschaffen die oben angeführten Artikel in die Technik und Geschichte der Fotografie der Qumranrollen.
Neben sichtbaren Wellenlängen kann man auf Fotos auch Wellenlängen erkennbar machen, die unserem Auge sonst unsichtbar sind. Das menschliche Auge nimmt Licht in Wellenlängen zwischen ca. 400 und 750 Nanometern wahr. Länger- oder kurzwelligere Strahlung benötigt andere Rezeptoren. Diese können mit Hilfe von Spezialfilmen oder -filtern, die gleichzeitig das uns sichtbare Licht unterdrücken, die unsichtbaren Wellenlängen für uns sichtbar machen. In den ersten fünfzig Jahren wurde dies vor allem für InfrarotfotosInfrarotfotos mit langwelligem Licht gemacht. Dies war nötig, da viele Pergamentfragmente sich so dunkel verfärbt hatten, dass sie für das bloße Auge unlesbar waren und die Tinte nur auf Infrarotfotos |59|sichtbar gemacht werden konnte. Wärmestrahlen werden vom in der Tinte konzentrierten Kohlenstoff stark absorbiert, während auch dunkles Pergament sie mehr reflektiert. So wirkt auf Infrarotfotos auch nachgedunkeltes Pergament hell, die Tinte aber tiefschwarz. Allerdings sind alle alten Infrarotfotos nur Schwarz-weiß-Fotos. Es ist daher oft unmöglich zu unterscheiden, ob ein schwarzer Fleck das Resultat von Tinte, einem Loch oder einem Schatten darstellt. Außerdem geht fast alle Information über die Farbe und Oberflächenstruktur der Fragmente verloren. UV-Licht kann wiederum Informationen zu nachträglichen Interventionen (z.B. Abkratzen) oder früheren Schriften (Palimpseste) sichtbar machen.
Da die Qumranfragmente langsam zerfallen oder zu Gelatine werden, sind gerade alte Fotos oft Zeugen für inzwischen verlorengegangene Ränder (wichtig für „joins“) und für eventuell darauf noch erkennbare und inzwischen verschwundene Buchstabenreste. Manchmal kann man auch erkennen, dass ein Fragment in Wirklichkeit noch ein Klumpen („wad“) mit mehreren aufeinander gestapelten Fragmenten ist. Die neuesten Fotos hingegen zeigen oft den Endzustand des Mega-Puzzles, die „material joins“ und die „distant joins“. Die Fotos aus der Zwischenzeit zeigen, inwiefern die Editoren ein Fragment konstant einer Fragmentemgruppe zugeordnet haben oder inwiefern sie eventuell stark zwischen mehreren Fragmentengruppen geschwankt haben. Wenn man sich intensiv mit einem Text auseinandersetzt, können derartig zwischen verschiedenen Plates oszillierende Fragmente ein hilfreiches Warnsignal sein, ihre angebliche Zugehörigkeit zur „Rolle“ besonders genau nachzuprüfen.
Zu ihrer eindeutigen Identifizierung tragen auch die Fotos ein Sigel. PAM 41.696PAM 41.696 ist ein typisches Beispiel. PAM zeigt an, dass das Foto aus der Zeit des Skriptoriums im Palestine Archaeological Museum (PAM) stammt. Die ersten beiden Ziffern geben die Fotoserie (zwischen 40 und 44) an. Die drei letzten Ziffern sind die Nummer des Fotos in dieser Serie. Tovs Revised Lists listet für jede Rolle viele Fotos auf. Die Fotos sind von Tov in einer Mikrofichesammlung und von Alexander und Lim in Brills Dead Sea Scrolls-Datenbank von 1997 in der Form elektronisch bearbeiteter Scans veröffentlicht worden. Brills neuere Datenbank von 2006 enthält meist nur das letzte Foto für ein Fragment und dies nur für die nicht-biblischen Texte. Die Accordance-Datenbanken für die biblischen und die nicht-biblischen Texte enthalten ebenfalls nur ein Foto pro Fragment. Auch die Effekte der Bildbearbeitung vor der Digitalisierung sollte man beachten. Die Unterschiede der Scans von 1997, 2006 und 2013 sind erheblich. In jüngster Zeit sind die |60|meisten Fotos in hochauflösenden Scans über das Leon-Levy Digital ArchiveLeon-Levy Digital Archive der Israel Antiquities Authority gratis zugänglich gemacht worden http://www.deadseascrolls.org.il/.
Heute geht man über zur multispektrale Digitalfotografiemultispektralen Digitalfotografie, die mehrere Belichtungen mit Strahlenquellen von unterschiedlichen ausgewählten Wellenlängen übereinanderlegen kann, von ultraviolett über sichtbares Licht zu Infrarot und sogar Röntgenstrahlung. Elektronische Bildformate ermöglichen dann das Ausblenden und das Übereinanderlegen verschiedener Bilder, so dass der Nutzer auswählen kann, welches Bild ihm die für den jeweiligen Moment beste Information bietet.
Eine große Schwierigkeit ist, dass die Fotos zweidimensionale Darstellungen dreidimensionaler Objekte sind. Wenige Fragmente liegen völlig plan. Die Ausleuchtung war in den fünfziger Jahren lange nicht so professionell wie heute, so dass Fragmentränder und -erhebungen Schatten bilden. Besonders Bruce Zuckerman hat sich als Fotospezialist für antike Inschriften und Fragmente einen Namen gemacht. Vielversprechend ist die RTI-Technik (Reflectance Transformation ImagingReflectance Transformation Imaging), die es dem Benutzer ermöglicht, auf dem Computer das Bild mit unterschiedlichen Belichtungsrichtungen interaktiv zu modifizieren und auch der Dreidimensionalität nahe zu kommen.
Revolutionäre Einsichten für die Rekonstruktion von Qumranrollen und für die Geschichte ihrer antiken Besitzer verdanken wir materialwissenschaftlichen Forschungen der letzten Jahre, die an die Fernsehserie CSI erinnern (Rabin). Eine ihrer Methoden ist die Röntgenfluoreszenzspektroskopie XRFRöntgenfluoreszenzspektroskopie (XRF = X-Ray Fluorescence), dazu Raman und PIXE. All diese Analyseformen informieren uns über die chemische Zusammensetzung eines Objektes an einer bestimmten Stelle.
Ein Team um Ira Rabin und Oliver Hahn hat mit XRF die Tusche einiger Qumranfragmente, darunter auch der Hymnenrolle (1QHa), untersucht. Die Analyse ergibt, dass diese Tusche (nicht aber das Pergament) im Verhältnis zu Chlor einen außergewöhnlich hohen Bromanteil enthält. Zur Erinnerung: Tusche wird direkt vor ihrer Benutzung hergestellt, indem man von einem Tuscheblock etwas abkratzt und die Körnchen mit Wasser vermischt (s.o. S. 34). Derartige Brom-zu-Chlor-Konzentrationen finden sich aber nur im Wasser um das Tote Meer. Die Tusche für diese Rolle wurde also mit Wasser aus der Gegend Qumrans (oder eines anderen Ortes in der Region um das Tote Meer) angerührt. Zumindest diese Rolle ist also am Toten Meer geschrieben worden, höchstwahrscheinlich in Qumran.