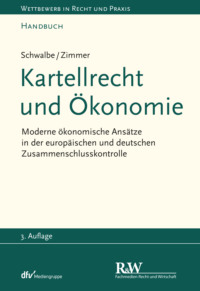Kitabı oku: «Kartellrecht und Ökonomie», sayfa 11
C. Feststellung von Marktmacht und Marktbeherrschung
Um das Vorhandensein eines unabhängigen Verhaltensspielraums und damit das Bestehen einer Einzelmarktbeherrschung auf dem betroffenen Markt zu prüfen, bestehen im Prinzip zwei Möglichkeiten: Zum einen eine direkte Feststellung des Vorliegens von signifikanter Marktmacht bzw. einer marktbeherrschenden Stellung und zum anderen eine indirekte Ermittlung über den Weg der Abgrenzung des relevanten Marktes und der Bestimmung von Marktanteilen. In diesem Zusammenhang sind darüber hinaus auch die Angebotssubstitution und der potentielle Wettbewerb zu berücksichtigen.
I. Direkte Feststellung von Marktmacht
Um festzustellen, ob Marktmacht eines Unternehmens oder einer Gruppe von Unternehmen vorliegt, könnte man den Lerner-Index bzw. die Elastizität der entsprechenden Residualnachfrage heranziehen und versuchen, durch eine Messung dieses Index den Grad der Marktmacht zu bestimmen.30 Geht man von der prozentualen Abweichung des Preises von den Grenzkosten aus, dann wird der Preis des Gutes im Allgemeinen die empirisch am einfachsten zu beobachtende Größe sein.31 Die Erfassung der Grenzkosten bzw. der inkrementellen Kosten bereitet jedoch in mehrerer Hinsicht gravierende Schwierigkeiten. So sind die Grenzkosten in erster Linie ein theoretisches Konzept und lassen sich daher in der Praxis im Allgemeinen nicht oder nur sehr schwer ermitteln, selbst wenn die technischen Produktionsbedingungen bekannt sind.32 Zwar können bisweilen die variablen Stückkosten beobachtet werden, aber es handelt sich dabei um buchhalterische Kosten, nicht aber um die für eine ökonomisch korrekte Analyse erforderlichen Opportunitätskosten. Weiterhin müssen die langfristigen Grenzkosten herangezogen werden, deren Ermittlung noch weitaus größere Schwierigkeiten bereitet. Zieht man nur die kurzfristigen Grenzkosten bzw. die variablen Stückkosten heran, so könnte man leicht zu einer falschen Einschätzung der Marktmacht gelangen. So liegt in Branchen, die mit hohen Fixkosten operieren, wie z.B. der Softwareindustrie, der Marktpreis weit über den kurzfristigen Grenzkosten. Diese Differenz ist jedoch kein Zeichen von Marktmacht, sondern dient lediglich dazu, zur Deckung der fixen Kosten beizutragen. Darüber hinaus können bei Unternehmen mit signifikanter Marktmacht aufgrund von X-Ineffizienzen überhöhte Kosten vorliegen, sodass selbst die Feststellung der Grenzkosten keine Aussage über den Grad der Marktmacht ermöglicht. Wenn die einzelnen Komponenten des Lerner-Index nicht beobachtet werden können, dann besteht die Möglichkeit, mittels der Profitabilität eines Unternehmens Aussagen über seine Marktmacht zu treffen. Hierzu sind eine Reihe von Verfahren und Methoden entwickelt worden, die allerdings auch aufgrund einer Reihe schwerwiegender konzeptioneller Probleme bestenfalls nur Indizien für die Existenz von Marktmacht eines Unternehmens liefern können.33
Da bei vollkommenem Wettbewerb die Grenzkosten gleich dem Preis sind, könnte man den Grad der Marktmacht dadurch feststellen, dass man den Preis ermittelt, der bei vollkommenem Wettbewerb herrschen würde, d.h. den wettbewerbsanalogen Preis.34 Dies wäre unter Umständen mithilfe einer Vergleichsmarktanalyse erreichbar. Hierzu betrachtet man einen in zeitlicher, räumlicher oder sachlicher Hinsicht getrennten Markt, über den Informationen vorliegen, die darauf hindeuten, dass dort wirksamer Wettbewerb herrscht. Weichen die Preise in diesem Vergleichsmarkt signifikant und dauerhaft von denen im untersuchten Markt ab, dann würde dies auf das Vorliegen von Marktmacht hinweisen.35 Allerdings wird es in der Praxis häufig schwierig sein, einen Vergleichsmarkt zu finden, der dem betrachteten in jeder Hinsicht (Angebot, Nachfrage, Technologien etc.) nahe kommt. Die Unterschiede zwischen den Märkten müssten deutlich gemacht und durch Zu- oder Abschläge berücksichtigt werden. Wie diese Korrekturfaktoren jedoch zu bestimmen wären, ist häufig nicht klar. Daher sind derartige Verfahren nur mit großer Vorsicht zu verwenden.36
Eine weitere prinzipielle Möglichkeit der direkten Feststellung von Marktmacht bietet die Ermittlung der Preiselastizität der Residualnachfrage.37 In die Residualnachfrage gehen jedoch nicht nur die Reaktionen der Nachfrager ein, sondern auch das Angebotsverhalten aktueller und potentieller Wettbewerber. Die Ermittlung der Angebotssubstitution ist jedoch häufig nicht unproblematisch.38 Die direkte Ermittlung von Marktmacht gestaltet sich daher im Allgemeinen als schwierig. Um eine akzeptable Schätzung der Residualnachfragefunktion eines Unternehmens zu erhalten, ist in der Regel eine aufwendige ökonometrische Analyse erforderlich.39 Hierfür müssen jedoch hinreichend viele Daten über längere Zeiträume vorliegen. Dabei sollten die Bedingungen auf dem betrachteten Markt im Zeitablauf auch relativ unverändert geblieben sein, da durch Änderungen in den Produkten oder den Präferenzen der Nachfrager die Daten und das Resultat an Aussagekraft einbüßen. Wenn jedoch diese Bedingungen erfüllt sind, dann erlaubt eine solche Analyse relativ präzise Aussagen über die Marktmacht eines Unternehmens.40
Wenn quantitative Aussagen über die Marktmacht von Unternehmen getroffen werden, so müssen diese durch empirische Evidenz gestützt werden. Hier können z.B. die Marktkenntnisse von Experten, Informationen über das Verhalten der Nachfrager im Fall von Preissenkungen, die von den Marketingabteilungen der Unternehmen bereitgestellt werden können, Informationen über den Zusammenhang zwischen Marktstruktur und Preisen sowie über die Art der Produktdifferenzierung im Markt herangezogen werden.41
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass eine direkte Ermittlung der Marktmacht eines Unternehmens im Allgemeinen schwierig ist und zahlreiche Probleme auftreten können. Zwar gibt es einige Methoden, mit denen dies im Prinzip möglich ist, wie z.B. durch die Schätzung der Elastizität der Residualnachfrage, aber diese Verfahren sind aufwendig und nur unter sehr spezifischen Bedingungen anwendbar. Aus diesen Gründen wird man in den meisten Fällen darauf zurückgreifen müssen, Marktmacht auf indirekte Weise zu erfassen.
30 Vgl. Bresnahan (1989). 31 Bei Konsumgütern könnte man den durchschnittlichen Preis durch Scannerdaten feststellen, bei anderen Gütern ist die Preisermittlung schwieriger, da hierüber häufig keine ausreichenden Daten vorliegen oder kein eigentlicher Marktpreis existiert, da der Preis durch Verhandlungen zwischen Käufern und Verkäufern bestimmt wird. Beobachtet man den Preis in einer Phase, in der ein marktbeherrschendes Unternehmen durch Kampfpreise versucht, Konkurrenten vom Markt zu verdrängen, dann würde der Preis bei der Ermittlung von Marktmacht einen falschen Schluss nahe legen. 32 Vgl. Motta (2004), 116. 33 Vgl. Office of Fair Trading (2003b). 34 „One would simply identify the competitive price level and then compare it with the observed price level. If the observed price level were significantly above the competitive price level then the firm can be deemed to hold a dominant position (i.e. the ability to charge prices significantly in excess of the competitive level).“ Office of Fair Trading (2001), 17. 35 Vgl. Hausman/Sidak (2007). 36 Vgl. Schmidt, I. (2005), 152–154. 37 Vgl. Baker/Bresnahan (1988); Scheffman (1992) sowie Werden (1998). 38 Vgl. S. 98 und die dort angegebene Literatur. 39 Vgl. z.B. Baker/Bresnahan (2008). 40 Die bisher angesprochenen Methoden zur direkten Ermittlung von Marktmacht beziehen sich auf den Fall bereits existierender Marktmacht. Aber auch für die prospektive Frage, ob durch eine Fusion Marktmacht entsteht oder vergrößert wird, sind Methoden und empirische Verfahren entwickelt worden, um eine direkte Aussage über die Änderung in der Marktmacht der beteiligten Unternehmen treffen zu können. Diese Verfahren werden auf den Seiten 332–448 dargestellt. 41 Vgl. Baker/Bresnahan (2008).
II. Indirekte Erfassung von Marktmacht
Die indirekte Erfassung von Marktmacht basiert darauf, dass von den Marktanteilen, die ein Unternehmen hat, ein Rückschluss auf die Marktmacht gezogen wird. Analog kann anhand von erwarteten Änderungen in den Marktanteilen aufgrund einer Fusion eine Aussage über die Änderung von Marktmacht, d.h. die Entstehung oder Veränderung einer marktbeherrschenden Stellung, getroffen werden. Wenn der Marktanteil als Indiz für Marktmacht verwendet wird, dann sollte der Markt so abgegrenzt sein, dass die Marktanteile ein möglichst präzises Bild der Marktmacht bzw. des Grades der Marktbeherrschung geben. Ein exaktes Bild kann es aus konzeptionellen Gründen nicht sein, da auch bei großen Marktanteilen eines Unternehmens nicht notwendig Marktmacht vorliegen muss, z.B. wenn die Nachfrage sehr preiselastisch reagiert. Bei der indirekten Ermittlung von Marktmacht geht man also in drei Schritten vor: Zuerst wird ein Markt abgegrenzt, dann werden die Marktanteile der Unternehmen bestimmt und schließlich müssen diese Marktanteile unter Berücksichtigung der Wettbewerbsbedingungen auf diesem Markt interpretiert werden, um eine Aussage darüber treffen zu können, ob Marktbeherrschung vorliegt, bzw. ob durch einen Zusammenschluss eine marktbeherrschende Stellung entsteht oder verstärkt wird.42 Dabei sind neben den Marktanteilen als Maß für die Konzentration und als Indiz für das Vorliegen von Marktmacht noch weitere Aspekte bei der Beurteilung der wettbewerblichen Situation auf einem Markt zu berücksichtigen. So könnte z.B. eine erhebliche Nachfragemacht dazu führen, dass selbst bei hohen Marktanteilen ein Unternehmen die Preise nicht signifikant über das Wettbewerbsniveau anheben kann. Eine ähnliche Rolle kann der potentielle Wettbewerb spielen. Die Abgrenzung des relevanten Marktes ist also aus ökonomischer Sicht nur ein Instrument, Hilfsmittel und Zwischenschritt, um das eigentliche Ziel zu erreichen, die Feststellung und Beurteilung von Marktmacht.43
42 „... that the analysis does not end when the market has been defined and that simpleminded measures of market power or concentration, like simple-minded binary treatments of market definition, are unlikely to be adequate substitutes for a full analysis.“ Fisher (1987), 28. 43 Vgl. Bishop/Walker (2010), 108; Werden (1983), 516 sowie Werden (1992), 197.
1. Abgrenzung von Märkten – Ökonomische Marktkonzepte
In der Wirtschaftstheorie werden, je nach Frage und Erkenntnisinteresse, unterschiedliche Marktkonzepte verwendet. So wird für Fragen der Preisbildung und der Analyse von Gleichgewichten vor allem das Konzept eines ökonomischen Marktes (economic market) herangezogen. Hierbei werden Güter und Märkte identifiziert, sodass ein solcher Markt nur ein einziges homogenes Gut umfasst und Arbitrage dazu führt, dass auf diesem Markt nur ein einziger Preis für das Gut existiert. Da in der Wirtschaftstheorie Güter nach physischen Eigenschaften, Ort und Zeitpunkt der Bereitstellung unterschieden werden, führt ein entsprechender Marktbegriff dazu, dass, z.B. bei differenzierten Gütern, für jedes Gut ein eigener Markt vorliegt.44 Ein solches Marktkonzept ist für Fragen der Existenz von Gleichgewichten oder der Funktionsweise des Preismechanismus sinnvoll, ist allerdings für wettbewerbspolitische Zwecke ungeeignet, denn hier ist festzustellen, ob ein Unternehmen oder eine Gruppe von Unternehmen in der Lage ist, Marktmacht auszuüben bzw. zu ermitteln, wodurch der Marktmacht von Unternehmen wettbewerbliche Schranken gesetzt werden.45
Das Konzept des ökonomischen Marktes hatte sich in der Wirtschaftstheorie als geeignetes Instrument erwiesen, um die Marktformen der vollkommenen Konkurrenz, sowohl partialanalytisch als auch in Modellen des allgemeinen Gleichgewichtes, sowie des Monopols zu analysieren. Bis in die 1930er Jahre konzentrierte sich die Wirtschaftstheorie auf die Analyse dieser polaren Marktformen. Erst mit den Arbeiten von Sraffa, Robinson, Chamberlin und Triffin wurde begonnen, Märkte mit differenzierten Gütern zu analysieren, in denen sowohl Elemente des Wettbewerbs als auch des Monopols auftreten.46 Hierbei stellte sich das Problem, den Markt festzustellen, in dem ein solcher monopolistischer Wettbewerb stattfindet, und es wurden im Zuge dieser Überlegungen erstmalig Marktabgrenzungen vorgenommen. Die seinerzeit entwickelten Konzepte der Substitutionslücke (Robinson, Chamberlin), oder das im Rahmen eines Modells des allgemeinen Gleichgewichts von Triffin verwendete Konzept der externen Interdependenz waren als Instrumente und Hilfsmittel gedacht, eine bestimmte Marktform, die der monopolistischen Konkurrenz, näher zu analysieren und Gleichgewichte auf solchen Märkten zu beschreiben. Sie sind daher für die wettbewerbspolitisch relevanten Fragen nach der Marktmacht von Unternehmen und ihrer wettbewerblichen Schranken keine idealen Werkzeuge. Dies gilt auch für andere im Zusammenhang mit differenzierten Gütern vorgeschlagene Konzepte der Marktabgrenzung.
a) Bedarfsmarktkonzept
Im Rahmen einer Analyse der Qualitätsbestimmung auf Wettbewerbsmärkten hat Abbott das Konzept eines Bedarfsmarktes nahegelegt, indem er zwischen den psychologisch unscharfen Begriffen der Grundbedürfnisse und der abgeleiteten Bedürfnisse unterscheidet.47 Eine ähnliche Argumentation verwendet Arndt in einem Aufsatz zur Gleichgewichtsanalyse und zum Monopolkonzept und führt zur Analyse das Konzept des Bedarfsmarktes ein.48 Ein Bedarfsmarkt ist der Deckung eines bestimmten „gesellschaftlichen Bedarfes“ gewidmet. Auf ihm werden heterogene Güter mit unterschiedlichen Preisen gehandelt und er bildet nur einen Teilmarkt innerhalb der Volkswirtschaft.49 Allerdings sind auch diese Konzepte dafür entwickelt worden, Gleichgewichte auf Märkten mit monopolistischer Konkurrenz zu analysieren, nicht aber für die zentralen Fragen der Wettbewerbspolitik. Andere Methoden zur Marktabgrenzung gehen stattdessen eher vom Konzept einer Industrie aus, wie der auf Marshall zurückgehende Ansatz von Bain, der die Unternehmen in einem Sektor in Untergruppen gliedert, die er als Industrie definiert.50 Unternehmen in einer solchen Industrie stellen enge Substitute her, die die Nachfrage einer bestimmten Gruppe von Abnehmern bedienen. Dabei sind enge Substitute Varianten eines Gutes, die sich in Form und Funktion ähneln und ein spezifisches Bedürfnis der Konsumenten befriedigen.
Diese Formen der Marktabgrenzung wurden von den Wirtschaftswissenschaften für andere Zwecke als für Analysen von Marktmacht oder Marktbeherrschung entwickelt und sind daher als Instrument zur Untersuchung dieser Fragen nur bedingt geeignet. Allerdings muss sich die Wirtschaftswissenschaft den Vorwurf gefallen lassen, sich lange Zeit nicht um das Problem der Marktabgrenzung für Fragen der Wettbewerbspolitik gekümmert zu haben. So klagt Stigler noch 1982: „My lament is that this battle on market definitions, which is fought thousands of times what with all the private antitrust suits, has received virtually no attention from us economists. Except for a casual flirtation with cross elasticities of demand and supply, the determination of markets has remained an undeveloped area of economic research at either the theoretical or empirical level.“51
Da sich aber in der Praxis das Problem der Marktabgrenzung beständig stellte, war man gezwungen, sich anfänglich mit den zur Verfügung stehenden Instrumenten wie dem Bedarfsmarktkonzept zu behelfen. Hierzu wurde eine Reihe von Kriterien zur praktischen Marktabgrenzung entwickelt. So ordnete man Produkte dem gleichen Markt zu, wenn sie hinsichtlich ihrer Funktion, ihren Eigenschaften, ihrer Preislage und ihrem wirtschaftlichen Verwendungszweck als austauschbar oder substituierbar angesehen werden. Diese Kriterien stammen eher aus dem Bedarfsmarktkonzept oder der Bainschen Form der Marktabgrenzung und sind für eine Marktabgrenzung, die eine möglichst präzise Antwort auf die Frage nach Marktmacht bzw. Marktbeherrschung ermöglichen soll, aus mehreren Gründen eher skeptisch zu beurteilen.52
So wird bei der Frage nach der funktionellen Austauschbarkeit nicht das zentrale Problem der Marktmacht thematisiert, die davon abhängt, wie preiselastisch die Nachfrage reagiert. Um Marktmacht zu verhindern, reicht es häufig aus, wenn nur ein relativ geringer Teil der Konsumenten bei einer Preiserhöhung auf andere Produkte ausweicht. Eine vollständige oder überwiegende funktionelle Austauschbarkeit der Produkte ist im Allgemeinen nicht erforderlich, um Marktmacht zu beschränken und führt daher zu einer zu engen Marktabgrenzung.53 In engem Zusammenhang hiermit steht das Kriterium der physischen Charakteristika, nach dem zwei Produkte unterschiedlichen Märkten zugehören sollen, wenn sie in ihren Eigenschaften erhebliche Unterschiede aufweisen. Auch dieses Kriterium führt häufig zu einer ökonomisch nicht sinnvollen Marktabgrenzung, denn um als Substitute für die Konsumenten in Frage zu kommen, müssen sie nicht notwendig die gleichen physischen Eigenschaften aufweisen. So können Busse und Bahnen trotz erheblicher Unterschiede in ihren Eigenschaften für viele Konsumenten als Substitute in Frage kommen. Eine Abgrenzung des relevanten Marktes aufgrund der Ähnlichkeit in den physischen Eigenschaften kann daher zu sehr engen Märkten führen, weil dabei u.U. Eigenschaften der Güter betrachtet werden, die für die Kaufentscheidung einiger Konsumenten keine Bedeutung haben.54 Wenn man zwei Produkte aufgrund ihrer unterschiedlichen Eigenschaften verschiedenen Märkten zuordnet, sollte der Einfluss dieser Eigenschaften auf die Substituierbarkeit das entscheidende Kriterium sein. Auch eine unterschiedliche Preislage der Güter ist kein notwendiges Kriterium, sie verschiedenen Märkten zuzuordnen. Wenn sich Güter in qualitativen Eigenschaften, wie z.B. der Lebensdauer, unterscheiden, dann könnte ein qualitativ höherwertiges Gut, z.B. eines mit der doppelten Lebensdauer, ein sehr enges Substitut für ein qualitativ schlechteres sein, das nur die Hälfte kostet.55 Auch hier besteht die Gefahr einer zu engen Marktabgrenzung und dadurch zu einer Überschätzung der Marktmacht aufgrund der gemessenen Marktanteile. Zwar können alle die genannten Konzepte Hinweise darauf geben, welche Güter als Substitute in einem ökonomisch sinnvoll abgegrenzten relevanten Markt zusammengefasst werden sollten, aber die entscheidende Frage nach der Marktmacht und den Schranken, die ihr durch Substitute gesetzt werden, wird durch diese Kriterien nicht beantwortet.
b) Hypothetischer Monopolistentest
Seit Anfang der 1980er Jahre wurde von der Wirtschaftstheorie ein Konzept vorgeschlagen, das speziell zu dem Zweck entwickelt wurde, eine marktmachtbezogene Abgrenzung des relevanten Markts für die Fusionskontrolle vorzunehmen. Ein Markt sollte hiernach so abgegrenzt werden, dass die Marktanteile eine möglichst große Aussagekraft über die Fähigkeit eines oder mehrerer Unternehmen haben, Marktmacht auszuüben.56 Bei diesem Marktkonzept, das erstmals in den US-amerikanischen Leitlinien zur Beurteilung horizontaler Unternehmenszusammenschlüsse vorgestellt wurde, handelt es sich um das Konzept des Antitrustmarktes.57 Der Grundgedanke hinter diesem Konzept ist folgender: Marktanteile können nur dann ein brauchbares Indiz für Marktmacht sein, wenn zumindest ein Unternehmen mit einem Marktanteil von 100 % Marktmacht ausüben kann. Anders ausgedrückt: Wenn selbst ein Monopolist nicht über Marktmacht verfügt, den Preis also nicht über den Wettbewerbspreis anheben kann, dann haben Unternehmen mit einem geringeren Marktanteil als 100 % erst recht keine Marktmacht, d.h. keine Möglichkeit zur Preiserhöhung.58 In diesem Fall würden Marktanteile nichts über Marktmacht aussagen. Der relevante Antitrustmarkt umfasst also in sachlicher Hinsicht all die Produkte und in räumlicher Hinsicht all die Gebiete, die der Marktmacht eines Monopolisten Grenzen setzen. Würde der Markt einige dieser Produkte oder Gebiete nicht enthalten, dann würde eine Preiserhöhung Konsumenten dazu veranlassen, auf diese Produkte oder Gebiete auszuweichen und die versuchte Ausübung von Marktmacht wäre vereitelt. Diese Überlegung wurde zum hypothetischen Monopolistentest weiterentwickelt, wie er heute in zahlreichen Jurisdiktionen für Fragen der Marktabgrenzung als konzeptioneller Rahmen verwendet wird.59
Dieser Test stellt die Frage, ob ein gewinnmaximierender hypothetischer Monopolist, d.h. ein Unternehmen, das der einzige Anbieter eines Produktes ist, den Preis für dieses Produkt anheben würde.60 Wenn das der Fall wäre, dann würde dieser hypothetische Monopolist über Marktmacht verfügen und die Marktanteile der Unternehmen in diesem Markt würden einen, wenn auch nur unvollkommenen, Rückschluss auf ihre jeweilige Marktmacht erlauben. Würde die Anhebung des Preises durch den hypothetischen Monopolisten jedoch zu keiner Erhöhung des Gewinns führen, dann sind der Marktmacht des hypothetischen Monopolisten offensichtlich Schranken gesetzt. Diese Schranken können entweder durch Ausweichreaktionen der Konsumenten oder durch Angebotsreaktionen anderer Unternehmen gebildet werden. In diesem Fall würden die Marktanteile der Unternehmen in diesem Markt kein brauchbares Indiz für Marktmacht liefern. Aber nicht jedes Maß an Marktmacht ist aus ökonomischer Sicht problematisch. Erst wenn diese eine gewisse Grenze überschreitet, kann sie zum Problem werden. Es stellt sich daher die Frage, welches Maß an Marktmacht, d.h. welche Preiserhöhung und welcher Zeitraum hierfür in Betracht kommen.61 Eine sehr starke Preiserhöhung, die jedoch nur für einen Zeitraum von wenigen Wochen wirksam ist, bevor die Konsumenten auf andere Güter ausweichen oder andere Anbieter in den Markt eintreten, ist vermutlich weniger problematisch als eine moderate Preiserhöhung, die jedoch für einen Zeitraum von mehreren Jahren bestehen bleibt.62 Hier ist eine normative Entscheidung darüber zu fällen, welches Ausmaß der Preiserhöhung und welcher Zeitraum ihrer Dauer noch akzeptiert werden können, bevor wettbewerbspolitische Konsequenzen zu ziehen sind. Im Allgemeinen wird eine Grenze bei einer Preiserhöhung von 5–10 % für die Dauer ungefähr eines Jahres gezogen. Wird diese Grenze überschritten, dann entsteht Marktmacht, die nicht mehr toleriert werden kann.63 In diesem Fall ist der relevante Markt so abgegrenzt, dass die Marktanteile der Unternehmen als Indiz für ihre Marktmacht gelten können. So kann für die Abgrenzung des relevanten Marktes die folgende Bedingung formuliert werden: Ein relevanter Markt umfasst die Produkte und Gebiete, für die ein gewinnmaximierender hypothetischer Monopolist den Preis nicht nur vorübergehend um einen kleinen, aber signifikanten Betrag erhöhen wird. Dabei wird unterstellt, dass die Preise und sonstigen Verkaufsbedingungen aller anderen Güter unverändert bleiben. Es wird davon ausgegangen, dass ein gewinnmaximierendes Unternehmen den Preis um mindestens 5–10 % anheben würde. Bisweilen wird auch die Formulierung verwendet, dass eine Preiserhöhung um 5–10 % profitabel sei. Der Unterschied besteht darin, dass eine Preiserhöhung um 5 % zwar noch profitabel sein könnte, aber ein gewinnmaximierendes Unternehmen den Preis nur um z.B. 3 % anheben würde. Aus ökonomischer Sicht ist der erste Test vorzuziehen, da er auf das abstellt, was das Unternehmen tun wird.64 „Nicht nur vorübergehend“ bedeutet dabei für mindestens ein Jahr und „klein aber signifikant“ heißt im Bereich von 5–10 %. Dabei sind bei verschiedenen Konstellationen Abweichungen von diesen Grenzen möglich; sie sollten nicht absolut gesehen werden, manchmal sind geringere oder höhere Grenzen sinnvoll.65 Weiterhin ist zu beachten, dass diese Grenzen nur etwas über den relevanten Markt aussagen, sie sollten daher nicht automatisch mit einer Toleranzgrenze für Preiserhöhungen nach einer Fusion gleichgesetzt werden.66 Im Englischen wird dieses Konzept der Marktabgrenzung auch als SSNIP-Test (Small but Significant Non-transitory Increase in Price) bezeichnet.67 Ein weiterer Punkt, der in diesem Zusammenhang anzusprechen ist, ist die Beschränkung des SSNIP-Tests auf die Preisdimension.68 Im Prinzip lässt sich das konzeptionelle Vorgehen bei der Marktabgrenzung in analoger Weise auch auf Änderungen anderer Wettbewerbsparameter übertragen. In vielen Fällen kann die Beschränkung auf die Preisdimension jedoch als Approximation einer kleinen Änderung in einem anderen Wettbewerbsparameter als dem Preis aufgefasst werden, z.B. einer Verringerung der Qualität, die die Produkte für einen Nachfrager weniger attraktiv macht.69
Konzeptionell wird bei Fusionskontrollverfahren wie folgt vorgegangen: Es wird mit einem Kandidatenmarkt begonnen, der nur die Produkte der fusionierenden Unternehmen enthält, und es wird untersucht, ob das Unternehmen nach dem Zusammenschluss bei gewinnmaximierendem Verhalten eine kleine, aber signifikante Preiserhöhung durchführen wird.70 Die Preiserhöhung muss nicht die gleiche für alle Produkte im Kandidatenmarkt sein. Wenn sich die Gewinnmargen der Produkte erheblich unterscheiden, dann könnten auch produktspezifische Preiserhöhungen unterstellt werden. In einer symmetrischen Situation mit ähnlichen Gewinnmargen und vergleichbarer Nachfrage ist eine einheitliche Preiserhöhung jedoch eine sinnvolle Annahme. Weiterhin wird angenommen, dass Unternehmen, die nicht im Kandidatenmarkt sind, nicht auf diese Preisänderung reagieren. Wenn also ein hypothetischer, gewinnmaximierender Monopolist eine solche Preiserhöhung durchführen würde, dann ist der relevante Markt abgegrenzt. Die Marktanteile können ermittelt und, unter Berücksichtigung der Wettbewerbsbedingungen auf dem so abgegrenzten Markt, interpretiert werden. Kann jedoch das fusionierte Unternehmen bei gewinnmaximierendem Verhalten keine derartige Preiserhöhung durchsetzen, dann ist der Markt zu klein für einen Antitrustmarkt, dem hypothetischen Monopolisten sind durch den Wettbewerb, d.h. durch Ausweichreaktionen der Nachfrager bzw. Reaktionen anderer Anbieter, Grenzen gesetzt. Eine Variante des hypothetischen Monopolistentests geht nicht von einer Preiserhöhung bei gewinnmaximierendem Verhalten aus, sondern fragt, ob eine Preiserhöhung von z.B. 5 % für den hypothetischen Monopolisten profitabel wäre. Dies kann zu unterschiedlichen relevanten Märkten führen, wenn z.B. ein gewinnmaximierender hypothetischer Monopolist den Preis nur um 3 % erhöhen würde, eine Preiserhöhung um 5 % aber noch profitabel wäre.
An dieser Stelle kann zwischen der sachlichen und der räumlichen Marktabgrenzung unterschieden werden. Im Rahmen der sachlichen Marktabgrenzung müssen dem Kandidatenmarkt weitere Produkte hinzugefügt werden, während ihm bei der räumlichen Marktabgrenzung weitere Gebiete hinzugefügt werden.71 Dann wird der Test wiederholt, solange bis ein gewinnmaximierender hypothetischer Monopolist eine solche Preiserhöhung durchführen würde.72 Der relevante Markt ist also der kleinste sachliche und räumliche Markt, für den diese Bedingung erfüllt ist. Nur wenn man den relevanten Markt auf diese Weise abgrenzt, hat man die zentralen wettbewerblichen Schranken erfasst, die der Ausübung von Marktmacht gesetzt sind, und nur dann können die Marktanteile der Unternehmen ein brauchbares Indiz für Marktmacht sein.73 Entscheidend für die Frage, ob ein hypothetischer Monopolist eine kleine aber signifikante Preiserhöhung durchführen wird, sind die Reaktionen der Nachfrager und der Anbieter. Beide werden im Weiteren näher betrachtet.