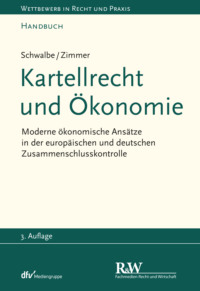Kitabı oku: «Kartellrecht und Ökonomie», sayfa 12
c) Einzelaspekte der Marktabgrenzung
Im Folgenden werden die wesentlichen Aspekte behandelt, die bei Abgrenzung des relevanten Marktes zu berücksichtigen sind. Bei der Gedankenführung wird aus den zuvor genannten Gründen (oben S. 89–93) jeweils vom Konzept des hypothetischen Monopolistentests ausgegangen.
α) Nachfragesubstitution
Sämtliche Ausweichreaktionen der Nachfrager bei einer Preiserhöhung werden, wie auf den Seiten 67–70 bereits beschrieben, durch die Preiselastizität der Nachfragefunktion erfasst.74 Ist diese Preiselastizität gering, dann würde eine kleine, aber signifikante Preiserhöhung nur zu einem geringen Rückgang in der Nachfrage führen und der hypothetische Monopolist könnte hierdurch einen höheren Gewinn erzielen. Dies ist immer dann der Fall, wenn den Konsumenten keine ausreichenden Substitutionsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.75 Reagiert die Nachfrage hingegen sehr preiselastisch, dann führt eine Preiserhöhung zu keiner Erhöhung des Gewinns, da bereits eine kleine Anhebung des Preises einen großen Nachfragerückgang induziert.76 In diesem Fall stehen den Nachfragern hinreichend sachliche und räumliche Substitute zur Verfügung, auf die sie bei einer Preiserhöhung ausweichen würden.77 Wenn sich nun herausstellt, dass sich der hypothetische Monopolist einer sehr preiselastischen Nachfrage gegenübersieht, dann müsste der relevante Markt durch Einbeziehung weiterer Güter und Gebiete erweitert werden. Dabei sollten zuerst die in sachlicher und räumlicher Hinsicht engsten Substitute der betrachteten Güter und Gebiete berücksichtigt werden, da vor allem durch diese die Ausübung von Marktmacht verhindert würde. Werden diese nun dem Kandidatenmarkt hinzugefügt, dann werden diese hohen Schranken entfernt und die nächst niedrigeren Schranken werden relevant.
Um die engsten Substitute, die gegebenenfalls dem Kandidatenmarkt hinzuzufügen sind, zu ermitteln, können die Konzepte der Kreuzpreiselastizität der Nachfrage oder der Umlenkungskennziffer (diversion ratio) herangezogen werden. Die Kreuzpreiselastizität gibt an, um wie viel Prozent sich die Nachfrage nach einem Gut ändert, wenn der Preis eines anderen Gutes um 1 % erhöht wird. Eine hohe positive Kreuzpreiselastizität zwischen zwei Gütern deutet darauf hin, dass zwischen diesen Gütern eine enge Substitutionsbeziehung vorliegt, während eine Kreuzpreiselastizität von Null bedeutet, dass zwischen den betrachteten Gütern keine nähere Beziehung besteht.78 Eine negative Kreuzpreiselastizität macht deutlich, dass die beiden Güter in einer komplementären Beziehung stehen, d.h., wird das eine Gut teurer, wird auch vom anderen weniger nachgefragt. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Kreuzpreiselastizität zwischen zwei Gütern A und B a priori wenig darüber aussagt, ob ein Gut eine wettbewerbliche Schranke für die Ausübung von Marktmacht darstellt. So kann selbst im Falle einer geringen Kreuzpreiselastizität keine Marktmacht vorliegen, wenn es viele Güter gibt, auf die die Nachfrager bei einer Preiserhöhung ausweichen können. Produkte mit niedriger Kreuzpreiselastizität können also im gleichen relevanten Markt liegen. Aber andererseits ist auch ein hoher Wert der Kreuzpreiselastizität mit dem Vorliegen erheblicher Marktmacht vereinbar, d.h. auch Produkte mit hoher Kreuzpreiselastizität stellen nicht immer wettbewerblichen Schranken dar.79 Dies gilt z.B. dann, wenn die Marktvolumina der Güter sich deutlich unterscheiden. So kann ein Gut, das nur in sehr geringer Menge konsumiert wird, also kein wichtiges Substitut darstellt, eine hohe Kreuzpreiselastizität aufweisen. Werden z.B. von einem Gut A 1.000.000 Einheiten im Jahr verkauft, von einem anderen Gut B jedoch nur 1.000, so würde bei einer Preiserhöhung des Gutes A um 5 % und einer Kreuzpreiselastizität von 25 die Nachfrage nach dem Gut B um 1.250 zunehmen. Dies bedeutet jedoch nur einen Rückgang der verkauften Menge des Gutes A um 0,125 %. Betrug der Preis pro Einheit des Gutes A vor der Preiserhöhung 1 Euro, so war der Gewinn 1.000.000 Euro. Nach der Preiserhöhung beträgt der Gewinn trotz verringerter Menge jedoch 1.048.687 Euro, liegt also um 48.687 Euro höher. Dies macht deutlich, dass weder hohe noch niedrige Kreuzpreiselastizitäten etwas über Marktmacht aussagen. Selbst die Kenntnis aller Kreuzpreiselastizitäten reicht nicht aus, um einen Rückschluss auf die Marktmacht zu ziehen, da es von zentraler Bedeutung ist, ob das Produkt einen großen oder geringen Anteil am Gesamtbudget hat.80 Die Preiselastizität der Nachfrage enthält all diese Informationen, denn sie setzt sich aus den Kreuzpreiselastizitäten mit allen anderen Gütern zusammen, wobei berücksichtigt ist, mit welchem Gewicht diese anderen Güter im Durchschnitt in das Budget der Nachfrager eingehen.81 Allerdings kann in vielen Fällen davon ausgegangen werden, dass zwischen zwei Produkten, die demselben relevanten Markt angehören, eine hohe Kreuzpreiselastizität besteht.
Alternativ zur Kreuzpreiselastizität kann die Umlenkungskennziffer (diversion ratio) verwendet werden, um zu ermitteln, welches die engsten Substitute eines gegebenen Produktes sind. Die Umlenkungskennziffer bezüglich der Produkte 1 und 2 gibt an, wie viel vom Nachfragerückgang bei Produkt 1, der durch eine Preiserhöhung dieses Produkts verursacht wird, auf Produkt 2 umgelenkt wird. Die Umlenkungskennziffer zwischen den Produkten 1 und 2 ist definiert als Quotient aus der Kreuzpreiselastizität von Produkt 1 bezogen auf eine Preisänderung von Produkt 2 (ε21) und der Preiselastizität der Nachfrage für Produkt 1 (ε1):

Dabei bezeichnen p1 bzw. p2 die Preise und Q1 bzw. Q2 die Mengen der Produkte 1 und 2. Die Umlenkungskennziffer gibt an, wie groß der Anteil der Nachfrage ist, den das Produkt 1 bei einer Preiserhöhung an das Produkt 2 verliert. Wenn die Umlenkungskennziffer der Produkte 1 und 2 z.B. 0,75 wäre, dann würden 75 % des Nachfragerückgangs bei einer Preiserhöhung des Produktes 1 zum Produkt 2 gehen. Die restlichen 25 % verschieben sich auf andere Produkte. In diesem Fall ist Produkt 2 das engste Substitut und sollte als nächstes in den Kandidatenmarkt aufgenommen werden.82
Manchmal ist es sinnvoll, die Umlenkungskennziffer mit dem Relativpreis der beiden Produkte zu gewichten. Dies ergibt die Umlenkungskennziffer in Bezug auf den Erlös:

Diese Umlenkungskennziffer gibt an, wie viel an Erlös durch eine Erhöhung des Preises von Produkt 1 auf das Produkt 2 umgelenkt wird. Die Höhe des umgelenkten Umsatzes hängt natürlich von den Preisen der beiden Produkte ab.
Beide Konzepte können herangezogen werden, um mögliche Substitute entsprechend ihrer Kreuzpreiselastizität bzw. ihrer Umlenkungskennziffer bezogen auf ein bestimmtes Gut zu ordnen, sodass im Zuge des hypothetischen Monopolistentests die nächstbesten Substitute dem Kandidatenmarkt hinzugefügt werden. Dabei kann der Fall eintreten, dass Kreuzpreiselastizitäten und Umlenkungskennziffern nicht zur gleichen Rangfolge der Produkte führen, da die Umlenkungskennziffer auch von den abgesetzten Mengen der beiden Produkte abhängt. Sind diese Mengen sehr verschieden, dann kann dies zu unterschiedlichen relevanten Märkten führen, je nachdem ob die nächstbesten Substitute mit der Kreuzpreiselastizität oder der Umlenkungskennziffer ermittelt wurden.
Für die Entscheidung des hypothetischen Monopolisten für oder gegen eine Preiserhöhung ist vor allem die Preiselastizität der Nachfrage von Bedeutung, die Kreuzpreiselastizitäten spielen dabei nur insoweit eine Rolle, als sie einen Einfluss auf die Preiselastizität haben. Aus diesen Gründen ist die häufige Verwendung der Kreuzpreiselastizitäten für Fragen der Marktabgrenzung verfehlt.83 Das Konzept ist nur insoweit von Interesse, als es dazu beitragen kann, im Zuge des hypothetischen Monopolistentests die jeweils engsten Substitute zu identifizieren.84
Wenn keine empirischen Belege für das Substitutionsverhalten der Verbraucher vorliegen, sodass Elastizitäten und Umlenkungskennziffern quantitativ nicht ermittelt werden können, muss das nächst beste Substitut, das dem Kandidatenmarkt hinzugefügt wird, anhand der besten zur Verfügung stehenden qualitativen Indikatoren ausgewählt werden. Dabei könnten Kriterien wie funktionelle Austauschbarkeit, physische Eigenschaften, Verwendungszweck und Preislage Anhaltspunkte dafür liefern, welche Produkte als enge Substitute in Frage kommen. Für das Problem der Marktabgrenzung selbst sind sie jedoch nicht geeignet.85
Um die Marktmacht eines gewinnmaximierenden hypothetischen Monopolisten durch Nachfragesubstitution zu beschränken, ist es im Allgemeinen nicht notwendig, dass ein großer Teil der Konsumenten oder zumindest mehr als die Hälfte der Nachfrager auf Substitute ausweichen muss. Es reicht aus, dass eine hinreichende Zahl von Konsumenten substituiert. Selbst wenn es größere Konsumentengruppen gibt, die nicht in der Lage sind, das Gut durch ein anderes zu substituieren, bedeutet dies nicht, dass ein Unternehmen Marktmacht ausüben kann. Entscheidend für die Frage der Marktmacht sind die marginalen Konsumenten, denn diese bestimmen die Preiselastizität der Nachfrage.
β) Angebotssubstitution
Neben den Ausweichreaktionen der Nachfrager kann der Marktmacht eines hypothetischen Monopolisten auch durch eine Angebotssubstitution Schranken gesetzt werden.86 Hebt der hypothetische Monopolist den Preis des Gutes an, dann könnte es für andere Anbieter attraktiv sein, ebenfalls dieses Produkt anzubieten, um aufgrund des gestiegenen Preises höhere Gewinne zu erwirtschaften. Eine solches Produkt kann im Prinzip durch Unternehmen angeboten werden, die bereits auf einem anderen sachlichen bzw. räumlichen Markt tätig sind, aber ihr Angebot sehr flexibel umstellen bzw. umleiten können. Bei differenzierten Gütern könnte eine Angebotssubstitution mittels einer Repositionierung existierender Güter durch Änderung einiger ihrer Eigenschaften erfolgen. Zusätzliches Angebot könnte aber auch von Unternehmen stammen, die erst nach entsprechenden Investitionen, z.B. in die Produktionsanlagen, in den Markt eintreten können. Im ersten Fall handelt es sich um Angebotssubstitution, während man beim zweiten Fall eher von Marktzutritt sprechen würde. Die Unterschiede betreffen zum einen die Zeit, die ein Unternehmen benötigt, um auf dem betrachteten Markt tätig zu werden. Kann ein Unternehmen sehr schnell, d.h. innerhalb weniger Monate auf eine Preiserhöhung reagieren und das Produkt anbieten, dann setzt dies der Marktmacht des hypothetischen Monopolisten Schranken in vergleichbarer Weise wie eine Nachfragesubstitution.87 Zum anderen unterscheiden sich Angebotssubstitution und Markteintritt dadurch, dass erstere dann vorliegt, wenn ein Unternehmen auf dem Markt tätig werden kann, ohne dass erst erhebliche versunkene Kosten anfallen, d.h. es die Möglichkeit eines „uncommitted entry“ hat und sehr schnell auf aktuelle Preiserhöhungen reagieren kann. Sind jedoch erst erhebliche Kosten zu versenken, um in den Markt eintreten zu können, dann handelt es sich um einen „committed entry“, der meist erst nach längerer Zeit erfolgen kann und daher auch vom erwarteten Marktergebnis nach erfolgtem Eintritt abhängt. Beim hypothetischen Monopolistentest sollte daher die Angebotssubstitution im Rahmen der Marktabgrenzung berücksichtigt werden, während Marktzutritt bzw. potentieller Wettbewerb nach Abschluss der Marktabgrenzung bei der Analyse des Wettbewerbs auf dem relevanten Markt erfolgen sollte.88
Um die Angebotssubstitution systematisch bei der Marktabgrenzung zu berücksichtigen, wurde eine modifizierte Form des hypothetischen Monopolistentests, der Full Equilibrium Relevant Market (FERM) Test vorgeschlagen. Dieser Test berücksichtigt die Angebotsreaktionen anderer Unternehmen auf eine Preiserhöhung seitens des hypothetischen Monopolisten. Dieser Test wurde auf den Markt für Computer-Server angewandt. Es zeigte sich, dass sich ein kleinerer relevanter Markt ergab als bei Anwendung des üblichen hypothetischen Monopolistentests. In der Anwendungspraxis hat sich dieser Test jedoch bislang noch nicht etablieren können.89
Um der Marktmacht eines hypothetischen Monopolisten durch eine Angebotssubstitution Schranken zu setzen, muss ein Unternehmen vor allem über die entsprechenden Produktionsanlagen und das technische Knowhow verfügen, um ein Substitut herstellen zu können. Darüber hinaus müssen auch die notwendigen Distributionskanäle und das Marketing zur Verfügung stehen. Die Angebotsumstellung sollte schnell und ohne Kosten erfolgen können und die Kapazitäten, die für die Herstellung und den Vertrieb des Substitutes umgewidmet werden sollen, dürfen nicht durch längerfristige Verträge gebunden sein. Eine Angebotsumstellung wird von einem Unternehmen nur dann durchgeführt werden, wenn dadurch eine Erhöhung des Gewinns zu erwarten ist.90 Wenn eine dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, dann wird das Unternehmen kaum in der Lage sein, durch eine Angebotssubstitution eine Preiserhöhung zu verhindern.
Um festzustellen, ob in einem konkreten Fall auf eine Preiserhöhung durch einen hypothetischen Monopolisten eine Angebotssubstitution erfolgen wird, sind die hierzu notwendigen Voraussetzungen zu prüfen, d.h. das Vorhandensein von Produktionsanlagen, Know-how, Distributionssystemen, freien Kapazitäten etc. und es ist zu untersuchen, durch welche Unternehmen und in welchen Ausmaß eine solche Angebotssubstitution voraussichtlich erfolgen wird.91 Ist mit einer wirksamen Angebotssubstitution zu rechnen, dann stellt sich die Frage, auf welche Weise man sie bei der Marktabgrenzung berücksichtigen sollte. Zwei verschiedene Möglichkeiten sind denkbar. So könnten all die Produkte dem relevanten Markt zugeordnet werden, die von den Unternehmen produziert werden, die ihr Angebot umstellen bzw. umleiten würden, d.h. der relevante sachliche bzw. räumliche Markt wird erweitert.92 Zwar besteht zwischen Schuhen verschiedener Größe keine Substitutionsmöglichkeit in der Nachfrage, was dazu führen würde, dass bei einer nur auf Nachfragesubstitution abstellenden Marktabgrenzung eine Vielzahl relevanter Märkte entstehen würde, aber die meisten Unternehmen, die Schuhe herstellen, können ihre Produktion sehr schnell von einer Größe auf eine andere umstellen, sodass aufgrund einer solchen Angebotssubstitution der relevante Markt der für Schuhe ist. Ein ähnliches Vorgehen gilt auch für andere Güter, zwischen denen zwar keine Nachfragesubstitution besteht, die sich aber z.B. nur in Größe oder Farbe unterscheiden und bei denen Unternehmen schnell und problemlos ihr Angebot umstellen würden.93 Eine weitere Abgrenzung des relevanten Marktes setzt jedoch voraus, dass alle oder zumindest die meisten Unternehmen eine solche Angebotssubstitution durchführen. Ist diese Bedingung jedoch nicht erfüllt, dann sollte der relevante Markt nur im Hinblick auf die Nachfragesubstitution abgegrenzt werden, aber die Unternehmen, die Angebotssubstitute herstellen, wären als Marktteilnehmer zu betrachten und die Kapazitäten, die sie für die Umwidmung des Angebots einsetzen würden, wären bei der Berechnung der Marktanteile zu berücksichtigen. Könnten z.B. Unternehmen, die Radkappen herstellen, ihre Produktion schnell und problemlos auf Stoßstangen umstellen, wenn deren Preis steigen würde, dann wäre es nicht sinnvoll, Radkappen und Stoßstangen in einem relevanten Markt zusammenzufassen. Stattdessen würde man den relevanten Markt nur aufgrund der Nachfragesubstitution als den Markt für Stoßstangen abgrenzen, aber bei der Berechnung der Marktanteile wären die Kapazitäten der Radkappenhersteller, die sie für die Produktion von Stoßstangen einsetzen würden, zu berücksichtigen.94 Im Allgemeinen sollten beide Methoden zum gleichen oder zumindest zu ähnlichen Resultaten bezüglich der Marktanteile der Unternehmen führen.95
Eine Berücksichtigung der Angebotssubstitution entweder bei der Abgrenzung des relevanten Marktes oder bei der Berechnung der Marktanteile setzt jedoch voraus, dass quantitative Aussagen über die Angebotssubstitution möglich sind. Dies wird in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle jedoch sehr schwierig oder unmöglich sein, denn es muss festgestellt werden, welche Unternehmen als potentielle Anbieter eines Substitutes in Frage kämen. Hierzu sind jedoch Kenntnisse über ihre Technologie, ihr Know-how etc. notwendig, die meist nicht zur Verfügung stehen.96 Eine quantitative Erfassung der Angebotssubstitution entweder bei der Abgrenzung des relevanten Marktes oder bei der Berechnung der Marktanteile wird also häufig nicht möglich sein. Stattdessen ist in solchen Fällen auch die Angebotssubstitution, ähnlich wie der Markteintritt, erst bei der Beurteilung des Wettbewerbs nach der Abgrenzung des relevanten Marktes zu berücksichtigen.97 Wichtig ist dabei, dass die Marktanteile, deren Berechnung ja ohne Ermittlung der Angebotssubstitution erfolgt ist, die Marktmacht der Unternehmen tendenziell überschätzen. Sie sollten daher vorsichtig interpretiert werden.98
γ) Simultane sachliche und räumliche Marktabgrenzung
Bezüglich der Abgrenzung des relevanten Marktes in sachlicher bzw. räumlicher Hinsicht ist zu beachten, dass eine sequentielle Abgrenzung erst des sachlich und danach des räumlich relevanten Marktes zu Marktanteilen führen kann, die kein gutes Indiz für die Marktmacht eines Unternehmens sind, da sie die Marktmacht überschätzen. Grenzt man den relevanten Markt erst in sachlicher Hinsicht ab, dann betrachtet man Ausweichreaktionen der Nachfrager nur bezüglich anderer Produkte. Diese sind für sich allein genommen u.U. nicht ausreichend, um eine profitable Preiserhöhung zu verhindern. Man hat also einen engen sachlich relevanten Markt abgegrenzt. Wird dann in einem zweiten Schritt eine räumliche Marktabgrenzung vorgenommen, dann können die Ausweichreaktionen der Nachfrager auf andere Gebiete, ebenfalls für sich allein genommen, auch nicht ausreichend sein, eine Preiserhöhung zu verhindern. Der räumlich relevante Markt ist also ebenfalls eng abgegrenzt. Hätte man aber simultane Abgrenzung in sachlicher und räumlicher Hinsicht vorgenommen, dann wären beide Ausweichreaktionen zusammen unter Umständen ausreichend gewesen, eine Preiserhöhung unprofitabel zu machen, und der Markt wäre weiter abzugrenzen.99 Die unterschiedlichen Ergebnisse hängen vor allem davon ab, ob die Konsumenten, die auf andere Produkte ausweichen, verschieden von denen sind, die ihre Nachfrage auf andere Gebiete verlagern.100 Eine Analyse des europäischen Marktes für Lachs hat gezeigt, dass eine sequentielle Abgrenzung des relevanten sachlichen und räumlichen Marktes – im Unterschied zu einer simultanen Marktabgrenzung – zu sehr engen sachlichen und räumlichen Märkten führt, da bei einem sequentiellen Vorgehen die „Quersubstitution“ unberücksichtigt bleibt. Diese wird jedoch bei einer simultanen Abgrenzung des sachlichen und räumlichen Marktes berücksichtigt, sodass ein größerer relevanter Markt resultiert.
δ) Marktabgrenzung bei differenzierten Gütern
Ein weiteres konzeptionelles Problem stellt sich bei der Abgrenzung von Märkten mit differenzierten Gütern. Im Allgemeinen werden für ein bestimmtes Gut nicht alle differenzierten Güter in gleicher Weise als Substitute in Frage kommen, sondern es wird in vielen Fällen engere und weitere Substitute geben. Wenn dies der Fall ist, dann haben die Marktanteile von Unternehmen, die entferntere Substitute herstellen, ein anderes Gewicht als die von Unternehmen, die für ein gegebenes Produkt sehr enge Substitute herstellen. Gerade in Fusionsfällen kann dies jedoch problematisch sein, denn wenn die Hersteller von zwei engen Substituten fusionieren, kann die Auswirkung der Fusion auf den Wettbewerb erheblich sein, während bei der Fusion von Unternehmen, die zwar Produkte herstellen, die im gleichen relevanten Markt sind, aber nur entfernte Substitute bilden, selbst bei gleichen Marktanteilen keine großen Konsequenzen für den Wettbewerb haben.101 Das grundlegende Problem bei der Abgrenzung eines relevanten Marktes mit differenzierten Gütern besteht darin, dass Produkte entweder zum relevanten Markt gehören oder nicht. Anders ausgedrückt, durch dieses „binäre“ Vorgehen wird unterstellt, dass alle Produkte im relevanten Markt vollkommene Substitute sind, während zu den Produkten außerhalb des relevanten Marktes keinerlei Substitutionsbeziehung besteht. Dadurch wird der Einfluss von Produkten im relevanten Markt überschätzt und der von Produkten außerhalb des relevanten Marktes unterschätzt. Bei der Abgrenzung des relevanten Marktes wird der Wettbewerbsdruck, den ein Produkt auf die anderen ausübt, durch den Marktanteil erfasst und nicht durch die Intensität des Wettbewerbs.102
Wie eng die Substitutionsbeziehung zwischen zwei Produkten 1 und 2 und wie intensiv infolgedessen der Wettbewerb zwischen diesen beiden Produkten ist, kann mithilfe der Umlenkungskennziffer beschrieben werden.103 Da die Anteile in einem Markt mit differenzierten Gütern die erste Präferenz der Konsumenten bezüglich der Güter in diesem Markt widerspiegeln, gibt der Marktanteil von Produkt 1 den Anteil der Verbraucher an, die das Produkt 1 gegenüber allen anderen Produkten auf dem relevanten Markt bevorzugen. Die Umlenkungskennziffer in Bezug auf das Produkt 2 gibt an, wie viele Verbraucher bei einer Erhöhung des Preises von Produkt 1 zu Produkt 2 wechseln würden. Dies sind die Verbraucher, die das Produkt 2 als zweite Präferenz haben. Eine Umlenkungskennziffer von 33 % in Bezug auf Produkt 2 bedeutet zum Beispiel, dass ein Drittel des durch die Preiserhöhung eingebüßten Umsatzes von Produkt 1 auf das Produkt B umgelenkt wird. Je höher das Umlenkungskennziffer, desto intensiver ist der Wettbewerb zwischen den beiden Produkten. Marktanteile in einem Markt mit differenzierten Produkten sind daher nur insoweit ein Indikator für die Enge der Substitutionsbeziehung bzw. die Wettbewerbsintensität, als sie proportional zur Umlenkungskennziffer sind. Dies gilt jedoch nur dann, wenn alle Produkte auf dem relevanten Markt „gleichmäßig differenziert“ sind, d.h., dass der „Abstand“ der Produkte voneinander der gleiche ist.104 Dies dürfte jedoch in den meisten Märkten nicht gegeben sein, sondern ein relevanter Markt wird engere und weitere Substitute umfassen, d.h. Produkte, die mit unterschiedlicher Intensität miteinander im Wettbewerb stehen und die nicht mit den Marktanteilen korreliert sind. Infolgedessen werden die Auswirkungen einer Fusion vor allem von der Enge der Substitutionsbeziehung zwischen den Produkten der fusionierenden Unternehmen und weniger von ihren jeweiligen Marktanteilen abhängen.
Wichtig bei Analysen von Märkten mit differenzierten Gütern sind daher Informationen über die Stärke des Wettbewerbs zwischen diesen differenzierten Gütern. Eine Marktabgrenzung bei differenzierten Gütern ist daher höchst problematisch und kann leicht einen willkürlichen Charakter annehmen. Die Marktanteile der Unternehmen müssen daher in solchen Fällen mit größter Vorsicht interpretiert werden.105
In der Vergangenheit wurde dem Problem der Marktabgrenzung bei differenzierten Gütern häufig dadurch begegnet, dass in solchen Märkten neben einem zumeist nach dem Bedarfsmarktkonzept und den Kriterien der funktionellen Austauschbarkeit, der vergleichbaren Preislage, der intendierten Verwendung und den physischen Eigenschaften abgegrenzten relevanten Markt noch weitere Teilmärkte innerhalb dieses Marktes spezifiziert wurden. Ein solches Vorgehen wird jedoch bei Anwendung des hypothetischen Monopolistentests als Methode zur Marktabgrenzung abgelehnt.106 Andererseits haben Unternehmen, je nachdem, ob sie enge oder entfernte Substitute herstellen, einen unterschiedlichen Einfluss auf den Wettbewerb, der aber durch die Marktanteile nicht erfasst wird. In einer solchen Situation könnte man, um nur die Anbieter enger Substitute zu erfassen, einen Teilmarkt innerhalb des relevanten Marktes abgrenzen. Einerseits könnte man zwar hierdurch das Problem eines „lokalen Wettbewerbs“ zwischen Unternehmen zu erfassen versuchen, aber andererseits würden wichtige wettbewerbliche Schranken durch die Nachfragesubstitution unberücksichtigt gelassen.107 Die Auswirkungen des Verlustes an „lokalem Wettbewerb“ sollten daher nicht durch die Bildung von Teilmärkten erfasst werden, sondern durch eine Einschätzung der Wettbewerbssituation im gesamten relevanten Markt. So könnte man versuchen, die Marktanteile entsprechend anzupassen oder zu gewichten,108 was aber aufgrund einer gewissen Beliebigkeit ebenfalls keine befriedigende Lösung ist. Daher sollte bei der Analyse von Märkten mit differenzierten Gütern der Marktabgrenzung und den Marktanteilen insgesamt eine geringere Bedeutung beigemessen werden, und die direkte Untersuchung der wettbewerbsmindernden Wirkungen z.B. eines Zusammenschlusses sollte in den Vordergrund treten.109
Aufgrund der Tatsache, dass es zum einen problematisch ist, im Falle differenzierter Güter einen relevanten Markt sinnvoll abzugrenzen und zum anderen, dass zwischen den Marktanteilen der Produkte und der Enge der Substitutionsbeziehungen bzw. der Intensität des Wettbewerbs zwischen den Produkten kein unmittelbarer Zusammenhang besteht, wurde in den letzten Jahren eine Reihe von Vorschlägen gemacht, wie man die Auswirkungen eines Zusammenschlusses auf das Marktergebnis erfassen kann, ohne erst eine Abgrenzung des relevanten Marktes vornehmen zu müssen. Dabei handelt sich sich um so genannte Indikatoren des Preissteigerungsdrucks (pricing pressure indices), wie den „Upward Pricing Pressure“ (UPP) oder den „Gross Upward Pricing Pressure Index“ (GUPPI). Diese Indikatoren haben jedoch nicht das Zweck, den relevanten Markt abzugrenzen, sondern sollen Aussagen über die möglichen Auswirkungen einer Fusion auf das Marktergebnis ermöglichen, sodass bereits in einer frühen Phase der Untersuchung eine Wettbewerbsbehörde entscheiden kann, ob sie die Fusion einer näheren Prüfung unterziehen sollte, ohne dass vorher eine komplexe und zeitaufwendige Marktabgrenzung erforderlich wäre. Diese Konzepte werden im Kontext der Analyse der Auswirkungen eines Zusammenschlusses im Dritten Teil, C.IV.2 im Detail besprochen.
In digitalen Märkten ist darüber hinaus eine Produktdifferenzierung hinsichtlich des Online- bzw. Offline-Angebots zu beachten. Manche Produkte werden, wie z.B. eBooks, online angeboten, sind aber auch, als gebundene Bücher oder Taschenbücher, offline verfügbar. Hier stellt sich entsprechend die Frage, ob Online- und Offline-Produkte als Substitute zu betrachten sind, die dem gleichen relevanten Markt zugehören. Bei einigen Produkten betrifft die Unterscheidung vor allem den Vertriebskanal, wenn bestimmte Produkte, z.B. Kleidung, über die Website des Herstellers erhältlich sind, aber auch in Ladengeschäften.110 Dabei können, wie z.B. bei Sportschuhen, bestimmte Beratungs- und Serviceleistungen nur in Ladengeschäften angeboten werden. Bei bestimmten Dienstleistungen, wie z.B. Beratungsdienstleistungen, die entweder online über entsprechende Websites angeboten werden oder in Form einer direkten und persönlichen Beratung durch einen Experten, wie z.B. einen Steuerberater, könnten die Differenzen so erheblich sein, dass von unterschiedlichen relevanten Märkten ausgegangen werden muss.
Bei der Abgrenzung des relevanten Marktes sollte jedoch nicht entscheidend sein, welche Vertriebswege für ein Produkt Verwendung finden, um unterschiedliche relevante Märkte abzugrenzen. Konzeptionell ist auch bei der Frage, ob Online- und Offline-Angebote dem gleichen relevanten Markt zugeordnet werden sollten, der Ansatz des hypothetischen Monopolistentests aus ökonomischer Sicht die sinnvollste Vorgehensweise: Würde ein gewinnmaximierender Monopolist die Preise für die Produkte, z.B. im Online-Markt, erhöhen und dies ein Substitutionsverhalten der Abnehmer auslösen, so würde dies eine solche Preiserhöhung unprofitabel machen.
Insbesondere im Zusammenhang mit Werbung gibt es eine intensive Diskussion, ob Online- und Offline-Werbung dem gleichen relevanten Markt zuzurechnen ist.111 Der Unterschied zwischen beiden Formen der Werbung basiert vor allem darauf, dass es sich bei Online-Werbung in vielen Fällen um personalisierte Werbung handelt, die aufgrund des Such- oder des Kaufverhaltens eines Konsumenten auf seine persönlichen Präferenzen abgestimmt ist (search-based advertising). Die Ergebnisse einer Suchanfrage enthalten dann Werbung, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der jeweiligen Suchanfrage steht und die entsprechenden Produkte und Dienstleistungen bewirbt. Daneben gibt es online aber auch nicht-personalisierte Werbung, die jedem Konsumenten in der gleichen Form beim Aufruf einer bestimmten Website gezeigt wird (display advertising). Hier kaufen Unternehmen Werbefläche auf bestimmten Webseiten, die mit ihren Angeboten in engem Zusammenhang stehen. Neben der Online-Werbung stehen den Unternehmen natürlich noch die herkömmlichen Medien zur Verfügung, wie zum Beispiel Fernsehwerbung, Anzeigen in Zeitungen und Zeitschriften, Plakatwerbung usw. Die Frage, ob Online- und Offline-Werbung unterschiedlichen relevanten Märkten zugeordnet werden müssen, hängt in erster Linie davon ab, wie eng die Substitutionsbeziehung für werbetreibende Unternehmen zwischen den verschiedenen Werbeformen ist.112 Hier könnte im Prinzip der hypothetische Monopolistentest angewandt und untersucht werden, mit welchem Substitutionsverhalten bei einer Preiserhöhung gerechnet werden muss. Allerdings ist zu beachten, dass bei Plattformmärkten unter Umständen Rückkopplungseffekte mit der anderen Marktseite bei der Abgrenzung des relevanten Marktes berücksichtigt werden müssen. Allerdings dürften sich diese bei Werbung in überschaubaren Grenzen halten.