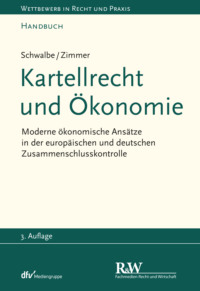Kitabı oku: «Kartellrecht und Ökonomie», sayfa 15
2. Empirische Verfahren zur Marktabgrenzung
Im folgenden Abschnitt sollen kurz die wichtigsten für die Abgrenzung des relevanten Marktes verwendeten empirischen Methoden und Verfahren dargestellt werden.147 Dabei werden zuerst solche Methoden beschrieben, mit denen eine direkte Implementation des hypothetischen Monopolistentests durchgeführt werden kann. Anschließend werden kurz die wichtigsten Verfahren skizziert, die mithilfe von Preistests festzustellen versuchen, welche Produkte demselben relevanten Markt zuzurechnen sind.148
a) Preiselastizität der Nachfrage
Ob ein gewinnmaximierender hypothetischer Monopolist eine nicht-vorübergehende kleine, aber signifikante Preiserhöhung durchführen wird, hängt von der Preiselastizität der Nachfrage bzw. der Residualnachfrage und der Kostenstruktur des Monopolisten ab. Daher müssen für eine direkte Implementation des hypothetischen Monopolistentests Informationen über die Elastizität der Nachfrage- bzw. der Residualnachfragefunktion zur Verfügung stehen. Ist die Preiselastizität der Nachfrage hoch, dann verfügt ein hypothetischer Monopolist häufig nicht über Marktmacht im betrachteten Kandidatenmarkt. Diesem Markt müssen weitere Produkte bzw. Gebiete hinzugefügt werden, bis die Preiselastizität der Nachfrage einen hinreichend niedrigen Wert angenommen hat, sodass eine Preiserhöhung von mindestens 5 % gewinnmaximierend wäre.149 Es sind in der Literatur eine Reihe von Verfahren vorgeschlagen worden, mit denen man Nachfrage- bzw. Residualnachfragefunktionen schätzen kann.150 Die Elastizität einer solchen Funktion kann dann leicht festgestellt werden. Die zur Schätzung von Nachfragefunktionen verwendeten empirischen Methoden beruhen auf einer sogenannten Regressionsanalyse.151 Die Nachfrage nach einem Produkt wird als Funktion mehrerer anderer, unabhängiger Variablen, wie z.B. des Preises des Gutes, der Preise von Substituten und Komplementen etc. aufgefasst und der Verlauf der Nachfragefunktion wird mittels ökonometrischer Verfahren geschätzt. Wichtig ist weiterhin, dass ein für die Untersuchung geeigneter Zeitrahmen gewählt wird, da z.B. bei dauerhaften Konsumgütern die kurzfristigen Nachfragereaktionen geringer ausfallen als bei einer längerfristigen Betrachtung. Bei einer Schätzung der Residualnachfrage müssen darüber hinaus auch die Angebotsreaktionen potentieller Wettbewerber berücksichtigt werden. Mit Hilfe statistischer Tests kann festgestellt werden, wie robust die geschätzte Nachfragefunktion ist. Allerdings sind für eine Regressionsanalyse zumeist lange Datenreihen erforderlich, die unter möglichst stabilen Angebots- und Nachfragebedingungen entstanden sein sollten, um präzise Aussagen über den Verlauf der Nachfragefunktion zu ermöglichen. Die zur Schätzung verwendeten ökonometrischen Methoden sind in der Regel recht komplex, erfordern einen großen Zeitaufwand und können zumeist nur von Ökonometrikern durchgeführt werden.
Informationen über die Elastizität der Nachfragefunktion sind jedoch allein nicht ausreichend, um Aussagen darüber treffen zu können, ob eine Preiserhöhung für einen hypothetischen Monopolisten profitabel ist. Hierzu sind Informationen über die Kosten des Unternehmens bzw. über die Gewinnspanne, d.h. über die Differenz zwischen Preis und Grenzkosten, erforderlich. Diese Informationen können dann kombiniert werden, um festzustellen, ob eine signifikante Preiserhöhung stattfinden wird.
b) Kritische Elastizitäten und kritischer Absatzrückgang
Als komplementär zur Nachfrageanalyse werden in der Wettbewerbspolitik die Konzepte des kritischen Absatzrückgangs (critical sales loss) und der kritischen Elastizität (critical elasticity) verwendet.152 Um festzustellen, ob ein hypothetischer, gewinnmaximierender Monopolist die Preise um 5–10 % erhöhen würde, ist zu berücksichtigen, dass eine solche Preiserhöhung zwei Effekte hat: So ist durch die Preiserhöhung die Gewinnmarge bei den Einheiten, die er nach der Preiserhöhung verkauft, gestiegen, aber die Menge, die er absetzt, ist geringer geworden. Eine Preiserhöhung ist daher nur dann gewinnbringend, wenn der zusätzliche Erlös aufgrund von Verkäufen mit einer höheren Gewinnmarge größer ist als der geringere Erlös aufgrund des Rückgangs der verkauften Menge. Dieses Verhältnis zwischen der Gewinnmarge und der Nachfragesubstitution aufgrund einer Preiserhöhung von s Prozent hat zum Konzept des kritischen Absatzrückgangs (critical sales loss) und der damit verknüpften kritischen Elastizität (critical elasticity) geführt. Der kritische Absatzrückgang ist der maximale Wert, um den sich die abgesetzte Menge eines gewinnmaximierenden hypothetischen Monopolisten verringern darf, damit er eine Preiserhöhung von z.B. 5 % durchführt. Überschreitet der Absatzrückgang diesen kritischen Wert, dann wäre eine Preiserhöhung von 5 % nicht gewinnmaximierend und der Markt müsste weiter abgegrenzt werden; liegt er darunter, dann wäre eine Preiserhöhung um mindestens 5 % gewinnmaximierend und der relevante Markt wäre gefunden.
Die kritische Elastizität der Nachfrage gibt an, welchen Wert die Preiselastizität der Nachfrage maximal annehmen darf, damit ein gewinnmaximierender hypothetischer Monopolist eine Preiserhöhung von z.B. mindestens 5 % durchführen wird. Überschreitet die tatsächliche Elastizität diesen kritischen Wert, dann wird keine solche Preiserhöhung zu erwarten sein und der relevante Markt muss weiter gefasst werden.
Der kritische Absatzrückgang muss also mit dem erwarteten tatsächlichen Absatzrückgang verglichen werden, den ein Unternehmen durch eine Preiserhöhung x erleiden würde. Dieser tatsächliche Rückgang der abgesetzten Menge ergibt sich näherungsweise aus der Preiserhöhung x multipliziert mit der Preiselastizität der Nachfrage ɛ. Ist der kritische Absatzrückgang kleiner als der tatsächliche, so wäre eine Preiserhöhung von 5 % unprofitabel, die nächstbesten Substitute müssten dem Kandidatenmarkt hinzugefügt und die Analyse des kritischen Absatzrückgangs muss mit dem erweiterten Kandidatenmarkt wiederholt werden.
Der kritische Absatzrückgang, d.h. der Absatzrückgang, bei dem der Monopolist gerade indifferent wäre, eine Preiserhöhung durchzuführen oder nicht, kann wie folgt ermittelt werden:153 Angenommen der Preis in der Ausgangssituation beträgt p0 und steigt nach einer Erhöhung auf p1. Die bei diesen nachgefragten Mengen seien mit X(p0) und X(p1) bezeichnet. Dabei ist unterstellt, dass die Nachfrage beim höheren Preis geringer ist als beim niedrigeren Preis. Der Gewinn des Monopolisten, der annahmegemäß mit konstanten Grenzkosten in Höhe von c produziert, hängt vom Preis ab und wird mit π(p0) bzw. π(p1) bezeichnet. Der Preisunterschied p1 – p0 wird durch Δp beschrieben, die Gewinndifferenz durch Δπ und die Nachfrageänderung X(p1) – X(p0) durch ΔX. Der Monopolist wäre indifferent bezüglich einer Preiserhöhung, wenn sein Gewinn dadurch unverändert bliebe, d.h. wenn gilt:

Der Ausdruck (p1 – p0)X(p1) gibt den zusätzlichen Gewinn an, den er durch den Verkauf der Menge X(p1) zum höheren Preis p1 erzielt und der Term (p0 – c) (X(p0) – X(p1)) bezeichnet die Gewinneinbuße aufgrund der geringeren abgesetzten Menge. Wenn beide Effekte gleich groß sind, dann würde eine Preiserhöhung den Gewinn unverändert lassen. Diese Bedingung kann geschrieben werden als

bzw.

Teilt man diesen Ausdruck durch X(p0) und p0 und ordnet die Terme, dann ergibt sich

Der Ausdruck auf der linken Seite der Gleichung ist der durch die Preiserhöhung bedingte prozentuale Rückgang der abgesetzten Menge, d.h. der kritische Absatzrückgang (critical loss (CL)), der Term (p1 – p0)/p0 = s bezeichnet die Preiserhöhung in Prozent und (p0 – c)/p0 = m gibt die Gewinnmarge in Prozent an.
Der kritische Absatzrückgang kann daher geschrieben werden als

Beträgt die Preiserhöhung beispielsweise 5 % und die Gewinnmarge 45 %, dann würde der kritische Verlust 10 % betragen, d.h. das Unternehmen müsste 10 % seiner Nachfrage verlieren, wenn der Preis um 5 % steigen würde, um eine Preiserhöhung unprofitabel zu machen. Der kritische Absatzrückgang ist dabei unabhängig von der spezifischen Form der Nachfragefunktion und hängt nur von der Preiserhöhung und der Gewinnmarge ab. Es ist zu beachten, dass diese Form des kritischen Absatzrückgangs lediglich untersucht, ob eine Preiserhöhung für einen hypothetischen Monopolisten profitabel wäre, nicht aber, ob ein gewinnmaximierender hypothetischer Monopolist eine solche Preiserhöhung auch durchführen würde.154 Man kann daher auch einen „gewinnmaximierenden“ kritischen Absatzrückgang definieren, der, wie man zeigen kann, immer kleiner ist als der „gewinnneutrale“ Absatzrückgang. Implementiert man den hypothetischen Monopolistentest also mit dem gewinnneutralen CL, so kann dies zu engeren relevanten Märkten führen, da der Monopolist mehr an Absatz verlieren kann, bevor der kritische Wert erreicht wird.
Anders als beim gewinnneutralen CL hängt der kritische Absatzrückgang für einen gewinnmaximierenden hypothetischen Monopolisten von der Form der Nachfragefunktion ab.155 So ist der kritische Absatzrückgang bei einer linearen Nachfragefunktion  gegeben durch
gegeben durch

wobei das Subskript l für „linear“ steht. Im Falle einer isoelastischen Nachfragefunktion beträgt er

wobei das Subskript i für isoelastisch steht.
Die kritische Elastizität bzw. der kritische Absatzrückgang ist dann in einem zweiten Schritt mit der tatsächlichen Elastizität der Nachfragefunktion bzw. mit dem tatsächlich zu erwartenden Absatzrückgang, dem Actual Loss, zu vergleichen.156 Zur Ermittlung der tatsächlichen Elastizität sind entweder ökonometrische Schätzungen heranzuziehen oder es können Näherungswerte, z.B. aus Befragungen von Konsumenten, ermittelt werden. Ist nun der tatsächliche Absatzrückgang geringer als der kritische, dann sollte der Kandidatenmarkt um die engsten Substitute erweitert werden. Eine Preiserhöhung ist unprofitabel (oder zumindest nicht gewinnmaximierend), wenn der tatsächliche Verlust den kritischen Verlust übersteigt. Wenn dies der Fall ist, so ist der relevante Markt gefunden.
Ein wichtiger Aspekt beim Konzept des kritischen Absatzrückgangs ist darin zu sehen, dass eine höhere Gewinnmarge einen geringeren Absatzrückgang impliziert, da bei einer höheren Marge schon ein vergleichsweise kleiner Absatzrückgang eine Preiserhöhung unprofitabel machen kann. Daher wird von Seiten der fusionierenden Unternehmen oft argumentiert, dass eine Preiserhöhung von 5 % zu einem Absatzrückgang führen wird, der deutlich größer ist als der kritische Wert. Eine solche Preiserhöhung wäre daher nicht profitabel und der Kandidatenmarkt müsste um zusätzliche Produkte erweitert werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass eine bereits beim herrschenden Preis große Gewinnmarge darauf hindeutet, dass die Preiselastizität der Nachfrage bei diesem Preis gering ist, d.h. die Verbraucher reagieren nicht sonderlich preisempfindlich. Daher ist es nicht überraschend, dass eine geringe Preiserhöhung mit einem geringen Absatzrückgang einhergeht. Die große Gewinnmarge bei herrschenden Preisen und die durch eine Preiserhöhung verursachten Einbußen deuten vielmehr darauf hin, dass der Preis bereits über das Wettbewerbsniveau angehoben wurde. Wenn dies der Fall wäre, würde das Unternehmen bereits über Marktmacht verfügen und der relevante Markt sollte nicht erweitert werden.
Eine Reihe von Punkten ist bei der Verwendung kritischer Elastizitäten bzw. des kritischen Absatzrückgangs zu beachten. So wurde darauf hingewiesen, dass der hypothetische Monopolist gegebenenfalls mehrere Produkte herstellt, bei denen es sich aber um differenzierte Produkte handeln könnte. In solchen Fällen muss die Substitution zwischen den Produkten, die durch Kreuzpreiselastizitäten und Umlenkungskennziffern gekennzeichnet ist, bei der Berechnung des kritischen Verlustes berücksichtigt werden.157 Wenn z.B. ein hypothetischer Monopolist für die Produkte 1 und 2 den Preis von Produkt 1 erhöhen würde, dann würde ein Teil D der reduzierten Nachfrage auf Produkt 2 umgelenkt werden, und als tatsächlicher Verlust wäre nur der Absatzrückgang zu verbuchen, der nicht durch das Produkt 2 zurückgewonnen wird. Im Falle einer einheitlichen Preiserhöhung für beide Produkte (oder alle Produkte im Kandidatenmarkt) gibt die aggregierte Umlenkungskennziffer D den Anteil des Absatzrückgangs an, der von allen anderen Produkten des hypothetischen Monopolisten aufgefangen wird. Der tatsächliche Absatzrückgang ist daher gegeben durch (1 – D)sε. Unter Verwendung des Lerner-Index kann dieser Ausdruck geschrieben werden als (1 – D)s/m.158 Dieser tatsächliche Absatzrückgang ist kleiner als der gewinnneutrale kritische Absatzrückgang, d.h. der relevante Markt ist definiert, wenn gilt:

Diese Bedingung ist umso eher erfüllt, je höher die Gewinnmarge ist und/oder wenn die aggregierte Umlenkungskennziffer groß ist, d.h. wenn der hypothetische Monopolist in der Lage ist, einen großen Teil der durch eine Preiserhöhung bei einem seiner Produkte eingebüßten Nachfrage bei seinen anderen Produkten zurückzugewinnen.
Wird statt des „gewinnneutralen“ kritischen Absatzrückgang der „gewinnmaximierende“ kritische Absatzrückgang verwendet, dann lautet, bei linearer Nachfrage, die entsprechende Bedingung

Das Konzept des kritischen Absatzrückgangs wurde in den letzten Jahren auf verschiedene Arten oligopolistischer Interaktion erweitert. Dabei wurden die Preisreaktionen anderer Unternehmen im Markt berücksichtigt, unterschiedliche Reaktionen bei Preiserhöhungen und -senkungen sowie andere Aspekte, die einen Einfluss auf den Gewinn eines Unternehmens haben.159 Der kritische Absatzrückgang wurde auch für die Abgrenzung des räumlich relevanten Marktes herangezogen.160 In zweiseitigen Märkten muss bei der Verwendung des kritischen Absatzrückgangs berücksichtigt werden, dass zwischen den verschiedenen Nachfragergruppen indirekte Netzwerkeffekte bestehen, d.h. der Absatzrückgang auf beiden Marktseiten ist zu beachten. Die Gleichung zur Abschätzung des kritischen Absatzrückgangs muss entsprechend modifiziert werden, ansonsten wird der Markt zu eng abgegrenzt.161
In der Praxis stellt sich bei der Umsetzung des hypothetischen Monopolistentests eine Reihe von Problemen.162 So muss zur Ermittlung der erforderlichen Werte die Gewinnspanne des hypothetischen Monopolisten festgestellt werden, was häufig zu Problemen führt.163 Die Gewinnspanne als Differenz zwischen Preis und Grenzkosten bzw. den stattdessen approximativ verwendeten variablen Stückkosten ist um so größer, je höher der Anteil der Fixkosten an den Gesamtkosten ist.164 Weitere Probleme bei der Verwendung kritischer Elastizitäten bzw. des kritischen Absatzrückgangs können z.B. dann auftreten, wenn unterschiedliche Konsumenten signifikant verschiedene Preiselastizitäten der Nachfrage haben, wenn die Grenzkosten bzw. variablen Stückkosten zwischen verschiedenen Produktionsstätten stark variieren oder wenn erhebliche vermeidbare Fixkosten vorliegen. Weiterhin wird bei der oben dargestellten Ermittlung des kritischen Absatzrückgangs implizit davon ausgegangen, dass die Grenzkosten des hypothetischen Monopolisten konstant bleiben und dass die Kosten- und Nachfragefunktion stetig sind. Wenn jedoch bei einer Verringerung der Absatzmenge, z.B. durch eine Werksschließung, Fixkosten in erheblichem Umfang eingespart werden, dann könnte eine mechanische Anwendung der Formeln zu übermäßig weit abgegrenzten Märkten führen.
Aber auch wenn die Bedingungen für die Anwendung des kritischen Absatzrückgangs und des tatsächlichen Absatzrückgangs erfüllt sind, ergeben sich in vielen Fällen Probleme die vor allem mit den zur Verfügung stehenden Daten zusammenhängen. So erfordert die Anwendung der CL-Analyse detaillierte Informationen über das Substitutionsverhalten der Konsumenten, d.h. eine Schätzung der Umlenkungskennziffern und der Gewinnmargen der Unternehmen. Insbesondere die Abschätzung des tatsächlichen Umsatzrückgangs ist für die Qualität einer Analyse des kritischen Absatzrückgangs von zentraler Bedeutung. Wenn jedoch die genannten Bedingungen erfüllt sind und die erforderlichen Daten zur Verfügung stehen, dann kann der hypothetische Monopolistentest mithilfe einer CL-Analyse implementiert werden.
c) Preistests
Mithilfe dieser empirischen Verfahren und Methoden kann der hypothetische Monopolistentest in Bezug auf den sachlich relevanten Markt direkt durchgeführt werden. Allerdings kann eine solche direkte Implementation problematisch sein, wenn z.B. die notwendigen Daten nicht oder nicht in ausreichender Qualität zur Verfügung stehen oder der Zeitrahmen für eine genaue quantitative Analyse nicht ausreichend ist. In solchen Fällen stehen eine Reihe anderer empirischer Verfahren zur Verfügung, mit deren Hilfe zumindest indirekt festgestellt werden kann, welche Produkte der Ausübung von Marktmacht wettbewerbliche Schranken setzen und daher demselben relevanten Markt zugeordnet werden sollten. Hierzu gehören vor allem solche Verfahren, die auf die Preisentwicklungen verschiedener potentieller Substitute abstellen. Dies sind die Preiskorrelationsanalyse, die Stationaritäts- und die Schockanalyse. Für Fragen der räumlichen Marktabgrenzung können Daten über Handelsströme zwischen Gebieten sowie über die Preise und Preisentwicklungen in verschiedenen Gebieten wichtige Informationen liefern.165
Die Preiskorrelationsanalyse basiert auf der Überlegung, dass die Preise von zwei Gütern 1 und 2, die in einer Substitutionsbeziehung zueinander stehen, sich im Zeitablauf in der gleichen Weise entwickeln werden. Wenn der Preis des Produktes 1 steigt, dann werden einige Konsumenten auf das Substitut 2 ausweichen. Die Nachfrage nach diesem Substitut wird also zunehmen, und damit wird auch der Preis dieses Substitutes steigen. Auch würden einige Anbieter des Gutes 2 zur Produktion des teurer gewordenen Gutes 1 wechseln und dadurch tendenziell den Preis dieses Gutes verringern. Auch dieser Effekt würde dazu führen, dass sich die Preise von zwei Substituten in der gleichen Weise ändern, d.h. die Preisbewegungen wären positiv korreliert.166 Die Preiskorrelation erlaubt eine Aussage darüber, wie eng die Beziehung zwischen den Preisänderungen zweier Produkte ist. Sie wird gemessen mittels des Korrelationskoeffizienten, der zwischen –1 und +1 liegt. Dabei bedeutet ein Korrelationskoeffizient nahe 1, dass die Preise der beiden Produkte sich fast in identischer Weise ändern. Zu beachten ist, dass nicht die absolute Preishöhe der beiden Produkte entscheidend ist, sondern vielmehr, ob die Preise sich in der gleichen Weise ändern. Unterschiede in der Preishöhe können auf tatsächliche oder vermeintliche Qualitätsunterschiede zurückzuführen sein, wie z.B. bei Markenprodukten und Handelsmarken. Darüber hinaus könnte auch trotz eines hohen Korrelationskoeffizienten, d.h. trotz einer engen Substitutionsbeziehung, der Fall vorliegen, dass ein Produkt allein einen relevanten Markt bildet, denn der wettbewerbliche Druck des Substitutes ist unter Umständen nicht ausreichend, um Marktmacht zu verhindern. Ein hoher Korrelationskoeffizient ist notwendig, aber nicht hinreichend dafür, beide Produkte dem gleichen relevanten Markt zuordnen zu können.167
Um festzustellen, bei welchem Wert des Korrelationskoeffizienten (0.5, 0.7 oder 0.9) eine hinreichend enge Substitutionsbeziehung vorliegt, um die Produkte gegebenenfalls dem gleichen relevanten Markt zuzuordnen, bedient man sich der Technik des sogenannten Benchmarking.168 Hier wird der Korrelationskoeffizient zwischen den Zeitreihen der Preise zweier Produkte herangezogen, die unzweifelhaft im gleichen relevanten Markt liegen (z.B. zweier Sorten kohlensäurehaltigen Mineralwassers). Liegt der Korrelationskoeffizient zweier Produkte über diesem Wert, dann ist davon auszugehen, dass diese Produkte dem gleichen relevanten Markt angehören. Ein weiteres Problem besteht im Auftreten einer sogenannten Scheinkorrelation. Aufgrund der Tatsache, dass sich der Preis eines Inputfaktors ändert, der für die Produktion von zwei recht unterschiedlichen Gütern von großer Relevanz ist, werden sich auch die Preise der beiden Güter in der gleichen Weise ändern, sodass scheinbar eine Substitutionsbeziehung zwischen den beiden Produkten vorliegt, die jedoch – wenn man von der Preisänderung des gemeinsamen Inputs absieht – nicht vorhanden ist. Um dieses Problem zu vermeiden, ist immer darauf zu achten, die Preiseffekte zu eliminieren, die durch gemeinsame Inputs erzeugt werden. Ebenso sind die Preise von saisonalen Schwankungen sowie allgemeinen Preistrends zu bereinigen. Ein weiteres Problem besteht darin, dass die Preise eines Gutes erst mit einer Zeitverzögerung reagieren können, sodass eine geringe Preiskorrelation vorzuliegen scheint, obwohl die Produkte enge Substitute sind und die Preiskorrelation langfristig hoch ist.169 Diese Probleme machen deutlich, dass die Ergebnisse einer Preiskorrelationsanalyse häufig sehr vorsichtig interpretiert werden müssen. Allerdings wird in vielen Fällen ein niedriger Korrelationskoeffizient darauf hindeuten, dass die betrachteten Produkte nicht im gleichen relevanten Markt liegen, sodass dieses Verfahren weniger Beweiskraft als Widerlegungskraft besitzt.
Ein der Preiskorrelationsanalyse verwandtes Verfahren ist die Stationaritätsanalyse, bei der die Entwicklung des Relativpreises von zwei Produkten bzw. des Relativpreises eines Produktes in zwei Gebieten über die Zeit betrachtet wird.170 Ist der Relativpreis im Zeitablauf stationär, d.h. liegt er bei einem stabilen Wert, bzw. kehrt er nach einer exogenen Störung wieder zu diesem stabilen langfristigen Wert zurück, dann liegt die Vermutung nahe, dass die beiden Produkte im selben relevanten Markt liegen. Würde der Preis eines Gutes steigen, d.h. würde sich der Relativpreis ändern, dann würden Nachfrager auf das nun relativ günstigere Produkt ausweichen, dessen Preis würde aufgrund der erhöhten Nachfrage steigen, sodass sich der Relativpreis wieder dem Ausgangswert nähert. Je schneller dies geschieht, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Güter im selben relevanten Markt liegen. Die Stationaritätsanalyse kann erweitert werden, um zu untersuchen, ob mehrere Produkte im gleichen relevanten Markt sind. Hierzu werden Relativpreise in Bezug auf einen Basispreis festgelegt und es wird untersucht, ob alle diese Relativpreise stationär sind. Wenn dies der Fall ist, dann ist zu vermuten, dass die Produkte dem gleichen relevanten Markt zugehören. Die Stationaritätsanalyse vermeidet einige der Probleme der Preiskorrelationsanalyse, da erstens der Einfluss eines gemeinsamen Kostenfaktors bei Bildung des Relativpreises automatisch eliminiert wird und zweitens Zeitverzögerungen bei der Preisanpassung berücksichtigt werden. Aus diesen Gründen liefert eine Stationaritätsanalyse zumeist verlässlichere Resultate als eine Untersuchung der Preiskorrelation. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die Geeignetheit sowohl der Preiskorrelations- als auch der Stationaritätsanalyse als Instrument zur Abgrenzung des relevanten Marktes seit einigen Jahren kontrovers diskutiert wird.171
Eine andere Methode, mit deren Hilfe man feststellen kann, ob zwei Produkte demselben relevanten Markt zuzuordnen sind, ist die sogenannte Schockanalyse.172 Eine derartige Analyse ist in den meisten Fällen relativ einfach durchzuführen, da man dazu nur wenige Daten benötigt. Man betrachtet einen Markt, in dem in der Vergangenheit plötzliche und unerwartete Änderungen des Angebotes oder der Nachfrage, sogenannte Schocks, aufgetreten sind und versucht anhand der Entwicklung der Preise nach diesem Schock Informationen darüber zu erhalten, ob bestimmte Produkte im gleichen relevanten Markt liegen. Ein solcher Schock könnte z.B. die Einführung eines neuen Produktes durch einen Konkurrenten sein, ein Streik oder eine neue Technologie. Wird z.B. ein neues Produkt mit niedrigerem Preis eingeführt, dann würde man erwarten, dass Produkte im gleichen relevanten Markt in ähnlicher Weise auf diesen Schock reagieren. Findet aber nur bei einigen der etablierten Produkte eine Preisreaktion statt, während andere auf den Schock nicht reagieren, dann deutet dieses unterschiedliche Verhalten darauf hin, dass die Produkte nicht im gleichen relevanten Markt sind.173
Schockanalysen können auch zur Abgrenzung des relevanten räumlichen Marktes herangezogen werden. Wenn sich z.B. die Frage stellt, ob der relevante geographische Markt mehrere Länder umfasst, dann kann man untersuchen, wie die Preise des Produktes in diesen Ländern variieren, von denen eines einem Schock ausgesetzt war, z.B. einer signifikanten Erhöhung der Verbrauchssteuer oder des Wechselkurses. Nähert sich der Relativpreis zwischen den Produkten nach einiger Zeit wieder dem Niveau vor dem Schock an, so deutet dies darauf hin, dass der relevante räumliche Markt beide Länder umfasst. Ist dies nicht der Fall, d.h. hat sich der Relativpreis aufgrund des Schocks dauerhaft geändert, dann liegt die Vermutung nahe, dass die Länder getrennte räumliche Märkte bilden.