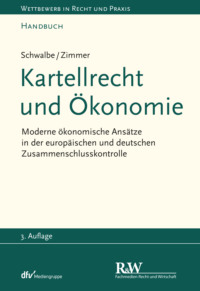Kitabı oku: «Kartellrecht und Ökonomie», sayfa 14
κ) Innovationsmärkte
Im Zusammenhang mit Fragen nach der dynamischen Effizienz eines Marktes wurde der Vorschlag gemacht, spezielle Innovationsmärkte als eigenständige relevante Märkte abzugrenzen.135 Ein solcher Innovationsmarkt bezieht sich auf einen Markt für Forschung und Entwicklung und nicht auf einen für Güter. In einem Innovationsmarkt werden alle F&E-Aktivitäten zusammengefasst, die sich auf die Entwicklung bestimmter neuer Produkte oder Verfahren beziehen, sowie enge Substitute für diese F&E-Aktivitäten. Bei letzteren handelt es sich um solche F&E-Aktivitäten, Technologien und Produkte, die die Ausübung von Marktmacht hinsichtlich der betrachteten Forschung und Entwicklung beschränken. Marktmacht bezüglich Innovationen könnte z.B. dann vorliegen, wenn nach einem Zusammenschluss nicht mehr zwei Forschungslabore, sondern nur noch eines betrieben wird. Sie würde dazu führen, dass die Rate des technischen Fortschritts verringert wird. Durch das Konzept des Innovationsmarktes könnten diese Auswirkungen auf die Innovationsanreize besser erfasst werden und es böten sich bessere Möglichkeiten, Wettbewerbsfragen hinsichtlich neu zu entwickelnder Produkte zu untersuchen, als bei den herkömmlichen Verfahren der Marktabgrenzung. Allerdings ist dieser Vorschlag aus mehreren Gründen stark kritisiert worden.136 Vor allem wird angeführt, dass die Zusammenhänge zwischen der Konzentration in einem Markt, den Ausgaben für F&E und der Rate der Innovation nur äußerst schwach sind und daher keine klaren Schlussfolgerungen über die Auswirkungen von Änderungen in den Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten auf die Innovationen gezogen werden können. Daher sollte die Verwendung von Innovationsmärkten möglichst vermieden und stattdessen eine Analyse des aktuellen und potentiellen Wettbewerbs auf den entsprechenden Produktmärkten vorgenommen werden. In den Fällen, in denen keine geeigneten Produktmärkte abgegrenzt werden können, da die Produkte erst noch entwickelt werden müssen, könnte sich das Konzept eines Innovationsmarktes zwar als sinnvoll erweisen, allerdings müssen die Anteile der Unternehmen an einem solchen Markt mit großer Vorsicht interpretiert werden. Da es bei Innovationen häufig um die Erlangung eines Patentes geht, ist zu erwarten, dass selbst bei wenigen Marktteilnehmern mit großen Marktanteilen erheblicher Wettbewerb vorliegt.137
Im Zusammenhang mit den Nichtpreiswirkungen von Fusionen, vor allem in Märkten, in denen mit neuen Produkten, mit Service, Qualität und Angebotsbreite konkurriert wurde, wurde das Konzept des Innovationsmarktes in den letzten Jahren reaktiviert und bei einigen Entscheidungen, wie z.B. Dow/Dupont sowie TomTom/Teleatlas angewandt.
λ) Marktabgrenzung bei bestehender Marktmacht – Die Cellophane fallacy
Ein weiterer wichtiger Aspekt, der bei einer Marktabgrenzung beachtet werden muss, ist die Art des wettbewerblichen Problems, das mithilfe einer indirekten Erfassung von Marktmacht analysiert werden soll. So ist z.B. im Rahmen eines Fusionsproblems zu untersuchen, ob durch den Zusammenschluss Marktmacht entsteht oder vergrößert wird. Diese Untersuchung ist also prospektiv und der Ausgangspunkt der Marktabgrenzung ist im Allgemeinen der herrschende Preis. Dabei wird die Frage gestellt, ob ein gewinnmaximierender hypothetischer Monopolist den Preis seines Produktes im Vergleich zum herrschenden Preis um einen kleinen, aber signifikanten Betrag anheben wird. Durch diesen Test wird festgestellt, welche Produkte und Gebiete beim herrschenden Preis der Marktmacht des hypothetischen Monopolisten Schranken setzen. Ein anderes Problem stellt sich jedoch, wenn geklärt werden soll, ob ein Unternehmen bereits über signifikante Marktmacht verfügt, wie z.B. bei der Frage, ob ein Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung vorliegt. In einem derartigen Fall geht es nicht darum, ob Marktmacht entsteht oder verstärkt wird, d.h. wie die künftigen Wettbewerbsbedingungen auf dem Markt aussehen werden, sondern ob Marktmacht bereits existiert, d.h. es geht um die gegenwärtigen Wettbewerbsbedingungen. Die Untersuchung ist in diesem Fällen also retrospektiv. Würde man in einer solchen Situation den hypothetischen Monopolistentest blindlings anwenden, dann bestünde die Gefahr, den relevanten Markt zu weit abzugrenzen und daher die Marktmacht eines Unternehmens zu unterschätzen.
Dieser Fehler wird in der Literatur als Cellophane fallacy bezeichnet und geht auf eine Entscheidung des US Supreme Court im Fall Du Pont zurück. Du Pont, als einziger Anbieter von Zellophan, vertrat die Meinung, dass Zellophan allein kein relevanter Markt sei, da andere flexible Verpackungsmaterialien, wie z.B. Aluminiumfolie oder Wachspapier, als enge Substitute für Zellophan zur Verfügung stünden. Der relevante Markt wurde daraufhin vom Gericht so weit abgegrenzt, dass er alle flexiblen Verpackungsmaterialien enthielt und es wurde befunden, dass Du Pont aufgrund seiner geringen Marktanteile in diesem Markt nicht über Marktmacht verfügt. Es hat sich jedoch die Ansicht durchgesetzt, dass durch diese weite Marktabgrenzung die tatsächliche Marktmacht von Du Pont in Bezug auf Zellophan nicht erfasst wurde.138 Es ist davon auszugehen, dass Du Pont, als monopolistischer Anbieter von Zellophan, den Preis für dieses Produkt bereits angehoben hat, denn jeder Monopolist wird den Preis seines Produktes immer im elastischen Bereich der Nachfragefunktion wählen. Bei einer weiteren Preiserhöhung würden die Konsumenten auf Substitute ausweichen und der Gewinn des Monopolisten würde zurückgehen, denn wenn der Monopolist den Preis noch hätte profitabel erhöhen können, dann hätte er dies wahrscheinlich bereits getan. Durch diesen überhöhten Preis hat sich der Monopolist selbst Wettbewerb durch Substitute geschaffen, denn bei einem hohen Preis kommen für die Konsumenten auch solche Substitute in Frage, die sie bei einem niedrigeren Preis nicht berücksichtigen würden: Wenn Zellophan sehr teuer ist, dann wird auch Aluminiumfolie zu einer interessanten Alternative. Die Produkte, die beim Monopolpreis Substitute sind, müssen also nicht notwendig auch als Substitute beim Wettbewerbspreis in Frage kommen.
Wenn aber zu untersuchen ist, ob Marktmacht vorliegt, d.h. ob ein Unternehmen den Preis bereits über den wettbewerbsanalogen Preis angehoben hat, dann darf der Ausgangspunkt einer Marktabgrenzung nicht der herrschende Preis sein, sondern Ausgangspunkt der Marktabgrenzung muss der Preis sein, der bei wirksamen Wettbewerb vorliegen würde.139 Hier wäre festzustellen, welche Substitutionsmöglichkeiten den Nachfragern bei diesem hypothetischen bzw. „but-for“ Preis offenstehen würden. In der Praxis erweist es sich jedoch häufig als schwierig, einen solchen „but-for“ Preis zu ermitteln.140
Es ist zu beachten, dass die Cellophane fallacy nicht, wie bisweilen unterstellt wird, nur ein Problem des hypothetischen Monopolistentests ist, sondern auch bei anderen Verfahren der Marktabgrenzung, die z.B. auf funktionelle Austauschbarkeit aus der Sicht eines verständigen Verbrauchers abstellen, dabei aber den herrschenden und nicht den wettbewerbsanalogen Preis heranziehen, auftreten kann. Durch ein ähnliches Verfahren ist es ja ursprünglich zur fehlerhaften Marktabgrenzung im Fall Du Pont gekommen. Im Allgemeinen wird der relevante Markt nicht unabhängig vom vorliegenden Wettbewerbsproblem abgegrenzt werden können. Handelt es sich um eine Frage nach der Entstehung oder Verstärkung von Marktmacht, so ist der herrschende Preis der Ausgangspunkt und alle Produkte, die bei diesem Preis Substitute sind, werden im relevanten Markt zusammengefasst.141 Im Fall der Untersuchung, ob bereits Marktmacht vorliegt, werden die Produkte im relevanten Markt zusammengefasst, die beim wettbewerbsanalogen Preis Substitute sind.
Eine methodisch richtige Anwendung des hypothetischen Monopolistentests bei bestehender Marktmacht ist gleichbedeutend mit der direkten Feststellung von Marktmacht. Denn könnte man den wettbewerbsanalogen Preis bestimmen, dann wäre Marktmacht unmittelbar nachweisbar und eine Marktabgrenzung wäre unnötig. Wenn aber nur eine indirekte Ermittlung der Marktmacht möglich ist, wovon in der Regel auszugehen ist, sollte aus ökonomischer Sicht dem grundlegenden Konzept des hypothetischen Monopolistentests weitestmöglich gefolgt werden.142 Hierzu ist die folgende Herangehensweise vorgeschlagen worden: Die vorgenommene Marktabgrenzung muss mit dem Prinzip der Nachfrage- und Angebotssubstitution vereinbar sein und die betreffenden Güter sollten zumindest beim herrschenden Preis Substitute sein, denn wenn sie das nicht sind, dann sind sie es auch nicht bei einem niedrigeren Preis. So könnte untersucht werden, ob die Nachfrager bei einer kleinen Preissenkung der in Rede stehenden Güter in signifikantem Umfang von anderen Produkten oder Gebieten zu den Gütern, deren Preis reduziert wurde, wechseln würden.143 Das Ausmaß der Nachfragesubstitution beim herrschenden Preis könnte dann als Indikator für die Nachfragesubstitution beim wettbewerbsanalogen Preis aufgefasst werden. Weiterhin könnten Kriterien herangezogen werden, wie z.B. die funktionelle Austauschbarkeit oder die physischen Eigenschaften der Güter, wobei allerdings die Auswirkungen von Unterschieden in diesen Eigenschaften auf das Substitutionsverhalten der Nachfrager, wenn möglich mittels empirischer Untersuchungen, berücksichtigt werden sollten.144 Ein wichtiges Verfahren in diesem Zusammenhang ist die Preiskonzentrationsanalyse.145 Diese Überlegungen können auch in Fusionskontrollfällen herangezogen werden, wenn davon auszugehen ist, dass die fusionierenden Unternehmen, z.B. durch eine Verhaltenskoordination, bereits über erhebliche Marktmacht verfügen.
μ) Folgerungen
Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass es sich beim hypothetischen Monopolistentest in erster Linie um einen konzeptionellen Rahmen handelt, in dem ökonomisch fundiert die Frage der Marktabgrenzung behandelt werden kann. Dabei werden die wettbewerblichen Schranken, die der Ausübung von Marktmacht durch Nachfrage- und Angebotssubstitution gesetzt sind, in das Zentrum der Analyse gerückt. Der relevante Markt wird konzeptionell so abgegrenzt, dass die Marktanteile der Unternehmen ein möglichst präzises Bild ihrer Marktmacht ergeben. Dies ist dann der Fall, wenn er alle Produkte und Gebiete, die der Ausübung von Marktmacht Grenzen setzen, enthält, und andere Produkte und Gebiete, durch die keine Beschränkungen der Marktmacht erfolgt, ausschließt. Da der hypothetische Monopolistentest quantitativ formuliert ist, wird er jedoch häufig dahingehend interpretiert, dass es sich um ein empirisches Verfahren handele. Eine derartige Interpretation verkennt jedoch den fundamentalen Unterschied zwischen dem hypothetischen Monopolistentest als Konzept und einer Implementation des Konzeptes, die auch mittels empirischer Verfahren erfolgen kann. Aber quantitative Methoden sind a priori unabhängig vom verwendeten Marktabgrenzungskonzept. Entscheidend am hypothetischen Monopolistentest ist nicht seine quantitative Formulierung oder seine Umsetzung mittels empirischer Verfahren, sondern die ökonomisch fundierte Herangehensweise an das Problem der Marktabgrenzung und der Marktmacht.146
44 Dieses Marktkonzept entspricht dem des Elementarmarktes, wie es von von Stackelberg vorgeschlagen wurde. 45 In der Literatur wurden weitere Marktbegriffe vorgeschlagen, wie z.B. die strategischen Märkte (vgl. Geroski (1998)) die dazu dienen, Märkte aus der Sicht eines Unternehmens zu interpretieren, um Marketingstrategien zu entwickeln. 46 Vgl. Chamberlin (1933), Robinson (1933), Sraffa (1926), Triffin (1940). 47Abbott (1955). 48 Vgl. Arndt (1958). Auf die damit verbundenen Probleme hat bereits Lerner aufmerksam gemacht: „It is futile to say that the motor-car and the Mediterranean cruise satisfy different wants until we are able to define “similar” wants otherwise than as wants that are satisfied by physically similar objects. There is no qualitative criterion of wants. Wants can only be considered as similar when the person who feels them displays equal concern for their satisfaction and thus shows them to be equal in quantity. To follow any other course is to sacrifice the logic of the science to the irrelevant convenience of the shopkeeper.“ Lerner (1934), 168. 49 Vgl. Arndt (1958). Neben der Zirkularität der ‚Definition‘ (ein Markt ist ein Bedarfsmarkt, wenn er einem gesellschaftlichen Bedarf gewidmet ist), bleibt auch im Unklaren, was ein eigentlich gesellschaftlicher Bedarf ist. Arndt gibt zwar einige, allerdings nicht überzeugende Beispiele, aber keine Definition des Begriffs. 50 Vgl. Bain (1958). „Moreover, the concept of markets or industry used by Bain seems to follow the classic definition of markets set forth by Marshall.“ Simons/Williams (1993), 810. 51Stigler (1982), 9. 52 „The delineation of the relevant market, where a firm may enjoy a dominant position, will serve as an example to illustrate how outdated economic concepts still survive in legal textbooks as the ‘legal’ approach. Modern industrial organisation offers new concepts that overcome the current subjective evaluations of product characteristics as a method to define the relevant market.“ Van den Bergh (1996), 76. 53 „Such functionable interchangeability does not carry as its central aim the ultimate task of identifying market power, as the products’ attributes only contain relevance inasmuch as that they influence the extent of competition in between commodities and locations. Consequently, a market definition based upon irrelevant product characteristics may lead to distorted conclusions of the firms’ market power.“ Camesasca/van den Bergh (2002), 158. 54 „Furthermore it is not necessary for products to be identical or even very similar, in order for them to be demand-side substitutes. Indeed, it is possible for products with different physical characteristics to be seen as sufficiently substitutable by customers for them to be legitimately regarded as demand-side substitutes. For this reason, defining relevant markets solely with reference to physical characteristics will often lead to markets defined too narrowly.“ Office of Fair Trading (2001), 8. 55 „Products constitute a bundle of characteristics, including price and quality. Higher priced, higher quality products often are close substitutes for lower quality, lower priced goods, the quality differences just making up for the differences in price.“ Simons/Williams (1993), 854. 56 „Thus, market delineation in the Guidelines is a tool used to construct market shares that are as meaningful as possible.“ Werden (1983), 577. 57 Vgl. Bishop/Walker (2010), 107–118; Church/Ware (2000), 602–612; Geroski/Griffith (2003); Kauper (1997); Massey (2000); Werden (1983, 1992, 1993). Zu den Ursprüngen des hypothetischen Monopolistentests vgl. Scherer (2009). 58 „We can only answer the question of whether, for instance, a 70 per cent share of a ‘market’ is likely to give a company market power if that ‘market’ is an economically meaningful market.“ Bishop (1997), 481. 59 Vgl. Bishop/Walker (2010), 111–124. Für einen detaillierten Überblick über die Abgrenzung des relevanten Marktes vgl. Baker (2007). Einen Überblick über die Verwendung des hypothetischen Monopolistentests in der Anwendungspraxis geben Coate/Fisher (2008). Zur Anwendung des hypothetischen Monopolistentest im Bereich der Regulierung vgl. Dobbs (2006). 60 Die Aussagen gelten entsprechend auch für mehrere Produkte. Vgl. Moresi/Salop/Woodbury (2008). 61 „Only if the magnitude and duration of the price increase exceed certain significance thresholds should the product and area be deemed to constitute a market.“ Werden (1983), 542. 62 Vgl. Geroski/Griffith (2003), 8. 63 Bei einer geringeren Preiserhöhung besteht auch die Gefahr, dass eine Fusion nicht als horizontaler Zusammenschluss gesehen wird, da die Unternehmen auf scheinbar verschiedenen relevanten Märkten tätig sind. Vgl. hierzu Werden (1983), 539. 64 Vgl. hierzu Baumann/Godek (1995). 65 Vgl. Werden (1993), 534–536. 66 Vgl. Werden (1993), 536f. 67 Auch kann sich die Abgrenzung des relevanten Marktes, z.B. aufgrund technischer Neuerungen (z.B. Internet), im Zeitablauf ändern. 68 Dies erweist sich besonders problematisch in einigen Bereichen der digitalen Ökonomie, in der Plattformen wie Suchmaschinen oder sozialen Medien Konsumenten Leistungen zu einem Preis von Null anbieten. In diesen Fällen kann ein SSNIP-Test in der üblichen Form nicht durchgeführt werden, denn eine Erhöhung eines Preises von Null um 10 % ergibt immer noch Null. Zu den vorgeschlagenen Alternativen zum SSNIP-Test vgl. S. 112–114. 69 Vgl. Baker (2007). 70 Die Festlegung des ersten Kandidatenmarktes kann sich, vor allem bei Mehrproduktunternehmen, in der Praxis als problematisch erweisen. Vgl. hierzu Baker (2007). 71 Auf eine in seltenen Fällen notwendige Abgrenzung des relevanten Marktes in zeitlicher Hinsicht wird nicht näher eingegangen. Die sachliche und räumliche Marktabgrenzung sollte simultan erfolgen, da ansonsten die Gefahr einer zu engen Marktabgrenzung besteht. Vgl. hierzu S. 101f. 72 Eine präzise Beschreibung dieses algorithmischen Vorgehens findet sich in Werden (2002a). 73 „It should be stressed that defining relevant markets on a basis that does not accord with the conceptual framework of the hypothetical monopolist test will, almost by definition, not take into account the main competitive constraints posed by demand-side and supply-side substitution and, in consequence, any market shares will not provide, except purely by chance, any meaningful indication of market power.“ Bishop/Walker (2010), 114. 74 Es handelt sich dabei um sowohl um Ausweichreaktionen in sachlicher als auch in räumlicher Hinsicht. Hier ist zu beachten, dass die Preiselastizität der strukturellen Nachfragefunktion, nicht aber die der Residualnachfragefunktion heranzuziehen ist, da Letztere auch die Angebotsreaktionen anderer Unternehmen enthält. Ein Ansatz, der versucht, bei der Marktabgrenzung simultan Nachfrage- und Angebotsreaktionen zu berücksichtigen, wurde von Ivaldi/Lörincz (2005) vorgeschlagen. Vgl. hierzu auch S. 99. 75 Wichtig in diesem Zusammenhang ist der Differenzierungsgrad der Güter auf dem Markt. Je größer die Substituierbarkeit, desto höher die Elastizität. Vgl. hierzu S. 72f. 76 Es wird dabei von dem Fall abgesehen, dass die Kosten des Monopolisten aufgrund der geringeren Menge so stark fallen, dass selbst bei einem starken Nachfragerückgang die Preiserhöhung lohnend ist. Vgl. hierzu S. 22–25. 77 Die Ausweichmöglichkeiten der Nachfrager werden dabei neben dem Preis durch die physischen Eigenschaften, die Qualität und andere nichtpreisbezogene Charakteristika mitbestimmt. 78 Alternativ zu Kreuzpreiselastizität kann auch die Umlenkungskennziffer (diversion ratio) zwischen zwei Produkten zur Ermittlung der engsten Substitute herangezogen werden. Vgl. hierzu S. 96–98. Die Umlenkungskennziffer hängt jedoch selbst von der Preiselastizität der Nachfrage und der entsprechenden Kreuzpreiselastizität ab. 79 Vgl. Church/Ware (2000), 605f. 80 Vgl. Werden (1998), 401. Man beachte, dass sich diese Aussage auf die kompensierte Nachfragefunktion bezieht. 81 Vgl. Church/Ware (2000), 606. 82 Vgl. Baker/Coscelli (1999); Bishop/Walker (2010), 564–570; Shapiro (1996). 83 Vgl. Scheffman (1992), 903; Simons/Williams (1993), 828; Van den Bergh (1996), 83; Werden (1998), 401f. 84 Vgl. Motta (2004), 107; Simons/Williams (1993), 828. 85 Vgl. Van den Bergh (1996), 83. 86 Vgl. Padilla (2001). 87 „The difference between a supply side substitute (i.e. a rival producer producing a metoo product to compete with the hypothetical monopolist) and an entrant is that the former is able to enter and compete with the hypothetical monopolist within a year. That is entry is in effect distinguished from intra-market rivalry by the time period in which it occurs.“ Geroski/Griffith (2003), 12. 88 Vgl. Bishop (1997), 483, Padilla (2001), 25–27. 89 Vgl. Ivaldi/Lörincz (2005). 90 Vgl. Padilla (2001), 4. 91 Vgl. Padilla (2001), 18–25. 92 Im Folgenden wird nur auf die Angebotssubstitution in Bezug auf den sachlich relevanten Markt abgestellt. In analoger Weise kann man auch hinsichtlich der Angebotssubstitution bezüglich des räumlichen relevanten Marktes argumentieren. 93 Vgl. Office of Fair Trading (2001), 10. 94 Dieses Verfahren wird in der Literatur als „share-measurement approach“ bezeichnet. Vgl. Werden (1983), 519–521; Werden (1984), 657–659. 95 Vgl. Werden (1984), 659. 96 Vgl. Padilla (2001), 26f. 97 Diese Position findet sich in den US Horizontal Merger Guidelines. Vgl. hierzu auch Baker (2007). 98 Vgl. Bishop/Walker (2010), 121. 99 Zur Frage der Interdependenz zwischen sachlicher und räumlicher Marktabgrenzung vgl. Werden (1983), 552–555. 100 Vgl. Camesasca/van den Bergh (2002), 163; Van den Bergh (1996), 84–85. 101Baker/Coscelli (1999); Baker/Wu (1998), 277; Maisel (1983), 52; Werden (1993), 524; Werden (1997), 369. Die Auswirkungen von Fusionen in Märkten mit differenzierten Produkten werden auf den Seiten 303–306 untersucht. 102 Vgl. OECD (2012), S. 29f. 103 Zum Konzept der Umlenkungskennziffer vgl. S. 96–98. 104 Vgl. Willig (1991). 105Baker/Wu (1998), 278. 106 „There is no place for submarkets within this basic analytical framework. If a firm’s market power is effectively limited by the existence of substitute products to which a significant number of customers would turn should the firm raise prices above competitive levels, then those products should be included in the relevant product market. Market shares computed in any smaller market will provide misleading inferences as to the firm’s control over prices and output.“ Maisel (1983), 50. Ähnlich auch Simon/Williams (1993), 816f; Werden (1983), 574f. 107 Vgl. Maisel (1983), 52; Glick/Cameron/Mangum (1997), 128f. 108 Vgl. Maisel (1983), 53. 109 „But it is ultimately not the best way to approach unilateral competitive effects because market definition is generally not very helpful as a first step in assessing the potential loss of localized competition. I have argued elsewhere that antitrust doctrine can be expected to this situation by giving a greater role to direct evidence of harm to competition in evaluating mergers among sellers of differentiated products.“ Baker, J. (2002), 218. Vgl. hierzu auch Farrell/Shapiro (2008b). 110Cotton/Fix (2018). 111 Vgl. Rubinfeld/Ratliff (2010). 112 Zu einer empirischen Untersuchung der Substitution zwischen Online- und Offline-Werbung vgl. Goldfarb/Tucker (2011). 113 Vgl. Frankena (2001), 375; Geroski/Griffith (2003), 9; Pitofsky (1990), 848f.; Werden (1983), 529; Werden (1984), 662. 114 Vgl. Maisel (1983), 55–57 sowie Baker (2007). Eine Abgrenzung relevanter Märkte bei Preisdiskriminierung ist jedoch in der Praxis oft schwierig. Vgl. Hausman/Leonard/Vellturo (1996). 115 Vgl. Bauer (2006); Hovenkamp (1993). 116 Vgl. Klein (1999). 117 Vgl. Bishop/Walker (2010), 150–152, 245–249; Klein (1998); Motta (2004), 111–113; Shapiro (1995); Shapiro/Teece (1994). 118 Vgl. Ayres (1985). 119 Vgl. Boadwee (1986). 120 Vgl. Ayres (1985), 111. 121 Vgl. Gual (2003), 44. 122 Vgl. Briglauer (2007), 328. 123Baker (2007). 124Filistrucchi (2008a). 125Evans/Noel (2005); Filistrucchi (2008a, 2008b). 126Evans/Noel (2008); Filistrucchi (2008a). Evans/Noel unterscheiden zwischen den kurzfristigen Wirkungen, bei denen nur die unmittelbaren Wirkungen einer Preiserhöhung betrachtet werden, und den langfristigen Effekten, bei denen auch die jeweiligen Rückwirkungen zwischen den beiden Konsumentengruppen berücksichtigt werden. Filistrucchi hingegen trifft keine Unterscheidung zwischen kurz- und langfristigen Effekten, da der hypothetische Monopolistentest von einer nicht nur vorübergehenden Preiserhöhung ausgeht. 127 Zur Problematik des SSNIP-Tests in Märkten mit einem Preis von Null für die Akteure auf einer Marktseite vgl. Mandrescu (2018). 128Newman (2016), 51ff. sowie Newman (2015), 150ff. 129 Das Konzept geht zurück auf Hartman/Teece/Mitchell/Jorde (1993). Gebicka/Heinemann (2014) haben vorgeschlagen, den SSNIP-Test mit einem SSNDQ-Test zu ergänzen. 130Matutes/Régibeau (1992). 131 Vgl. Evans (2020); Newman (2019), (2020); Prat/Valletti (2019). 132 Zum Problem der Berechnung der Marktanteile bei Unternehmen, die bestimmte Leistungen zu einem monetären Preis von Null anbieten, vgl. S. 281. 133Crémer/de Montjoye/Schweitzer (2019), 46. 134Scott-Morton/Bouvier/Ezrachi/Jullien/Katz/Kimmelman/Melamed/Morgenstern (2019), 77. 135Gilbert/Sunshine (1995a). 136 Vgl. Carlton (1995); Eiszner (1998); Hay (1995); Hoerner (1995); Rapp (1995). Zur Entgegnung auf diese Kritik vgl. Gilbert/Sunshine (1995b). Einen Überblick über die Debatte gibt Davis (2003). 137 Vgl. Bishop/Walker (2010), 148f.; Church/Ware (2000), 727–728; Office of Fair Trading (2002), 132–135. 138Stocking/Mueller (1955). 139 Vgl. Baker (2007); Bishop/Walker, (2010), 124–130; Office of Fair Trading (2001); Werden (2000). 140 Vgl. Baker (2007). 141 Dies wäre auch die richtige Vorgehensweise, wenn durch Behinderungsmissbrauch Marktmacht aufgebaut oder verstärkt werden soll. 142 „But despite those difficulties it raises, the cellophane fallacy does not imply that a new theoretical framework to defining relevant markets is required. On the contrary, the framework embodied in the SSNIP test, with its focus on competitive constraints, continues to provide the correct theoretical framework.“ Office of Fair Trading (2001), 29. 143 Zu diesem Vorschlag vgl. Baker (2007), 48 sowie Nelson/White (2003). 144Office of Fair Trading (2001), 20–30. 145 Vgl. S. 128–131. 146 „It is important to recognise that although the test is formulated in a quantitative way (i.e. it considers the profitability of a 5–10 % price rise across all products in the set), the value of the test lies in its role as a conceptual framework within which to view evidence of competition between products, rather than as a formal econometric test to be rigorously applied in all cases.“ Office of Fair Trading (2001), 10. Ähnlich auch Werden (1983), 571.