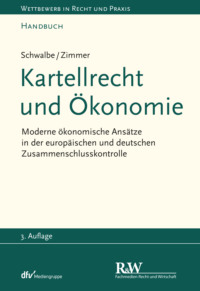Kitabı oku: «Kartellrecht und Ökonomie», sayfa 8
C. Besonderheiten der digitalen Ökonomie – Netzwerkeffekte, Plattformen, Konzentration und Wohlfahrt
Gegenüber den herkömmlichen Modellen unterschiedlicher Marktstrukturen weist die so genannte digitale Ökonomie eine Reihe von Besonderheiten auf, die es rechtfertigen, diesen Bereich mit seinen spezifischen Eigenschaften, insbesondere in Bezug auf die Fusionskontrolle, in einem eigenen Abschnitt näher zu untersuchen. Dabei ist die Bezeichnung „digitale Ökonomie“ als Oberbegriff für eine Vielzahl unterschiedlichster ökonomischer Aktivitäten zu verstehen, der alle Wirtschaftsbereiche umfasst, die von der Digitalisierung betroffen sind. Hierzu gehören so unterschiedliche Sektoren wie der Online-Handel, Suchmaschinen, soziale Medien, Musikplattformen, Hotelbuchungsplattformen, Partnerbörsen etc. In den letzten Jahren hat die digitale Ökonomie weltweit immer mehr an Bedeutung gewonnen. Sie ist gegenwärtig der Bereich mit dem stärksten Wachstum. Alle Lebensbereiche sind von der zunehmenden Digitalisierung betroffen und werden durch sie nachhaltig beeinflusst. Hierbei sind nicht nur ökonomische Aspekte von Bedeutung, sondern einige der großen Unternehmen der digitalen Ökonomie, wie z.B. Twitter, Facebook und andere soziale Medien haben wesentlichen Einfluss auf das Sozialverhalten, auf soziale Beziehungen und sogar auf politische Prozesse und Entscheidungen. Die Digitalisierung hat in vielen Bereichen zu erheblichen Verringerungen von Transaktionskosten geführt und es sind zahlreiche neue und oftmals datenbasierte Geschäftsmodelle wie z.B. der Fahrdienstvermittler Uber oder der Unterkunftsvermittler Airbnb entstanden. Diese neuen Geschäftsmodelle bringen erhebliche Umwälzungen in bestehenden Wirtschaftssektoren mit sich, da sie zum Teil direkt mit traditionellen Anbietern wie Taxiunternehmen oder Hotels konkurrieren, werfen aber auch neue Probleme auf, da sie zum Teil erhebliche externe Effekte verursachen.107
I. Indirekte und direkte Netzwerkeffekte
Dabei ist zu beobachten, dass es in der digitalen Ökonomie eine deutliche Konzentrationstendenz gibt, d.h. ein Großteil der Transaktionen wird mittels weniger großer Unternehmen getätigt. Es entstehen sogenannte „digitale Monopole“ oder die Märkte sind durch wenige große Unternehmen gekennzeichnet. Hierzu gehören z.B. soziale Medien wie Facebook in vielen westlichen Ländern oder Renren in China, aber auch Suchmaschinen wie Google oder Baidu.
Allerdings sind für das Entstehen monopolähnlicher Marktstrukturen in der digitalen Ökonomie in aller Regel andere Ursachen verantwortlich als bei den traditionellen Infrastrukturmonopolen, wie sie vor allem in netzgebundenen Sektoren auftreten. So handelt es sich bei Netzindustrien wie Stromübertragungsnetzen oder Gasfernleitungen, das Schienennetz der Eisenbahn oder Leitungsnetze in der Wasserversorgung, um „natürliche Monopole“, die aufgrund technologischer Ursachen existieren.108 Diese Branchen sind durch hohe Fixkosten für das Netz und vergleichsweise geringe variable Kosten gekennzeichnet. Diese Kostenstrukturen führen in der Regel zu sinkenden Stückkosten im relevanten Bereich der Nachfrage beziehungsweise zu einer subadditiven Kostenfunktion. Solche Kostenfunktionen sind dadurch gekennzeichnet, dass die Produktion jeder beliebigen Menge in einem einzigen Unternehmen günstiger ist als eine Aufteilung der Produktionsmenge auf mehrere Unternehmen.109 In solchen Wirtschaftszweigen ist es sinnvoll, die gesamte Produktion in nur einem Unternehmen herzustellen, denn dann sind die Stückkosten am geringsten und eine ineffiziente Verdopplung der Fixkosten wird vermieden.
Ähnliches gilt für wesentliche Einrichtungen, die dadurch gekennzeichnet sind, dass eine Doppelung bzw. Reproduktion technisch, wie z.B. bei einem Hafen, und/oder ökonomisch nicht sinnvoll ist, diese Einrichtungen aber für ein Unternehmen notwendig sind, wenn es Leistungen anbieten möchte, die die Nutzung eines solchen Netzwerks erforderlich machen.110 In beiden Fällen, bei einem natürlichen Monopol, aber auch bei einer wesentlichen Einrichtung, ist eine Regulierung notwendig, da sonst monopolistisch überhöhte Preise gefordert würden, was zu erheblichen Verlusten an allokativer und vermutlich auch produktiver und dynamischer Effizienz führen würde.
In der digitalen Ökonomie sind die Ursachen für Monopolbildungen jedoch oft andere als die technischen Bedingungen, wie sie typischerweise in den netzgebundenen Industrien vorliegen. Hier sind „große“ Unternehmen meist digitale Plattformen, die in der ökonomischen Literatur auch als Plattformmärkte bzw. zwei- oder mehrseitige Märkte bezeichnet werden.111 Derartige Plattformmärkte zeichnen sich dadurch aus, dass dort mehrere Nutzergruppen zusammengeführt werden, die unterschiedliche Interessen bzw. Präferenzen haben.112
Beispiele hierfür sind die in den letzten Jahren populär gewordenen Sharing-Plattformen, die zwischen Privatpersonen die temporäre Nutzung dauerhafter Güter und damit verbundene Dienstleistungen vermitteln. Zum Beispiel werden Wohnungen kurzzeitig an Gäste, die z.B. eine Städtereise machen, vermietet. Hier liegen positive indirekte Netzwerkeffekte zwischen den Nutzgruppen der Vermieter und der potentiellen Mieter vor, da die Plattform für potentielle Mieter umso attraktiver wird, je mehr Wohnungen dort angeboten werden, und in gleicher Weise ist die Plattform für Vermieter umso interessanter, je mehr Mieter dort nach einer Unterkunft suchen.113 Je größer also die Zahl der Nutzer auf der einen Marktseite ist, desto größer ist der Nutzen der Plattform bei den Akteuren auf der anderen Seite. Ohne solche Plattformen könnten Transaktionen normalerweise nicht durchgeführt werden, denn die damit verbundenen Kosten wären so hoch, dass bestenfalls in Ausnahmefällen zwischen den Akteuren ein Handel stattfinden würde. Anders ausgedrückt: Ohne diese Marktplätze könnten diese positiven Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Nutzergruppen nicht ausgenutzt werden.
Dabei müssen diese Netzwerkeffekte nicht in gleicher Stärke bei den verschiedenen Nutzergruppen vorhanden sein, wie das Beispiel von Suchmaschinen zeigt. Hier treffen einerseits Nutzer, die nach Informationen suchen, und andererseits Werbung treibende Unternehmen zusammen. Für werbende Unternehmen ist eine Plattform umso attraktiver, je mehr Nutzer, die nach Informationen suchen, auf der Plattform aktiv sind. Ihre Suchanfragen und ihr Klickverhalten ermöglichen es der Plattform, mithilfe datenanalytischer Methoden Informationen über Präferenzen, Interessen und Zahlungsbereitschaften der individuellen Nutzer zu ermitteln und daraus Nutzerprofile zu generieren.114 Diese präzisen Nutzerprofile sind nun wiederum für werbende Unternehmen interessant, weil sie aufgrund dieser Informationen zielgerichtete, personalisierte Werbung auf der Plattform platzieren können. Die indirekten Netzwerkeffekte, die von der Seite der Unternehmen auf die Konsumenten wirken, sind hingegen vergleichsweise schwach, da durch die Werbung der Unternehmen die Plattform für die andere Marktseite (die Konsumenten) nicht erheblich an Attraktivität gewinnt. Eine solche Plattform wird daher vor allem darum bemüht sein, dass eine möglichst große Anzahl potentieller Käufer die Plattform nutzt, um sie für Unternehmen attraktiv zu machen. Dies kann sie dadurch erreichen, dass die Suchmaschine nur einen geringen Preis, mglw. sogar nur einen monetären Preis von Null für die Nutzung der Suchfunktion verlangt. Ihre Einnahmen erzielt sie vor allem über den Verkauf von Werbefläche an die Unternehmen. Insgesamt profitieren jedoch beide Marktseiten: die Konsumenten erhalten die Information, die sie wünschen, und Werbung treibende Unternehmen erreichen die für sie relevanten Zielgruppen.115
Bei manchen Plattformen können direkte und indirekte Netzwerkeffekte auch simultan auftreten, wie das z.B. bei sozialen Netzwerken der Fall ist. Bei den beteiligten Nutzergruppen handelt es sich zum einen um die Nutzer, die soziale Kontakte pflegen möchten und zum anderen, ähnlich wie bei Suchmaschinen, um die Werbung treibenden Unternehmen. Neben den indirekten Netzwerkeffekten zwischen denjenigen, die soziale Kontakte pflegen möchten, und den Unternehmen gibt es hier direkte Netzwerkeffekte: Je größer die Anzahl von Freunden und Bekannten ist, die in einem sozialen Netzwerk aktiv sind, umso attraktiver wird es für den Einzelnen, dieses soziale Netzwerk ebenfalls zu nutzen.116
Bei Plattformmärkten mit direkten Netzwerkeffekten, aber auch auf zwei- und mehrseitigen Märkten kann also aufgrund der Netzwerkeffekte bei Erreichen einer „kritischen Masse“ an Nutzern ein Prozess einsetzen, der als „Kippen“ bzw. „Tipping“ bezeichnet wird. Wenn eine genügend große Zahl von Nutzern erst einmal auf einer Plattform aktiv ist, dann werden Nutzer anderer Plattformen zu dieser großen Plattform wechseln und auch neue Nutzer werden sich ihr anschließen. Der Wettbewerb ist also nicht durch einen Wettbewerb im Markt gekennzeichnet, bei dem mehrere Unternehmen um Kunden konkurrieren, sondern durch einen Wettbewerb um den Markt, bei dem ein Unternehmen zumindest für einen bestimmten Zeitraum diesen Markt dominiert.
Allerdings entstehen nicht bei allen solchen Plattformmärkten solche monopolistischen Strukturen. Eine Reihe von Märkten zeichnet sich dadurch aus, dass es hier eine ganze Reihe koexistierender Marktplätze gibt, die sich einen intensiven Wettbewerb liefern. Ein Beispiel hierfür sind Partnerbörsen, die sich auf verschiedene Kategorien von Nutzern spezialisiert haben. Bei diesen Geschäftsmodellen ist weniger die reine Anzahl der Nutzer entscheidend, sondern die Charakteristika derjenigen, die auf der jeweiligen Plattform aktiv sind.
II. Preisgestaltung auf Plattformmärkten
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie eine solche Plattform die Preise für die verschiedenen Nutzergruppen festlegen sollte. So ist zum Beispiel eine Auktionsplattform für Käufer nur wenig attraktiv, wenn es dort nur eine kleine Zahl von Verkäufern gibt, die dort ihre Produkte anbieten, denn dann ist es für einen potentiellen Käufer vergleichsweise unwahrscheinlich, dass er das gesuchte Objekt hier findet. In gleicher Weise ist die Plattform für potentielle Verkäufer uninteressant, wenn es nur wenige Käufer gibt, denn dann ist die Chance gering, die eigenen Produkte verkaufen zu können. Die Plattform wird daher eine Preisstruktur wählen, bei der eine möglichst große Zahl an Transaktionen stattfinden kann, denn sie verdient an jeder Transaktion. Beide Marktseiten müssen also einen Anreiz haben, die Plattform zu nutzen. Dabei kann es sich für die Plattform als optimal erweisen, auf einer Marktseite einen Preis in Höhe von null zu verlangen.117 Dies ist zum Beispiel bei Suchmaschinen der Fall, bei denen der Suchende zumindest keinen monetären Preis für eine Suchanfrage zu entrichten hat. Lediglich die Werbung treibenden Unternehmen müssen an die Plattform bei der Platzierung einer Anzeige eine Zahlung leisten. In vielen Fällen wird die Plattform eine Preisstruktur wählen, die man als zweiteiligen Tarif bezeichnet. Dieser besteht aus einer fixen Grund- bzw. Teilnahmegebühr und einem Preis pro Einheit, z.B. des Schaltens einer Werbeanzeige (pay per impression) oder wenn ein Nutzer auf eine eingeblendete Werbeanzeige klickt (pay per click). Andere Plattformen hingegen verlangen nur einen Preis pro Einheit.118
In einem zwei- oder mehrseitigen Markt führt eine Änderung der Preisstruktur dazu, dass sich die Größe aller Nutzergruppen verändert. In der Regel führt eine Erhöhung des Preises auf einer Marktseite dazu, dass ein negativer Effekt auf die andere Marktseite wirkt, da die Nachfrage der Mitglieder der ersten Gruppe zurückgeht. Aufgrund der indirekten Netzwerkeffekte wird die Plattform auch für die andere Marktseite weniger attraktiv und daher wird auch die Nachfrage dort zurückgehen. Daher sind die Preise, die von den beiden Gruppen verlangt werden, stark davon abhängig wie groß und in welche Richtung die indirekten Netzwerkeffekte wirken. Diejenige Gruppe, die einen größeren indirekten Netzwerkeffekt verursacht, zahlt in der Regel einen geringeren Preis als die Gruppe, die nur einen geringen Netzwerkeffekt ausübt. Der Grund besteht darin, dass bei einem geringen Preis, mglw. einem Preis von Null oder, in einigen Fällen auch bei einem negativen Preis, möglichst viele dieser Nutzer auf der Plattform aktiv sind und sie dadurch attraktiv für die Nutzer der „zahlenden“ Marktseite macht. Da diese Rückkopplungseffekte die Fähigkeit einer Plattform reduzieren, ihre Preise zu erhöhen, kann dies zur Folge haben, dass auf einer Seite der gewinnmaximierende Preis deutlich über den Grenzkosten auf dieser Marktseite liegt. Auf der anderen Marktseite hingegen kann der Preis unterhalb der Grenzkosten liegen und in Extremfällen sogar negativ werden.
Von juristischer Seite wurde bis vor einiger Zeit mitunter argumentiert, dass bei einem Preis von Null auf einer Marktseite kein Markt vorliege, da es sich um eine unentgeltliche Leistungsbeziehung handele.119 Bei zweiseitigen Märkten ist jedoch eine separate Betrachtung nur einer Marktseite nicht sinnvoll, denn ein solcher Plattformmarkt kann nur dann funktionieren, wenn beide Marktseiten zusammengebracht werden. Die optimale Preisstruktur kann dabei so aussehen, dass nur auf einer Seite ein positiver Preis gezahlt wird. Es ist jedoch verfehlt, nur diese eine Seite als Markt im eigentlichen Sinne aufzufassen, denn ohne die andere Seite würde auch dieser „Markt“ nicht existieren. Aus einem Preis von Null auf einer Marktseite zu schließen, es gäbe hier keinen Markt, ist aus ökonomischer Sicht nicht richtig und führt zu falschen Ergebnissen.120 Es handelt sich um einen Fall „einseitigen Denkens“ auf einem zweiseitigen Markt.121
In einem solchen Fall wäre es daher verfehlt, wenn man sich bei einer wettbewerblichen Analyse nur auf die Marktseite beschränkt, auf der ein hoher Preis verlangt wird, denn dies würde auf das Vorliegen von Marktmacht hindeuten, auch wenn eine solche Marktmacht tatsächlich nicht besteht. Daher ist die Tatsache, dass im Fall eines zweiseitigen Marktes einer Marktseite ein sehr hoher Preis abverlangt wird, nicht notwendigerweise ein Indikator dafür, dass Marktmacht vorliegt. In gleicher Weise ist auch ein Preis unterhalb der Grenzkosten kein Anzeichen für eine Kampfpreissetzung. Auch Wettbewerb zwischen Plattformen würde nicht zu einer Änderung der Preisstruktur führen.122
Weiterhin wird die Preisstruktur einer zweiseitigen Plattform auch davon bestimmt, ob die Nutzer nur auf einer Plattform aktiv sind oder auf mehreren gleichzeitig. Sind die Nutzer simultan auf verschiedenen Plattformen aktiv, zum Beispiel indem ein Unternehmen Werbung auf mehreren Plattformen schaltet, dann wird dies als Multi-Homing bezeichnet. Ein solches Multi-Homing schränkt die Möglichkeiten einer Plattform deutlich ein, die Preise über das Wettbewerbsniveau zu erhöhen.123
Wenn es keine Substitution für die angebotenen Dienstleistungen auf der Marktseite A gibt, aber intensiver Wettbewerb auf der Marktseite B herrscht, dann wird jeder Versuch, die Gewinne durch eine Preiserhöhung auf der Marktseite A zu steigern, durch den Wettbewerb auf der Marktseite B konterkariert. Dabei können die Wettbewerber einer Plattform entweder andere Plattformen sein, die ähnliche Güter oder Dienstleistungen anbieten, aber auch Unternehmen, die nur eine Marktseite bedienen. Anders ausgedrückt, die Marktmacht einer zweiseitigen Plattform wird sowohl durch die Rückkopplungseffekte zwischen den verschiedenen Nutzergruppen als auch durch den Wettbewerb mit Konkurrenten auf jeder Marktseite beschränkt. Preise oberhalb der Grenzkosten auf irgendeiner Marktseite sind daher kein verlässlicher Indikator für Marktmacht, denn beide Marktseiten müssen berücksichtigt werden.
III. Wettbewerbsökonomische Aspekte
Bei der wettbewerbsökonomischen Analyse von Märkten in der digitalen Ökonomie stellt sich daher eine Reihe von Problemen, die in herkömmlichen Märkten in aller Regel nicht auftreten. So erweist es sich in der Praxis häufig als schwierig, den relevanten Markt ökonomisch korrekt abzugrenzen. Die damit verbundenen Probleme bestehen insbesondere darin, dass bei einer Marktabgrenzung gleichzeitig zwei oder in manchen Fällen drei oder mehr Nutzergruppen bzw. Marktseiten von Bedeutung sind, zwischen denen Interdependenzen bestehen, die bei einer Analyse zu berücksichtigen sind. Eine weitere Schwierigkeit ist darin zu sehen, dass manche Nutzergruppen nicht nur auf einer Plattform aktiv sind, sondern gleichzeitig auf mehreren, d.h., ein „Multi-Homing“ betreiben. Schließlich ist zu berücksichtigen, dass bei vielen solchen Plattformen, wie z.B. bei sozialen Medien oder auch Suchmaschinen, eine Marktseite keinen positiven monetären Preis zahlt, sondern eine Gegenleistung in anderer Form erbringt, z.B. durch die Daten, die die Nutzer der Plattform zur Verfügung stellen und die von der Plattform wiederum genutzt werden, um werbetreibenden Unternehmen die Möglichkeit zu eröffnen, zielgenaue Werbung zu schalten, d.h., sicherzustellen, dass werbende Unternehmen genau die gewünschte Zielgruppe mit ihrer Werbebotschaft erreichen.
Diese Überlegungen machen deutlich, dass sich die Marktabgrenzung in der digitalen Ökonomie, die durch zwei- oder mehrseitige Plattformen gekennzeichnet ist, oft als deutlich komplexer erweist als in herkömmlichen Industrien. Daher können Marktanteile nur mit einem erheblichen Maß an Unsicherheit gemessen werden. Hinzu kommt, dass in Märkten mit zweiseitigen Plattformen und hinreichend hohen indirekten Netzwerkeffekten Marktanteile sowie Konzentrationsmaße und Veränderungen in der Konzentration für die Feststellung von Marktmacht und für die Prognose der wettbewerblichen Effekte einer Fusion nicht sehr hilfreich sind.
Ein anderer Aspekt der digitalen Ökonomie, der auch für die Fusionskontrolle von wesentlicher Bedeutung ist, betrifft die Beziehung zwischen Konzentration und Wohlfahrt in zwei- oder mehrseitigen Märkten. Wie man von Märkten mit direkten Netzwerkeffekten weiß – wie z.B. bei Telefonen, bei denen der Nutzen eines Geräts umso größer ist, je mehr Akteure ebenfalls an das Telefonnetz angeschlossen sind, weil die Kommunikationsmöglichkeiten zunehmen – hat die Größe des Netzwerks einen positiven Effekt auf die Konsumentenwohlfahrt. Daher kann eine Zunahme der Konzentration, die zu einer Preiserhöhung führt, sehr wohl mit einer Erhöhung der Konsumentenrente einhergehen, da das Produkt wertvoller wird und die Konsumenten bereit sind, einen höheren Preis dafür zu zahlen. Wenn die Zahlungsbereitschaft der Konsumenten stärker steigt als der Preis, dann nimmt die Konsumentenwohlfahrt zu.
In zwei- oder mehrseitigen Märkten ist die Lage noch komplizierter, da zwischen den Gruppen, die mittels der Plattform interagieren, indirekte Netzeffekte bestehen. So könnte ein Zusammenschluss zwischen zwei Plattformen zu einer erheblichen Änderung in der Preisstruktur führen und es könnte der Fall eintreten, dass der Preis auf einer Marktseite steigt, während er auf der anderen Seite fällt. Auch in zweiseitigen Märkten können die Netzwerkeffekte hinreichend stark sein, sodass selbst dann die Konsumentenwohlfahrt zunimmt, wenn der Gesamtpreis steigt. Theoretische Analysen von Fusionen in zweiseitigen Märkten haben gezeigt, dass Zusammenschlüsse die Wohlfahrt erhöhen können, vorausgesetzt die indirekten Netzwerkeffekte sind hinreichend stark.124 Andernfalls gilt das übliche Ergebnis einer traditionellen Fusionsanalyse und der zu Preissteigerungen führende Zusammenschluss reduziert die Wohlfahrt.
So stellt sich auch die Frage, wie Fusionen auf solchen Märkten zu bewerten sind und ob möglicherweise Ergänzungen oder Änderungen des Fusionskontrollrechts erforderlich werden, um zum einen die Übernahme potentieller Wettbewerber oder auch die Bedeutung der von den Unternehmen gesammelten Datenbestände besser berücksichtigen zu können. Gerade im Kontext der Übernahmen von kleineren Start-up-Unternehmen, die in ihrer Anfangsphase zumeist noch keine signifikanten Umsätze erzielen, sich aber binnen kurzer Zeit zu starken Konkurrenten der etablierten Plattform entwickeln könnten, können Kriterien, die sich am Transaktionswert orientieren, sinnvoller sein als umsatzbasierte Eingriffsschwellen. Wenn im Zuge eines Zusammenschlusses unterschiedliche Datenbestände zusammengeführt und rekombiniert werden, dann lassen sich daraus zusätzliche Informationen gewinnen, die in den einzelnen Datenbeständen nicht enthalten sind. Hierdurch könnten erhebliche Marktzutrittsschranken entstehen, weil potentiellen Wettbewerbern nicht die gleichen Daten zur Verfügung stehen, die sie für einen Markteintritt benötigen. Der gerade in der digitalen Ökonomie aufgrund der angesprochenen Konzentrationstendenzen entscheidende Wettbewerb um den Markt wäre dadurch erheblich geschwächt. Auch ist die Frage zu stellen, ob es sich bei diesen Datenbeständen um eine so genannte „wesentliche Einrichtung“ (essential facility) handelt, zu der gegen ein angemessenes Entgelt Zugang gewährt werden muss. Dieses Problem könnte auch den Datenschutz und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung betreffen.
Kollusives Verhalten und Kartellbildung in zwei- oder mehrseitigen Märkten können jedoch als weniger wahrscheinlich eingeschätzt werden, als dies bei herkömmlichen Märkten der Fall ist, da hier eine Koordination hinsichtlich zwei oder sogar mehrerer Marktseiten erzielt werden muss. Wenn eine Koordination nur auf einer Marktseite stattfindet, dann gibt es eine Tendenz, die Gewinne auf dieser Seite durch einen intensiveren Wettbewerb auf der anderen Marktseite „wegzukonkurrieren“. Daher wären zusätzliche Vereinbarungen und Verhaltenskontrollen zwischen den Unternehmen notwendig, um ein gewinnbringendes koordiniertes Verhalten zu ermöglichen.
Insgesamt zeigt sich, dass in der digitalen Ökonomie vor allem aufgrund der indirekten Netzwerkeffekte, der datenbasierten Geschäftsmodelle und des Preissetzungsverhaltens eine Reihe von Problemen bei der Wettbewerbsanalyse wie z.B. der Abgrenzung des relevanten Marktes, der Bestimmung der Marktanteile, der Auswirkungen eines Zusammenschlusses auf den Wettbewerb und die Wohlfahrt auftreten können. Im Folgenden werden diese Probleme in den jeweiligen Abschnitten des Buches näher untersucht.
107 Für einen Überblick über die Entwicklung der digitalen Ökonomie insbesondere im Kontext des Wettbewerbsrechts vgl. Monopolkommission (2015) und Bundeskartellamt (2015). 108 Zum Konzept des natürlichen Monopols siehe Sharkey (1983). 109 Bei Mehrproduktmonopolen ist die Definition etwas komplexer. Hier muss eine entsprechende Bedingung auch für alle denkbaren Kombinationen von Gütern erfüllt sein. 110 Es gibt einen konzeptionellen Unterschied zwischen natürlichen Monopolen und wesentlichen Einrichtungen: Natürliche Monopole sind definiert bezüglich der Kostenstruktur, d.h. die Kostenfunktion muss die Eigenschaft der Subadditivität aufweisen. Wesentliche Einrichtungen hingegen sind charakterisiert entweder durch die faktische oder die ökonomische Unmöglichkeit der technischen Reproduzierbarkeit. Zum Konzept der wesentlichen Einrichtung siehe Lipsky/Sidak (1999) oder Werden (1987). 111 Zu Monopolisierungstendenzen auf digitalen Märkten vgl. Haucap/Heimeshoff (2014). 112 Die im Folgenden beschriebenen Netzwerkeffekte können im Einzelfall auch im Zusammenwirken mit anderen Faktoren, etwa mit Kostenstrukturen der oben beschriebenen Arten (etwa subadditiven Kostenfunktionen), eine hohe Marktkonzentration begünstigen und das Entstehen von Marktergebnissen wie im Monopol erklären. Vgl. Monopolkommission (2015), Tz. 41. 113 Zu den ökonomischen Grundlagen der Sharing-Economy siehe Peitz/Schwalbe (2016). 114 Eine große Zahl von Suchanfragen ermöglicht es der Plattform auch, ihre zur Suche verwendeten Algorithmen zu verbessern, sodass die Nutzer präzisere Antworten auf ihre Anfragen erhalten. 115 Zur Ökonomik von Suchmaschinen vgl. Argenton/Prüfer (2012) sowie Haucap/Kehder (2013). 116 Zur Einführung in die Theorie der zweiseitigen Märkte siehe Rochet/Tirole (2003), (2006). 117 Zur Preissetzung in zweiseitigen Märkten vgl. Armstrong (2008), Rochet/Tirole (2003), (2006). 118 Zur Preisgestaltung bei Werbeanzeigen vgl. Ratliff/Rubinfeld (2010). 119 In diesem Sinne noch OLG Düsseldorf 9.1.2015 – VI-Kart 1/15 (V) Rdnr. 43. Vgl. aber jetzt § 18 Abs. 2a GWB: „Der Annahme eines Marktes steht nicht entgegen, dass eine Leistung unentgeltlich erbracht wird.“ Die Europäische Kommission ist schon seit längerem (auch) bei Preisen von null vom Bestehen eines Marktes ausgegangen, vgl. bspw. Komm. v. 7.10.2011 (COMP/M.6281) – Microsoft/Skype, Rdnr. 78ff. Zur Bestimmung der Marktanteile bei unentgeltlichen Leistungen unten S. 223f. 120 Zum Problem von Märkten mit Null-Preisen vgl. Newman (2014) oder Franz/Podszun (2015). 121 Vgl. Wright (2004). 122 Vgl. ibidem. 123 Zur Frage des Multi-Homing und des Wettbewerbs zwischen Plattformen vgl. Evans (2003) sowie Evans/Schmalensee (2007). 124 Siehe Evans/Noel (2008).