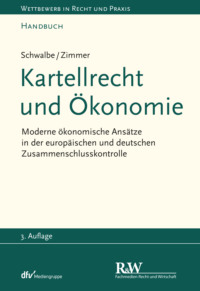Kitabı oku: «Kartellrecht und Ökonomie», sayfa 9
Zweiter Teil: Marktmacht, Marktbeherrschung und Marktabgrenzung
A. Marktmacht und Preiselastizitäten
I. Einleitung
Auf den Seiten 14–22 wurde deutlich gemacht, dass auf Märkten immer dann mit Ineffizienzen zu rechnen ist, wenn der Preis eines Gutes von den langfristigen Grenzkosten abweicht. Dies gilt vor allem hinsichtlich der Allokations-, aber auch bezüglich der Produktionseffizienz, wo, z.B. bei einem Monopol, X-Ineffizienzen auftreten können. Unternehmen, die in der Lage sind, den Preis über das Niveau zu erhöhen, das bei funktionierendem Wettbewerb herrschen würde, verfügen somit über einen mehr oder weniger großen Preissetzungsspielraum. Dieser Preissetzungsspielraum wird in der Wirtschaftstheorie als Marktmacht bezeichnet. Marktmacht ist also ökonomisch definiert als die Fähigkeit eines oder mehrerer Unternehmen, einen Preis für ein Gut durchzusetzen, der über den langfristigen Grenzkosten liegt.1 Diese Definition erfasst im Prinzip auch den Fall, dass ein Unternehmen bei gleichbleibendem Preis die Qualität (und damit die Herstellungskosten) senkt; auch hier würde der Preis für das Gut die Grenzkosten übersteigen.2 Negative Auswirkungen von Marktmacht sind in erster Linie darin zu sehen, dass aufgrund eines höheren Preises eine geringere Menge des entsprechenden Gutes angeboten wird, sodass eine ineffiziente Allokation resultiert.
1. Der Lerner-Index als Maß für Marktmacht
Folgt man dieser Definition, dann kann Marktmacht durch ein einfaches Maß erfasst werden, den so genannten Lerner-Index.3 Der Lerner-Index misst die Marktmacht eines Unternehmens anhand der prozentualen Abweichung des Preises eines Gutes i von den langfristigen Grenzkosten seiner Herstellung.4 Bezeichnet man den Preis eines Gutes i mit pi und die Grenzkosten mit ci dann ist der Lerner-Index definiert durch:

Offensichtlich ist die Marktmacht eines Unternehmens gleich Null, wenn der Preis des Gutes den Grenzkosten seiner Herstellung entspricht. Je stärker die Abweichung des Preises von den Grenzkosten, desto größer ist die Marktmacht des Unternehmens und desto größer ist die resultierende allokative Ineffizienz. Allerdings ist deutlich darauf hinzuweisen, dass es sich beim Lerner-Index um ein theoretisches Konzept handelt, das nicht ohne weiteres zur Erfassung von Marktmacht in der Praxis herangezogen werden kann. So setzt der Lerner-Index als Maß für Marktmacht voraus, dass eine langfristige Betrachtung zu Grunde liegt, d.h. dass alle Kosten variabel sind und somit keinerlei Fixkosten auftreten. In kurzfristiger Betrachtung können auch bei funktionierendem Wettbewerb die Preise über den Grenzkosten liegen, wenn die Fixkosten durch Preise in Höhe der Stück- bzw. Durchschnittskosten gedeckt werden müssen. Auf einige weitere Aspekte, die eine unmittelbare Anwendung des Lerner-Index als Maß für Marktmacht erschweren, wird auf den Seiten 82–84 hingewiesen.
Bei vollkommenem Wettbewerb, bei dem sich jedes Unternehmen als Preisnehmer verhält, wählt es sein Angebot so, dass die Grenzkosten gleich dem Preis sind. Daher verfügt ein solches Unternehmen über keine Marktmacht und die resultierende Allokation ist, wie auf den Seiten 19f. dargestellt, effizient. Beim Monopol, das nur ein Gut i herstellt, ist der Lerner-Index gegeben durch

wobei  den vom Monopolisten im Gewinnmaximum geforderten Preis bezeichnet5 und
den vom Monopolisten im Gewinnmaximum geforderten Preis bezeichnet5 und  die Preiselastizität der Nachfrage (n) nach dem Gut i angibt. Die Formel macht darüber hinaus deutlich, dass ein Monopolist sein Angebot immer im elastischen Bereich der Nachfrage wählen wird.
die Preiselastizität der Nachfrage (n) nach dem Gut i angibt. Die Formel macht darüber hinaus deutlich, dass ein Monopolist sein Angebot immer im elastischen Bereich der Nachfrage wählen wird.
2. Die Preiselastizität der Nachfrage
Die Preiselastizität der Nachfrage wird determiniert durch die Nachfragefunktion für das Gut i, in die neben dem Preis dieses Gutes auch die Preise anderer Güter j, möglicher Substitute oder Komplemente, eingehen. Form und Verlauf einer Nachfragefunktion werden durch die Präferenzen, das Einkommen und die Anzahl der Konsumenten bestimmt. Wenn sich der Preis des Produktes i erhöht, dann führt das im Allgemeinen dazu, dass die Konsumenten eine kleinere Menge des Gutes nachfragen. Die durch eine Preiserhöhung induzierte Änderung der Nachfrage nach dem Gut i kann man wie folgt beschreiben: Mit pi wird der Preis eines bestimmten Gutes i bezeichnet und mit Δpi die Veränderung dieses Preises. So könnte der Preis pi z.B. 10 Euro betragen und die Veränderung könnte 50 Cent ausmachen. In diesem Fall würde der Preis prozentual um Δpi/pi = 0,05 % bzw. 5 % steigen. Die die beim Preis pi nachgefragte Menge sei mit xi bezeichnet und mit Δxi die Änderung dieser Menge aufgrund einer Preiserhöhung um 5 %. So könnte die Nachfrage, die bei einem Preis von 10 Euro z.B. 1.000 betrug, aufgrund der Preiserhöhung um 50 Cent um 100 Einheiten auf 900 zurückgehen. Prozentual würde sich die Nachfrage daher um Δxi/xi, d.h. –100/1000, also um –0.1 bzw. –10 % ändern. Die Preiselastizität der Nachfrage  gibt nun an, um wie viel Prozent die Nachfrage nach dem Gut i aufgrund einer prozentualen Preiserhöhung für dieses Gut zurückgehen wird. Formal kann man diese Elastizität beschreiben durch:
gibt nun an, um wie viel Prozent die Nachfrage nach dem Gut i aufgrund einer prozentualen Preiserhöhung für dieses Gut zurückgehen wird. Formal kann man diese Elastizität beschreiben durch:

Im Beispiel würde die Preiselastizität der Nachfrage

betragen. Da eine Preiserhöhung im Allgemeinen zu einer Verringerung der nachgefragten Menge führt, ergeben sich negative Werte für die Elastizität. Aus Vereinfachungsgründen wird in der Wirtschaftstheorie daher zumeist der Betrag der Elastizität verwendet, d.h. der entsprechende positive Wert. Im Beispiel würde man also von einer Elastizität in Höhe von 2 sprechen. Eine Preiserhöhung von 5 % führt also zu einem Rückgang der Nachfrage um 10 %. Mit der Preiselastizität der Nachfrage werden alle Ausweichmöglichkeiten erfasst, die den Konsumenten bei einer Preiserhöhung zu Gebote stehen. Dies sind erstens das Ausweichen auf andere, substitutive Produkte, zweitens die Verringerung des Konsums des betrachteten Gutes und drittens der gänzliche Verzicht auf den Konsum des Gutes oder eines Substitutes.
Man unterscheidet zwischen 2 Bereichen, in denen eine Elastizität liegen kann: Entweder zwischen 0 und 1 oder größer als 1. Im ersten Fall spricht man von einer unelastischen Nachfrage, d.h. eine 1 %ige Preiserhöhung führt zu einer Verringerung der Nachfrage um weniger als 1 %. Ist die Elastizität größer als 1, dann impliziert eine Preiserhöhung um 1 % einen Nachfragerückgang um mehr als 1 %. Dieser Bereich einer Nachfragefunktion heißt elastisch. An dem Punkt, an dem eine Preiserhöhung um 1 % zu einer prozentual gleich großen Verringerung der Nachfrage führt, ist die Nachfragefunktion einheitselastisch. Verläuft die Nachfragefunktion sehr flach, dann führt bereits eine geringe Preiserhöhung zu einer großen Abnahme in der abgesetzten Menge, ist sie hingegen sehr steil, dann wird selbst eine große Preisänderung zu keiner erheblichen Änderung in der nachgefragten Menge führen, d.h. die Nachfrage reagiert unelastisch. Damit die Nachfrage elastisch auf eine Preisänderung reagiert, müssen jedoch nicht notwendigerweise die Hälfte oder die überwiegende Mehrheit der Konsumenten auf Substitute ausweichen oder ihre Nachfrage reduzieren; oft reicht es bereits aus, wenn nur eine relativ geringe Anzahl der Konsumenten sich so verhält. Entscheidend für die Elastizität der Nachfrage sind die marginalen Konsumenten, also diejenigen, die bei einer Preiserhöhung mit einem Ausweichverhalten reagieren.
Preiselastizitäten sind im Allgemeinen nicht konstant, d.h. die Preiselastizität der Nachfrage nach dem gleichen Produkt bei einem niedrigen Preis wird tendenziell geringer sein als bei einem hohen Preis. Ist der Preis niedrig, dann ändert eine Erhöhung des Preises um 1 % den Preis kaum merklich und die Nachfrage wird nicht sehr zurückgehen. Bei einem hohen Preis hingegen ist eine 1 %ige Preiserhöhung mit einem deutlichen Nachfragerückgang verbunden. Auch wird die Preiselastizität der Nachfrage je nach betrachtetem Zeitrahmen unterschiedlich sein. Sie hängt stark davon ab, ob man eine kurz- oder langfristige Betrachtung wählt. Dies kann man sich z.B. anhand der Erhöhung des Ölpreises verdeutlichen: Kurzfristig ist es für die meisten Konsumenten schwierig, ihren Verbrauch an Heizöl, Benzin etc. zu reduzieren, d.h. kurzfristig ist die Preiselastizität der Nachfrage gering. Langfristig jedoch werden die Konsumenten z.B. eher Kraftfahrzeuge mit geringem Verbrauch nachfragen oder auf alternative Energiequellen ausweichen (Erdgas, Solarenergie etc.), sodass die langfristige Preiselastizität in aller Regel signifikant höher ist als die kurzfristige.
Ist die Preiselastizität der Nachfrage kleiner als 1, d.h. reagiert die Nachfrage unelastisch, dann bedeutet dies, dass der Erlös bzw. der Umsatz des Unternehmens bei einer 1 %igen Preiserhöhung steigt. Bei einer elastischen Nachfrage würde bei einer Preiserhöhung der Umsatz zurückgehen. A priori lässt das Konzept der Preiselastizität nur eine Aussage über die Änderung des Umsatzes zu, nicht jedoch über Änderungen des Gewinns. Allerdings kann man anhand der folgenden Überlegung auch einen Zusammenhang zwischen der Preiselastizität der Nachfrage und dem Gewinn herstellen: Da ein Unternehmen, das für sein Produkt einen höheren Preis verlangt, im Allgemeinen nur noch eine geringere Menge absetzen kann, muss es also auch nur eine geringere Menge herstellen. Dadurch werden im Regelfall die Produktionskosten sinken. Also wird bei einer unelastischen Nachfrage eine Preiserhöhung zu einer Umsatzsteigerung und, aufgrund der geringeren Menge, zu einer Kostensenkung führen und die Gewinne werden zunehmen.6 Dies hat jedoch zur Folge, dass ein Unternehmen, das sich einer unelastischen Nachfrage gegenübersieht, den Preis seines Produktes solange weiter erhöhen wird, bis es schließlich in den elastischen Bereich der Nachfragefunktion gelangt. Daraus folgt unmittelbar, dass ein Monopol den Preis seines Produktes immer im elastischen Bereich der Nachfragefunktion wählen wird.7
Beträgt also z.B. die Preiselastizität der Nachfrage beim Monopolpreis 2, dann fordert der Monopolist einen Aufschlag auf die Grenzkosten in Höhe von 50 %. Der Lerner-Index macht deutlich, dass bei einer sehr elastischen Nachfrage selbst ein Monopolist mit einem Marktanteil von 100 % über keine signifikante Marktmacht verfügt, da er bei einer Preiserhöhung einen großen Teil der Nachfrage verlieren würde. Im Grenzfall, d.h. bei einer unendlich elastischen Nachfrage verschwindet die Marktmacht völlig.8 Marktanteile sind also nicht notwendig ein Beweis für die Existenz von Marktmacht. Signifikante Marktmacht liegt daher meist dann vor, wenn die Nachfrage eine geringe Preiselastizität aufweist.
II. Marktmacht und Lerner-Index bei verschiedenen Marktformen
Die Marktmacht eines Cournot-Oligopolisten kann ebenfalls mithilfe des Lerner-Index erfasst werden. Dabei wird der Preis im Cournot-Nash-Gleichgewicht mit pc bezeichnet. Hier ist die prozentuale Abweichung des Marktpreises pc von den Grenzkosten gegeben durch

wobei si den Marktanteil des Oligopolisten i und ηn die Preiselastizität der Nachfrage bezeichnet. Diese Formel entspricht im Prinzip der im Falle eines reinen Monopols, nur geht hier der Marktanteil jedes Oligopolisten si in den Index mit ein. Die Marktmacht eines Cournot-Oligopolisten ist also bestimmt durch die Preiselastizität der Nachfrage, gewichtet mit seinem Marktanteil. Dies macht deutlich, dass die Konzentration in einem Markt eine wichtige Determinante für die Marktmacht ist. Je größer die Marktanteile der Unternehmen, desto stärker ist die Abweichung des Preises von den Grenzkosten, d.h. desto größer ist also die Marktmacht. Auch Kostenunterschiede zwischen den Unternehmen beeinflussen den Lerner-Index. Ein Unternehmen mit geringeren Grenzkosten kann einen höheren Preisaufschlag realisieren und verfügt auch über einen größeren Marktanteil. Könnten die Oligopolisten ihr Verhalten koordinieren und sich gemeinsam wie ein Monopolist verhalten, dann bleibt die Formel weiterhin gültig, aber es muss der Monopolpreis verwendet werden und die Marktanteile sind auf die geringere Monopolmenge zu beziehen.9 Allerdings ist bei der Interpretation des Lerner-Index zu berücksichtigen, dass in einem Markt mit oligopolistischem Wettbewerb nicht das gleiche Ergebnis erwartet werden kann, wie in einem Markt mit vollkommenem Wettbewerb. Auch bei funktionierendem Wettbewerb in einem solchen Markt wird sich das Marktergebnis, aufgrund der Tatsache, dass sich die Unternehmen der strategischen Interdependenz bewusst sind, von dem bei vollkommenem Wettbewerb unterscheiden.
Bei allgemeinen Marktstrukturen muss, anders als beim reinen Monopol oder beim Cournot-Oligopol, zwischen der Marktnachfrage und der Nachfrage, der sich ein einzelnes Unternehmen gegenübersieht unterschieden werden. So kann z.B. die gesamte Marktnachfrage sehr preisunelastisch sein, die Nachfrage für das Produkt eines einzelnen Unternehmens, d.h. die Residualnachfrage, jedoch sehr elastisch reagieren. So wird die Gesamtnachfrage nach einem lebenswichtigen Medikament, das mit den gleichen Wirkstoffen von mehreren Unternehmen angeboten wird, kaum auf Preisänderungen reagieren. Wenn jedoch nur ein Unternehmen den Preis erhöht, um einen höheren Gewinn zu erzielen, dann werden viele Käufer ihren Bedarf bei den anderen Unternehmen decken, d.h. die Residualnachfrage eines einzelnen Unternehmen ist äußerst preiselastisch, sodass trotz unelastischer Marktnachfrage die Marktmacht eines Unternehmens sehr gering ist. Entscheidend für das Vorliegen von Marktmacht eines einzelnen Unternehmens ist also immer die Preiselastizität seiner Residualnachfrage.10
Gibt es neben dem Monopol oder dem Oligopol noch andere Wettbewerber, z.B. einen wettbewerblichen Rand, oder können andere Unternehmen in den Markt eintreten, dann ist das Verhalten dieser aktuellen oder potentiellen Wettbewerber bei der Erfassung von Marktmacht zu berücksichtigen. Analog zur Feststellung des Verhaltens der Konsumenten mithilfe der Preiselastizität der Nachfrage kann man das Angebotsverhalten aktueller oder potentieller Wettbewerber mithilfe der Preiselastizität des Angebots erfassen.11 Diese Elastizität hängt von einer Reihe von Faktoren ab: So spielen die Kapazitäten der aktuellen Wettbewerber eine wichtige Rolle. Eine Ausweitung des Angebots dieser Unternehmen kann nur erfolgen, wenn hinreichend große, bisher ungenutzte Produktionskapazitäten vorhanden sind oder sehr schnell aufgebaut werden können. Andernfalls könnten diese Unternehmen selbst bei einer drastischen Preiserhöhung ihr Angebot nicht erhöhen – die Preiselastizität des Angebotes wäre Null oder zumindest sehr gering. Ein anderer wichtiger Aspekt sind mögliche Marktzutrittsschranken. Wenn z.B. aufgrund absoluter Marktzutrittsschranken, etwa wegen eines Patents, andere Unternehmen nicht in diesen Markt eintreten können, dann hat dies eine geringe Preiselastizität des Angebots zur Folge. Auch der betrachtete Zeitraum ist wichtig: Kurzfristig kann das Angebot nur wenig ausgedehnt werden, da Umstellungen der Produktion Zeit erfordern und Marktzutritte meist erst nach einer gewissen Vorbereitungszeit erfolgen können. Langfristig hingegen ist eine deutlichere Reaktion des Angebots zu erwarten. Der Lerner-Index für die Marktmacht eines Unternehmens bei Berücksichtigung anderer Wettbewerber bzw. von Marktzutritten kann wie folgt angegeben werden:

wobei  die Preiselastizität des Angebots bezeichnet. Diese Preiselastizität wird mit den Marktanteilen aller Unternehmen außer dem betrachteten gewichtet.12 Dies ist analog zum Oligopol, wobei der Ausdruck
die Preiselastizität des Angebots bezeichnet. Diese Preiselastizität wird mit den Marktanteilen aller Unternehmen außer dem betrachteten gewichtet.12 Dies ist analog zum Oligopol, wobei der Ausdruck  die Preiselastizität der Residualnachfrage angibt. Dieser Index macht deutlich, dass die Marktmacht eines Unternehmens umso geringer ist, je größer die Preiselastizitäten der Nachfrage und des Angebotes sind. Der Marktmacht eines Unternehmens werden also von zwei Seiten Schranken gesetzt: Zum einen durch die Ausweichreaktionen der Nachfrager, zum anderen durch die Angebotsreaktionen aktueller oder potentieller Wettbewerber. So kann die Marktmacht eines Unternehmens selbst bei einer sehr unelastischen Nachfrage gegen Null gehen, wenn das Angebot sehr preiselastisch reagiert. Die Marktmacht eines Unternehmens wird umso höher sein, je geringer die Ausweichmöglichkeiten der Nachfrager sind und je unelastischer das Angebot ist.
die Preiselastizität der Residualnachfrage angibt. Dieser Index macht deutlich, dass die Marktmacht eines Unternehmens umso geringer ist, je größer die Preiselastizitäten der Nachfrage und des Angebotes sind. Der Marktmacht eines Unternehmens werden also von zwei Seiten Schranken gesetzt: Zum einen durch die Ausweichreaktionen der Nachfrager, zum anderen durch die Angebotsreaktionen aktueller oder potentieller Wettbewerber. So kann die Marktmacht eines Unternehmens selbst bei einer sehr unelastischen Nachfrage gegen Null gehen, wenn das Angebot sehr preiselastisch reagiert. Die Marktmacht eines Unternehmens wird umso höher sein, je geringer die Ausweichmöglichkeiten der Nachfrager sind und je unelastischer das Angebot ist.
III. Marktmacht bei differenzierten Gütern
Diese Überlegungen können auf den Fall differenzierter Güter übertragen werden, wobei die gleiche Formel wie oben heranzuziehen wäre. Die Frage, welche Güter dabei zu berücksichtigen sind, ist dabei von untergeordneter Bedeutung, da die Preiselastizität der Nachfrage und der Marktanteil sich in gleicher Richtung verändern:13 Würde man nur wenige, sehr enge Substitute bei der Berechnung des Marktanteils berücksichtigen, dann wäre der Marktanteil des betrachteten Unternehmens einerseits recht hoch, andererseits würde auch die Nachfrage sehr preiselastisch reagieren, da die Abnehmer über zahlreiche Ausweichmöglichkeiten verfügen. Zwar impliziert ein hoher Marktanteil eine große Marktmacht, aber eine große Preiselastizität eine nur geringe Marktmacht. Würde man hingegen den Marktanteil mit Bezug auf enge und weite Substitute ermitteln, dann wäre zwar der Marktanteil des Unternehmens gering, die Preiselastizität der Nachfrage aber ebenfalls, da es kaum noch unberücksichtigte Ausweichmöglichkeiten für die Konsumenten gibt. Ein ähnlicher Zusammenhang gilt auch für die Preiselastizität des Angebotes. Diese ist bei Berücksichtigung nur der engsten Substitute relativ groß, während im Falle der Berechnung des Marktanteils unter Einbeziehung auch weiter Substitute diese Elastizität eher gering sein wird.
IV. Marktmacht auf zweiseitigen Märkten
Wie bereits auf den Seiten 54–63 über Besonderheiten der digitalen Ökonomie dargelegt wurde, handelt es sich bei vielen Unternehmen um zwei- oder mehrseitige Plattformen. Allerdings treten solche zweiseitigen Märkte nicht nur in der digitalen Ökonomie auf, sondern auch in vielen herkömmlichen Wirtschaftssektoren. So kann z.B. der Markt für Zahlungssysteme wie z.B. Kreditkarten als zweiseitiger Markt interpretiert werden, auf dem die beiden Gruppen der Händler einerseits und der Kreditkarteninhaber andererseits zusammengebracht werden. Andere Beispiele sind werbefinanzierte Medien, wobei die eine Nachfragergruppe die Werbung treibenden Unternehmen sind und die andere die Leser (bei Zeitschriften) oder Zuschauer (beim werbefinanzierten Fernsehen). Weitere Beispiele für zweiseitige Märkte sind Reisevermittler, die die Anbieter von Reisen und die Nachfrager zusammenbringen, Messen, Heiratsvermittlungen sowie so genannte Dating-Clubs, in denen Männer und Frauen Kontakte knüpfen können.
Auch hier treten zwischen den verschiedenen Nutzergruppen indirekte Netzwerkeffekte auf, deren jeweilige Stärke erhebliche Auswirkungen auf das Preissetzungsverhalten haben kann, wie das z.B. bei kostenlos verteilten Zeitungen der Fall ist, die ihre Einnahmen ausschließlich über den Verkauf von Werbefläche generieren. Ein solches Preissetzungsverhalten kann daher in zweiseitigen Märkten zu einer Reihe von Phänomenen führen, die bei normalen, einseitigen Märkten als Indiz für Marktmacht interpretiert werden müssen. So wird z.B. häufig beobachtet, dass einer Nachfragergruppe ein Preis abverlangt wird, der deutlich oberhalb der Grenzkosten liegt, die für die Bereitstellung der Dienstleistung oder des Produktes für die Mitglieder dieser Gruppe anfallen, während die Mitglieder der anderen Gruppe einen Preis zahlen, der unterhalb der entsprechenden Grenzkosten liegt und sogar negativ sein kann. So erhalten z.B. in vielen Dating-Klubs Damen freien Eintritt und oftmals ein Freigetränk, während Herren einen Eintrittspreis zahlen, der deutlich über den Grenzkosten liegt, die ihnen zuzurechnen sind. Die Höhe des jeweils zu entrichtenden Preises hängt dabei von der Stärke des indirekten Netzeffektes ab: Diejenige Gruppe, die die größeren indirekten Netzeffekte verursacht, wird in der Regel einen niedrigeren Preis zahlen, bzw. diejenige mit der geringeren Netzwerkexternalität einen höheren.14
Ein weiterer Faktor, der einen Einfluss auf die Preisbildung auf zweiseitigen Märkten hat, ist die Zahl der von den Nachfragern genutzten Plattformen. In manchen Fällen nutzen die Nachfrager nur eine Plattform, d.h. sie betreiben ein so genanntes Single-Homing, in anderen sind sie auf mehreren Plattformen aktiv, d.h. man beobachtet ein Multi-Homing. In der Regel wird man beobachten, dass zumindest eine Marktseite ein Multi-Homing betreibt. So lesen die meisten Konsumenten nur eine Zeitung, während Werbung treibende Unternehmen gleichzeitig in mehreren Zeitungen inserieren. Die meisten Händler akzeptieren mehrere Kreditkarten, aber viele Kunden besitzen nur eine. Auf zweiseitigen Märkten ist daher ein hoher Preis für eine Nachfragergruppe noch kein ausreichendes Indiz für das Vorhandensein von Marktmacht, denn selbst bei Wettbewerb mehrerer Plattformen würde sich an der Art der Preisstruktur nichts ändern. Würde man daher bei zweiseitigen Märkten nur eine Nachfragergruppe betrachten, dann gelangte man in der Regel zu einer falschen Schlussfolgerung.15 Entscheidend ist der Gesamtpreis, d.h. das was insgesamt von beiden Gruppen gezahlt wird, und die gesamten Grenzkosten, die der Plattform bei der Erstellung der Leistung entstehen.