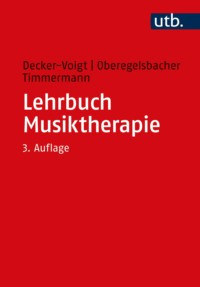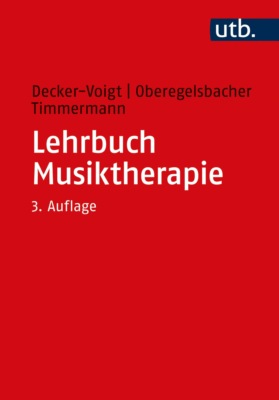Kitabı oku: «Lehrbuch Musiktherapie», sayfa 5
5Das Instrumentarium:Streicheln und Ermorden – Musikinstrumente: ihr Appell, ihre Symbolik
von Hans-Helmut Decker-Voigt
„Wer dauernd auf die Pauke haut, geht eines Tages flöten“ (Trenkle 2004)
Längst bevor ein Patient ein Instrument spielt, spielt es in ihm. Und es spielt gleich mehrere Rollen. Die Entscheidung, nach einem ersten Umschauen im Musiktherapieraum ein erstes Umhören folgen zu lassen – meist ausgelöst durch die Einladung des Musiktherapeuten, zu explorieren, auszuprobieren, was einen vielleicht neugierig macht … und dieses Umhören in die Entscheidung für ein Instrument münden zu lassen oder gar keines zu nehmen, ist gänzlich unzufällig.
Wirkungsfunktionen
Der Mensch steht dem Musikinstrument und dessen folgenden Wirkungsfunktionen gegenüber:
●Es wirkt auf ihn durch das Profil des Instrumentenkörpers, seine Form: vertraut, neu, fremd, befremdend, anziehend.
●Es wirkt durch die Noch-nicht-Hörbarkeit, die sich schon nähert: vertraut, neu, befremdend, anziehend.
●Es wirkt durch das Material, aus dem es ist: glatt, rissig, künstlich, natürlich.
●Es wirkt durch die Einladung zum Spiel (den Bogen über Saiten eines Streichinstruments zu streichen, die Tasten eines Klaviers oder Akkordeons zu drücken, eine Rassel zu schütteln).
Die Anziehung des Menschen hin zu einem Instrument oder seine Abwehr dagegen (in der Therapie sprechen wir dann von Widerstand) liegt großenteils in der Assoziation (lat. = Hinzugesellung) innerer Bilder, Erinnerungen, Bedürfnisse, die beim Annähern oder auch nur Betrachten eines Musikinstruments ausgelöst werden.
assoziativer
Gehalt
Mary Priestley sah in ihrer noch traditionelleren tiefenpsychologischen Sicht Musikinstrumente als Auslöser für Bedürfnisse im Menschen, die den Entwicklungsphasen früher Sexualität folgten. Sie verband Schlaginstrumente mit der analen Phase, Blasinstrumente mit der oralen und Streichinstrumente mit der genitalen (Priestley 1983). Diese Psycho-Logik, die bei zu einseitig vereinfachenden Psychoanalyse-„Freaks“ zu Kausalitäten führte – Schlägelspiel = Phallusspiel oder Streichinstrumentenspiel = Streichelspiel –, wurde durch die „Appellspektrumsanalyse“ ausgeweitet. Sie baute auf der Theorie der Kreativtherapie von Maks Kliphuis auf. Diese ging von einer in jedem Individuum angelegten „Bedürfnishierarchie“ aus, die von den das Individuum umgebenden Materialien mit ihren unterschiedlichen „Appellen“ an eben diese Bedürfnishierarchie rührt und diesen anzieht, abstößt, immer aber „appelliert“ (Kliphuis 1973). Kliphuis unterscheidet bei den materialen Appellen folgende Bedürfnisreaktionen:
Instrumenten-symbolik der
Tiefenpsychologie
Appellwert und
Bedürfnishierarchie
1.sensopathisch-libidinöse Bedürfnisse (taktil-haptische Kontaktwünsche),
2.dimensionale Bedürfnisse (Gestaltung von Raum, Form und Zeit, also Allmacht, Endlosigkeit oder sich durch das Material abgrenzen, schützen)
3.thematisch-inhaltliche Bedürfnisse (symbolische Besetztheit des Materials in seiner Form, Farbe, Größe, Struktur).
Wil Waardenburg bezog in dem Kontext von Kliphuis erstmals die Appellspektrumsanalyse auf die Spielweise, den Klang, die vielschichtigen Symbolwertigkeiten von Musikinstrumenten (1973). In der phänomenologisch orientierten Musiktherapie wird mit der Appellspektrumsanalyse bis heute in immer weiter modifizierteren Formen gearbeitet.

Eine Fallvignette (nach Ulrike Höhmann 1996): Eine Diabetes-Patientin, die ihr Kind durch eine Fehlgeburt verloren hatte, ging während des ersten Therapie-Settings spontan auf die große Pauke zu, nahm auch die Schlägel zur Hand – war aber nicht imstande, zu spielen. Im Nachbearbeitungsgespräch wurde deutlich, dass die Pauke an sie „appellierte“ – durch die Assoziation an die Form ihres Bauchs während der Schwangerschaft. Hingegen die mögliche, vermutete Lautstärke der Pauke appellierte, erinnerte die bis dahin verdrängte Wut über den Tod ihres Kindes. Die Intensität und Dimension der Verdrängung wurde schließlich deutlich durch die Unfähigkeit, das Spiel aufzunehmen.
subjektive
Bedeutung
Höhmann führt Waardenburgs Ansatz weiter und sieht in der ersten Phase einer Musiktherapie, der Erforschung des vorhandenen Instrumentariums durch den Patienten (die Exploration) bereits den Beginn einer „Überwindung der Problemfixierung“, ein weiteres Beispiel für die Symbolträchtigkeit der Spiel- und Umgehensweise mit dem Instrument. Beispielhaft am Instrumentenkörper des Balafons (afrikanisches Xylophon) nähert sich Höhmann dem Musikinstrument in Analogie zum menschlichen Körper tiefenpsychologisch-phänomenologisch an und differenziert das Instrument.
Anthropomorphismus – Beispiel Balafon
●Die selbstklingenden Materialien (Idiophone) i. S. von Tonquelle, der klanggebende Teil, das männliche Element (beim Beispiel Xylophon/Balafon die Klangstäbe).
●Die Resonanzkörper, der Bauch, die klangempfangende Form, der mitschwingende Teil, das offene, weibliche Element (beim Beispiel Balafon die 1–2 Resonanzkörper unter dem Klangstab, die im Zusammenwirken mit dem klanggebenden Element der Idiophone zur „Befruchtung“ führen, dem schwingenden Ton). Durch die im Resonanzkörper in Bewegung gesetzte Luft schwingen auch die Membranen mit, die als feine Häutchen über die in die Resonanzkörper gebohrten Löcher gespannt sind. Neben dem Ton des Holzstabklangs entsteht so eine zweite Klangebene. „Das Instrument atmet.“
●Der Aufbau, das Skelett, das ordnende haltgebende Element eines Instruments.
●Die Skulptur eines Instruments (seine möglichen Verzierungen, seine Seele, das von ihm versinnbildlichte Element) (nach Höhmann 1994).

Abb.: Die Musiktherapeutin Ulrike Höhmann am Balafon
Psychoanalytisch übersetzt lösen Musikinstrumente Annäherungs-, Einverleibungswünsche und damit symbiotische Bedürfnisse aus oder aber Abwehr bzw. Widerstand. Die dahinter stehende Diskussion um die Symbolik von Musikinstrumenten und ihrer Klangsprache ist mit der Arbeit der Psychoanalytikerin Susanne Langer weiterstrukturiert worden. Langer (1984) zeigt die elementar unterschiedlichen Formen der Symbolorganisation des Menschen auf und differenziert in „diskursive Symbolik“ des sprachlichen Ausdrucks des Menschen. Die Form dieses Ausdrucks beschreibt äußere Realitäten, und zwar immer und ausschließlich im zeitlichen Nacheinander. Anders Musik als Ergebnis gespielter Instrumente und gesungener Stimme.
Die phänomenologische Musiktherapie, mit ihrer Voraussetzung besonderer Symbolkraft der Musik und der Klangwerkzeuge, die diese erzeugt, arbeitet seit Langer mit dem Begriff der „Präsentativen Symbolebene der Musik“. Musik ist keine Sprache wie die verbale Sprache, sondern repräsentiert seelische Gegebenheiten in der jeweiligen Situation der Begegnung mit ihr – und zwar zeitgleich, synchron. Langer nutzt zur Unterscheidung der beiden Symbolrepräsentanzen das Bild vom betrachteten Bild von Kleidungsstücken, die auf einer Wäscheleine aufgehängt sind, und zwar ebenso nach- und nebeneinander, wie Menschen sich ihre Ideen sprachlich mitteilen – dabei werden sie übereinandergetragen. Oder das Kunstbild des Malers, das sich auch aus verschiedenen Elementen zusammensetzt, die das Motiv als Ganzes zeigen – aber es wirkt synchron, auf einmal und in diesem Moment (Langer 1984).
Alfred Lorenzer sieht in seiner Fortsetzung der Arbeit Langers alle nicht in Sprache fassbaren präsentativen Symbolebenen (wie auch Musikgestaltung, Tanz, Malen) als sinnlich-symbolische Kommunikation, die nicht weniger wichtig ist als die diskursive Symbolik der Sprache (Lorenzer 1970a/b).
sinnlich-symbolische
Kommunikation
Was nun in die „Appellwirkung“ des Musikinstruments und der gesungenen, vokal spielenden Stimme buchstäblich mit hineinspielt, ist die Funktion der Instrumente, an die protosymbolische Zeit der vorsprachlichen Kommunikation anzuschließen. Die psychoanalytische Sicht: In dieser präverbalen Zeit (ca. bis Ende des 2. Lebensjahres) sieht Lorenzer die elementaren Vorformen der Musik (call-response-dialogues) als Einigungsvorgänge in der frühen Mutter-Kind-Dyade, eben die, in der sich Protosymbole bilden. Während des Spracherwerbs wird ein Teil dieser Protosymbolismen übernommen in das Repertoire des Menschen zu sinnlich-symbolischer Kommunikation in einer präsentativen Symbolsprache (Musik, Tanz, Kunst). Ein anderer Teil wird in das Unbewusste geschoben. Insgesamt sieht die phänomenologische Musiktherapie Musik in diesem Sinne als präsentative Symbolsprache in der sinnlich-symbolischen Kommunikation – zusammen mit Tanz, Bewegung, Malerei.
Protosymbolik
„Präsentative Symbole artikulieren Situationen, sie formulieren Erlebnisse, die nicht oder noch nicht beim Namen genannt werden können bzw. dürfen.“ (Mahns 2004, 88)
Was Musikinstrumenten dabei als Werkzeuge für die sinnlich-symbolische Kommunikation zu therapeutischer Prominenz in der Psychodynamik des Patienten verhilft, ist die Erfahrung des Menschen: Musikalisch werden wir uns (im Gegensatz zur diskursiven Symbolik der Sprache) zeitgleich ausdrücken können, aufeinander einstimmen, abstimmen, Affektabstimmung erleben können und zur Interaktivität als zeitgleiches Erleben ein und derselben Gefühlsspitze gelangen. Natürlich ereignet sich Musik als Produkt ihrer Instrumente auch in der Zeit und mit der Zeit, wie die Sprache. Aber sie erlaubt spontanen, synchronen emotionalen Austausch.
Gleichzeitigkeit
Zu einzelnen Instrumentengruppen
Instrumenten-ausstattung
Zur idealen Instrumentenbestückung eines Musiktherapieraumes empfahl eine der Urgroßmütter der Musiktherapie, Mary Priestley, bereits, was sich überall zugunsten der beim Anblick (Appell) der Instrumente potenziellen Ausdruckschancen des Patienten bewährte: Von jeder Instrumentengattung möglichst zwei Instrumente (für PatientIn und TherapeutIn), also:
●Stabspielinstrumente,
●Fellinstrumente,
●Perkussion,
●Saiten-,
●Blas- und
●Tasteninstrumente.
Während der letzten 35 Jahre vollzog sich aufgrund des Appells an vermutete, erinnerte Leistungsanforderungen in Kindergarten und Schule eine langsame Ablösung traditioneller Konzertinstrumente unseres Kulturkreises (einschl. Orff-Instrumenten).
„Über die Begegnung mit den außereuropäischen entwickelte sich das Interesse an so genannten ‚archaischen’ Musikinstrumenten. So wurde das Monochord vom Demonstrationsobjekt für die pythagoräischen Obertöne zum wohlklingenden Musikinstrument meist mit mehreren gleichgestimmten Saiten entwickelt. Der Einsatz in der rezeptiven Musiktherapie wie auch in der musiktherapeutischen Improvisation ist weit verbreitet.“ (Bruhn 2005)
archaisches
Monochord
In derselben Arbeit verweist Bruhn auch auf Instrumente, die speziell für die Musiktherapiepraxis entwickelt wurden. Zunehmend sind dies Varianten des Monochords als Klangstühle und -liegen, Tischtrommeln für Gruppen, Gongs, Geräuschinstrumente wie Rainmaker und andere zahlreiche Varianten der „archaischen“ Instrumente als appellfähig ohne Leistungsanforderung, dafür mit starker präsentativer Symbolkraft.
Neuerfindungen
Musikethnologisch enger gebundene Instrumente, wie z. B. Didgeridoo, Djembe u. v. a., haben das klassische Orff-Instrumentarium zurückgedrängt. Dieses hatte aufgrund der Nähe der frühen Musiktherapie zur Musikpädagogik und Musik in der Heil- und Sonderpädagogik im deutschsprachigen Bereich der 50er Jahre des 20. Jh. noch Vorrang.
Ethno vs. Orff
Sonderstellung
Klavier
Das Klavier nimmt in der Diskussion und Praxis der Musiktherapie eine Sonderrolle ein. Sein breites Appellspektrum („Lehrerinstrument“, Instrument der Grandiosität und Virtuosität, Entmutigungsinstrument usw.) wird sowohl als ein Instrument unter vielen, als primus inter pares, in den meisten Gruppenmusiktherapien eingesetzt, aber auch in Einzelmusiktherapien für dialogische Improvisationen angeboten (z. B.: vierhändige Improvisation mit geschlossenen Augen auf vorgegebenen schwarzen Tasten = pentatonischen Leitern = harmonische Vertrautheit oder freie Improvisation im ganzen Tonraum als symbolisches Handeln für „Wege suchen im Dunkel des Nichtberechenbaren“ = Krankheit). In der Nordoff-Robbins-Musiktherapie ist das Klavier als Instrument des Therapeuten von zentraler Bedeutung für die künstlerisch-musikalische Begleitungsmöglichkeit des Patientenausdrucks.
elektronische
Instrumente
In speziellen Musiktherapie-Praxisfeldern finden sich elektronische Musikinstrumente (Keyboard, Synthesizer) und Equipment: therapeutische Arbeit in der Altersspanne zwischen jüngeren Jugendlichen und Adoleszenten; in der Arbeit mit Patienten der Neurologischen Rehabilitation; in Spezialpflegeeinrichtungen hirnverletzter Patienten, deren minimierter Ausdrucksbereich dadurch verstärkt und hör- und nutzbar wird für Inter-aktionsbahnungen, die nur so zu manchmal wieder möglichen Begegnungserfahrungen interaffektiver Intensität führen.

Bruhn, H. (2005): Musik und Therapie. In: Oerter, R., Stoffer, Th. H. (Hrsg.): Spezielle Musikpsychologie. Hogrefe, Göttingen.
Decker-Voigt, H.-H., Brust., K. v. (2016): Die Instrumente der Musik und die Basale Stimulation. In: „… das berührt mich tief“…, Musiktherapie und Basale Stimulation/Basale Bildung. Reichert, Wiesbaden, 47 ff.
Dosch, J., Timmermann, T. (2005): Das Buch vom Monochord. Zeitpunkt Musik. Reichert, Wiesbaden
Höhmann, U. (2009): Appelle und Appellwirkung von Musikinstrumenten. In: Decker-Voigt, H.-H., Weymann, E. (Hrsg.): Lexikon Musiktherapie. Hogrefe, Göttingen, 42 ff.
Krekeler, K., Merckling-Mihok, E. (2018): Schwerpunktthema „Digitale Instrumente in der Musiktherapie“. In: Zt. Musik und Gesundsein 34. Reichert, Wiesbaden, 12 ff.
6Praxeologie
von Tonius Timmermann
„Verrichte zuerst das Notwendige, sodann das Mögliche,
schließlich gelingt Dir das Unmögliche.“
(Franziskus von Assisi)
Musiktherapie hat sich in ihrer Geschichte prinzipiell parallel zur Psychotherapie entwickelt und geht nur selten als ein spezifisches Verfahren oder eine bestimmte Methode aus der Psychotherapie hervor. Während die Psychotherapie in der Medizin, speziell der Psychiatrie wurzelt, finden wir am Beginn der Musiktherapie eher kulturtherapeutische Ansätze musikalisch-künstlerischer und pädagogischer Art. In der Begegnung dieser beiden Entwicklungen kombiniert die Musiktherapie diese Ansätze mit Vorgehensweisen aus dem breiten Spektrum der Psychotherapie auf der Basis des aktuellen medizinischen und psychologischen Wissensstandes sowie spezifischer Forschung. Sie ist integriert in ein wissenschaftlich orientiertes Gesundheitssystem.
eklektisches
Vorgehen
Musiktherapie lässt sich als im positiven Sinne eklektisch charakterisieren: Sie prüft Theorie- und Handlungsmodelle, die sich aus einer Kombination musischer und psychotherapeutischer Elemente ergeben, sorgfältig darauf, wie sie sich in der therapeutischen Praxis bewähren. Eklektisches Vorgehen bedeutet, dass umsichtig und konsequent aus dem musiktherapeutischen Repertoire die Mittel und Wege gewählt werden, die aufgrund der spezifischen Indikation des Klienten erforderlich und im Einklang mit der Konzeption der jeweiligen Institution sind. Dabei muss im Einzelfall sehr darauf geachtet werden, dass sich die Methodik nicht an die Widerstände des Klienten anpasst und der Therapeut immer dann die Strategie ändert, wenn es schwierig wird: das wäre Synkretismus.
differentielle
Musiktherapie
Die Musiktherapie sorgt bei aller Anwendung verschiedenartiger Techniken gleichzeitig für eine einheitliche Grundlegung. Deswegen könnte man sie nach von Quekelberghe (1979) auch als „differentiell“ bezeichnen, in dem Sinne, dass sie dem Unterschied zwischen Störungen, Klienten, Therapeuten, Techniken, Therapiezielen etc. Rechnung trägt (Oberegelsbacher 1999, 48).
psychotherapeu-tische Techniken
Musiktherapeutisch Tätige beobachten und prüfen, welche psychotherapeutischen Theorien und Techniken sich auf welche Weise mit musiktherapeutischem Handeln verbinden lassen, wie mit dem Medium Musik eigenständige Vorgehensweisen im großen psychotherapeutischen Kontext entstehen und wie wir darüber hinaus durch musiktherapeutische Praxis und Forschung die Psychotherapie insgesamt bereichern können.
situationsgerechte
Modifizierungen
Musiktherapie verstehen wir als ein psychotherapeutisches Verfahren, dem ein auf das Medium Musik bezogenes reichhaltiges methodisches Repertoire zur Verfügung steht. Aus diesem schöpft sie situationsadäquat und modifiziert es und erforscht und entwickelt dessen besondere Wirkungen weiter. Sie verfügt über spezifische Wirkelemente und Möglichkeiten, bio-psycho-soziale Probleme aufzudecken und zu bearbeiten.
Verortung von
Musiktherapie
Den Begriff „Praxeologie“ kann man nur klären, wenn man die Begriffsvielfalt (und -verwirrung) in der Psychotherapie überhaupt betrachtet. Musiktherapie als Sammelbegriff lässt sich eben verschiedenen theoretischen und praktischen Ebenen zuordnen (s. a. Fitzthum 1997, 212 f.; 2001, 38 f.).
Es gibt im Rahmen der musiktherapeutischen Tätigkeit Menschen, die sich eindeutig einer bestimmten Grundorientierung, einem Verfahren und einem oder mehreren dazu passenden Methoden zuordnen. Allerdings sind Musiktherapeuten heute im Hinblick auf eine solche Bindung immer weniger ausschließlich und zunehmend integrativ bzw. eklektisch, vor allem mit zunehmender Berufserfahrung.
Grundorientierung
Was die Grundorientierung anbetrifft, bietet die historische Entwicklung der Psychotherapie eine gute Orientierung. Sie beginnt mit der Entdeckung des Unbewussten und den sich daraus entwickelnden tiefenpsychologischen Schulen und Verfahren. Deren gemeinsamer Nenner ist die Erfahrung, dass der Mensch entscheidend durch die – vor allem frühen – Beziehungen zu Mutter und Vater sowie deren Verarbeitung geprägt ist. Die dabei sich bildenden Grundmuster wirken positiv oder negativ im späteren Lebensverlauf weiter.
Theoretische und praktische Ebenen der Musiktherapie
Grundorientierungen: tiefenpsychologisch, humanistisch, behavioral, systemisch
Verfahren: z. B. Psychoanalyse, Gestalt,
Psychodrama
Methoden: spezifizieren entsprechend dem Verfahren, also z. B. analytische Gruppentherapie, analytische Musiktherapie)
Techniken: Halten, Stützen, Nähren usw.
Praxeologie
Aus diesem ersten und grundlegenden tiefenpsychologischen Ansatz gehen die humanistischen Verfahren hervor, welche den Spiel-Raum der klassischen psychoanalytischen Behandlungstechnik – Liegen und Aussprechen, was einfällt – erweitern. Das aktive, leiborientierte und ausdrucksbezogene Handeln des Klienten wird als positives Element entwickelt. Die sich durch solche Angebote im Hier und Jetzt abbildenden alten Muster werden durch eben diese spezifischen Vorgehensweisen auch bearbeitet. Dies ist für die therapeutische Arbeit mit kreativen Medien, und mithin für die Musiktherapie, von besonderer Bedeutung.
Die lerntheoretischen oder behavioralen Ansätze der Verhaltenstherapie sind auch eher am Hier und Jetzt orientiert und wollen negative Konditionierungen durch Übung wandeln. Allerdings entsteht auch bei einem Verhaltenstraining eine therapeutische Beziehung mit all ihren Aspekten, selbst wenn diese hier nicht näher berücksichtigt werden. Gleichzeitig kann Üben ebenfalls auf tiefenpsychologischem Hintergrund basieren.
Das systemische Denken in der Psychotherapie ergänzt den dyadischen Ansatz der Tiefenpsychologie um den erweiterten Blick auf die ganze Familie als System. Systemische Therapien arbeiten mit verschiedenen Ansätzen und Vorgehensweisen (Näheres dazu s. Kap. 20.3.2).
Methode
Musiktherapie
Derzeit lässt sich Musiktherapie nach unserem Verständnis charakterisieren als eine Methode, deren Theoriebildung in Richtung auf die Etablierung als Verfahren geht. Die Praxis einer therapeutischen Arbeit mit musischen Elementen – mit Musikrezeption, Improvisation, Körperwahrnehmung, Atem- und Stimmarbeit, Bewegung usw. – ist in Einklang zu bringen mit den seit über 100 Jahren immer umfassender und differenzierter erforschten und beschriebenen Gesetzmäßigkeiten der Psyche, mit der Dynamik des Unbewussten und seinen intra- und interpersonellen Manifestationen.
Tabelle 6.1 zeigt rezeptive und aktive Möglichkeiten, aus denen sich das große Repertoire an musiktherapeutischen Vorgehensweisen speist. Der Behandlungsplan, aber auch der konkrete Augenblick, bestimmt die Entscheidung, was in welcher Form angeboten wird. Die Tabelle gibt einen kurzen Überblick über die Grundformen (nach Timmermann 2004, 95). Diese Vorgehensweisen bzw. Gruppen von Vorgehensweisen sind z. T. miteinander kombinierbar, z. B. mit leiborientierten und anderen künstlerisch-therapeutischen Vorgehensweisen (Ausdruckstherapie, Medientherapie, Integrative Therapie). Dies wird im weiteren Verlauf dieses Lehrbuchs anhand der praktischen Beispiele noch deutlicher werden.
Arten von
Therapiemusik
Tab. 6.1: Musiktherapeutische Vorgehensweisen (nach Timmermann 2004a, 95)

Bei rezeptiven Vorgehensweisen wird den Klienten traditionell Musik „life“ vom Therapeuten vorgespielt, wobei dieser in seltenen Fällen vielleicht einmal Stücke aus der Literatur wählt, in geeigneten Situationen ein Lied für den Klienten singt, meist aber für ihn mit Instrumenten und/oder Stimme Musik erfindet. In der modernen Musiktherapie können Musikstücke auch von Schallplatte bzw. anderen Tonträgern erklingen. In beiden Fällen wird im Allgemeinen anschließend über das Erlebte gesprochen, oder der Klient verbalisiert sein Erleben direkt während des Hörens. In den letzten 20 Jahren wird zunehmend das Spielen und Singen für den Klienten bzw. die Gruppe, das „Für-Spiel“ im Unterschied zum „Vor-Spiel“, vorgezogen. Dies ist eine gute Möglichkeit, etwas für den Klienten zu tun, für ihn zu spielen – i. S. einer Zuwendung oder auch Wunscherfüllung. Er erfährt hierbei, dass er von einer Bezugsperson etwas bekommt ohne Bedingungen und Gegenleistung. Dadurch wird an eine entwicklungspsychologisch sehr frühe Kindheitserfahrung angeknüpft.
rezeptives Angebot
„Für-Spiel“
Es wurde bereits dargelegt, dass es nicht um mechanistische, quasi „medikamentöse“ Musikwirkungen geht, sondern dass der Beziehungsaspekt eine herausragende Rolle spielt. So wird die Therapeutin den Klienten mit der dargebotenen Musik eher versuchen dort abzuholen, wo er sich stimmungsmäßig gerade befindet, anstatt zu versuchen, ihn voreilig „umzustimmen“.
Selbstverständlich gibt es musikalische Strukturen, die an sich eher aktivieren (ergotrope), und solche, die eher beruhigen (trophotrope). Ein Klient allerdings, der gar nicht beruhigt werden will, kann durch eine beruhigende Musik noch erregter werden, als er bereits ist – und sich gleichzeitig unverstanden und mit seinem Eigenen nicht beachtet fühlen.
ergotrope und
trophotrope
Musikstruktur
Relevant für die Therapie ist ferner die biografische Ebene, wenn sie durch die Zuordnung von Musik in bestimmte Lebensphasen und bewegende Ereignisse angesprochen wird. Andererseits wird durch Musik auch ein Erleben phantasierter innerer Gestaltungen, Tagträume usw. ausgelöst. Die biografischen Assoziationen haben nichts mit dem Charakter einer Musik zu tun, sondern damit, in welchen Lebensmomenten sie für den Hörenden eine Bedeutung hat. Dagegen können die ausgelösten inneren Bilder durchaus im Zusammenhang mit den musikalischen Inhalten stehen.
biografische
Assoziationen
Das Spielen für den Klienten kann auf einem selbst gewählten, evtl. situationsadäquaten Instrument geschehen. Die Improvisation bietet hierbei die beste Möglichkeit, das Atmosphärische und das atmosphärisch Notwendige zu erspüren, musikalisch auszudrücken und auf den Klienten zu reagieren (Beziehung!).
Beim „Für-Spiel“ sollte der Therapeut auf jedem Instrument seines Instrumentariums und vor allem auch mit der Stimme für den Patienten spielen bzw. singen können. Dabei ist sichere Einfachheit überzeugend. Entscheidend ist, dass hier nichts schwankt, so dass der Patient sich getragen und geschützt fühlen kann. In jedem Fall ist in unserer von Musikbeschallung überschwemmten Zeit eine Einstimmung wesentlich, die der Musikdarbietung vorausgeht und den Klienten durch einen Moment von Stille, durch die Fokussierung der Wahrnehmung auf seine seelische Befindlichkeit, auf Körper, Atem und Klang des Augenblicks auf das Hören vorbereitet.
Einstimmung
Bei aktiven Vorgehensweisen wird im Allgemeinen improvisiert. Im offenen Setting bietet man dem Klienten einen Frei-Raum an mit instrumentalem, stimmlichem und körperlichem Ausdruck, ohne dass irgendwelche Voraussetzungen musikalischer oder sonstiger Art erwartet werden. Die Musiktherapeutin begleitet ihn bei diesem improvisierten Ausdruck in einer Haltung offener, sich einfühlender Antwortbereitschaft, einem der Situation gemäßen Mitspiel: Agieren und Mitagieren sind hier positive Qualitäten des therapeutischen Settings (Abs 1989).
aktives Angebot
„Ausdruck“
Bei Menschen mit einer schwachen Ich-Struktur muss man Anhaltspunkte und klare Orientierungen setzen. Therapeutisch begründete Vorgaben, Themen und Spielregeln für die Improvisationen dienen als Übungsangebote auf der Beziehungsebene. Sie ermöglichen experimentelles Handeln in problematischen Bereichen oder das Aufgefangenwerden in einer persönlichen Krise. Themen wie „Porträt meiner Mutter“, „Mein Kinderzimmer“ usw. können zur Exploration eingesetzt werden. Sie vermitteln atmosphärische Eindrücke aus der Kindheit des Klienten, ermöglichen differenzielle musiktherapeutische Diagnostik und lösen gleichzeitig psychodynamische Prozesse aus.
Improvisationen
Die vorgestellten rezeptiven und aktiven Vorgehensweisen sind sich methodisch ergänzende Elemente der musiktherapeutischen Arbeit. Die Situation des jeweiligen Klienten bzw. in der Gruppe entscheidet, ob Musikhören oder Musikmachen angeboten wird. Ändert sich die Situation, können sich auch Vorgehensweisen ändern. Gezielte Angebote aus dem musiktherapeutischen Repertoire aktiver und rezeptiver Musiktherapie helfen ihm, neue Erfahrungs- und Verhaltensmöglichkeiten durch Probehandeln aufzubauen (s. Timmermann 1998).
Probehandeln
Die spezifischen aktiven und rezeptiven Vorgehensweisen der musiktherapeutischen Praxis finden ihr Pendant in den allgemeinen psychotherapeutischen Techniken.
musiktherapeu-tische Techniken
Musiktherapeutische Techniken wie Halten, Nähren, Stützen usw. (Storz 2000) sind weder abhängig vom spezifischen therapeutischen Kontext noch vom Therapeutischen überhaupt. Sie lassen sich durchaus z. B. in präventive, psychohygienische Zusammenhänge übertragen. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung auf eine Verständigung mit anderen psychotherapeutischen Verfahren und Methoden. Hierzu gibt es Ansätze bei Priestley (1982; 1983), Oberegelsbacher (1997b, 42 ff.), Storz (2000, 444 f.) und Fitzthum (2001, 38 f.), die im Folgenden systematisiert (nach Timmermann 2004a, 95 ff.) werden.
Psychotherapeutische Techniken
●Halten/Holding/Containing
●Stützen
●Nähren
●Spiegeln
●Konfrontieren/Provozieren
●Durcharbeiten
●Verbalisisieren/Deuten/Nonverbales Verdeutlichen
Wie konkretisiert sich dies nun in der Musiktherapie?
Halten/Holding/Containing: Diese Qualität meint ein entwicklungspsychologisch frühes Gefühl sicheren Gehaltenseins, das vor der Angst bewahrt, zu fallen oder zu zerfallen. Es kann im Klienten entstehen, wenn es gelingt, ein Setting zu schaffen, in dem er sich hingibt, sich ganz und gar einhüllen lässt in eine verlässliche klanglich-rhythmische Gestalt, wenn er sich getragen weiß vom Spiel des Therapeuten bzw. der von diesem angeleiteten Gruppe.
Dies kann mit sehr einfachen musikalischen Mitteln geschehen, und zwar sowohl im Rahmen von aktiven als auch von rezeptiven Vorgehensweisen. Spielt der Therapeut für den Klienten, ist es wesentlich, dass die Musik von einer inneren Sicherheit des Spielenden zeugt, also klar und verlässlich erklingt: ein Rhythmus, der ruhig einfach sein kann, aber an dem nichts „wackelt“ – ein voll fließendes Klangkontinuum, eine mit dem Herzen gesummte Melodie aus sich wiederholenden Motiven …
Bei aktiven Vorgehensweisen nutzt die Musiktherapie die tragende Wirkung der Musik im Dialog oder im Gruppenklang. Der Therapeut ist ein verlässlicher Spielpartner, der mit seiner Musik spürbare Präsenz und aufmerksame Zuwendung signalisiert. Fundierende Basslinien und Rhythmen oder auch repetitive melodische Muster geben dem Spiel des Klienten einen sicheren Rahmen, innerhalb dessen der Klient zu seinem eigenen Spiel finden kann. Auch eine improvisierende Gruppe als haltende, tragende, wiegende „gute Mutter“ kann diese Qualität im Klienten ermöglichen.
Stützen: Diese Qualität bezieht sich auf den entwicklungspsychologisch folgenden Schritt. Der Mensch ist schon dabei, eigene Schritte ins Leben zu gehen, er braucht aber noch eine stützende Begleitung, wie ein Kind, das noch nicht alleine gehen kann. Hier sind eher aktive Vorgehensweisen gefragt, die ähnlich sind wie beim Holding. Fundierende Rhythmen und Basslinien bieten Schutz, aber auch bestätigende Antworten auf musikalische Äußerungen und ermutigen, auf dem eigenen Weg voranzuschreiten. In der Gruppe kann sich der Klient z. B. „Helfer“ wählen, andere Gruppenteilnehmer, die er um sich herum sammelt. Sie stützen ihn musikalisch, damit er nicht allein damit ist, ein schwieriges Gefühl auszudrücken. Dies knüpft an das Setting traditioneller Heilungsrituale an (s. a. Kap. 10, Anthropologie), in denen die stützende Begleitung der Gemeinschaft eine wesentliche Rolle spielt. Verschiedenste Spielregeln und rituelle Inszenierungen können stützende Funktion haben. Sie konkretisieren sich an der jeweiligen Situation.