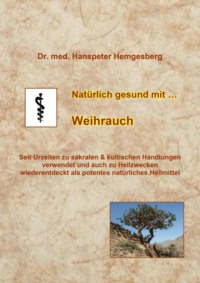Kitabı oku: «Natürlich gesund mit Weihrauch», sayfa 2
Was die Inhaltsstoffe angeht, so gelten die Aussagen zu B. carteri (s.o.).
Zuletzt noch die
Boswellia serrata
oder auch
B. glabra
oder
B. thurifera
und auch noch
Libanus thuriferus
, auch genannt
Salai-Baum
.
In Indien nennt man ihn
Sálaigugul
(daher auch Salai-Baum hierzulande) oder
Gúgal
oder
salai
und auf Sanskrit heißt er
Sallaki
. Im arabischen Raum kennt man ihn als
kundur
. Auf Spanisch wird er genannt
arbol del incensio
; auf Englisch
Indian olibanum (tree)
oder
incense tree
oder
salai tree
und im Französischen
arbre à incens
.
Der Name
Indian Olibanum
verrät seine Heimat & Herkunft: Indien. Dort wächst er in weit-ausgedehnten Wildbeständen.
Zur
Botanik
:
Der Salai-Baum stellt einen mittelgroßen Baum mit flach ausgebreiteter Krone dar. Die 9- bis 14paarig gefiederten Blätter sind am Rande kerbig gesägt oder fast ganz-randig. Auffallend ist die Dicke der Rinde des Stammes mit ca. 1,2 cm; sie ist grünlich-aschfarben und schält sich in papierartigen dünnen, glatten Stückchen ab. Die jungen Triebe und Blätter sind in der Wuchsphase mit einfachen Haaren besetzt.
Diese Weihrauchart ist hinsichtlich ihrer Inhaltsstoffe am besten untersucht und erforscht.
So enthält diese Boswellia neben dem Weihrauch-Harz noch etliche weitere und wichtige Inhaltsstoffe. Doch dazu und darüber später mehr.
Verbreitet ist die B. serrata in Indien und zwar in den niederen Ge-birgen entlang des Himalayas und auch im nördlichen und mittleren Teil Indiens, also insbesondere in Ost-Indien.
Soweit bisher bekannt, erfolgt die Drogengewinnung auch hier nicht in speziellem Anbau (Weihrauch-Kulturen), sondern aus dem reichlichen Wildwuchs.
Zuletz soll noch eine absolute „Weihrauch-Baum-Rarietät“ kurz genannt sein: Es handelt sich dabei um
Boswellia ameero
, auch genannt nach seinem einzigen Vorkommen als
Jemen-Weihrauch
.
Dieser Weihrauchbaum ist auch heute noch zu finden auf der Insel Sokotra im Jemen. Die Blumen/ Blüten (s. Abb.) variieren: in einigen Populationen sind sie leuchtend rosa, in anderen blass-rosa. Das Harz findet nur noch selten Anwendung.
Weihrauch: Weit mehr als „Rauch“!
D
er Weihrauchbaum ist die eine Seite - quasi der Lieferant und die Verpackung zugleich -. Der Weihrauch selbst - oder korrekt: das Weihrauch-Harz und die übrigen Inhaltsstoffe der Droge - ist die andere und für die An- & Verwendung wichtigere Seite.
Das Weihrauch-Harz heißt in der botanischen Fachsprache
Olibanum
; hinzukommen dann lediglich noch Zusätze je nach Herkunft des Harzes bzw. der Boswellia-Spezies.
Bei uns hierzulande sind einzig gebräuchlich die Harze von Boswellia carteri und frereana sowie in immer größeren Umfang die von Boswellia serrata.
Z
uerst das
Weihrauch-Harz
von
Boswellia carterii
:
Es wird allgemein mit
Olibanum
(Weihrauch)
bezeichnet. Synonyme sind
Gummiresina Olibanum
und auch noch mit deutschem Namen
Gummi, Kirchenharz
und
Kirchenrauch
sowie
Weißer Wirk
.
Weihrauch ist nicht gleich Weihrauch, was die Qualität angeht. In den Erzeugerländern werden drei
„beeyo-Qualitäten“
unterschieden bei Weihrauch von Boswellia carteri. Der europäische Handel seinerseits unterscheidet zwischen
Olibanum electum
- dies ist Weihrauchharz, das direkt vom Baum abgelöst worden war; es handelt sich also um „reines Harz“ - und
Olibanum in sortis
- dies stellt „unreines Harz“ dar, welches vom Boden aufgesammelt wurde -. Letztere Unterscheidung gilt natürlich auch für den Indischen Weihrauch (s.u.).
Bitte Vorsicht!
Hauptverfälschungsmittel des echten Weihrauch-Harzes sind
Kolophonium
(d.i. der Rückstand aus Kiefern-Harz nach dem Ab-Destillieren des Terpentin-Öls). Kolophonium ist zumindest den Streichinstru-menten-Spielern unter Ihnen bekannt als Hilfsmittel zur Erhöhung der Reibung der Bogenhaare; K. wird aber auch viel verwendet für Firnisse, Kitte und Pflaster.
Vorsicht ist aber geboten gegenüber dem
„gemeinen Weihrauch“
, auch genannt
„Wilder Weihrauch“
bzw.
„Olibanum silvestre“
. Eigentlich kein Weihrauch; es handelt sich vielmehr um
Fichten-Harz
, welches in einem Ameisenhaufen gesammelt wurde. Man erkennt es an der Rotfärbung.
Eine dritte Fälschung stellt der
„Russische Weihrauch“
dar. Dies ist das Harz der Schwarzkiefer (Pinus nigra).
Daher mein Rat:
Nicht überall, wo Weihrauch draufsteht,
ist auch der echte und reine Weihrauch drinnen!
Daher:
Stets nachfragen und erklären lassen!
Das Weihrauch-Harz als naturbelassene und nicht verarbeitete Ganzdroge von Boswellia carteri hat einen nur ganz schwachen Eigengeruch; auf glühende Holzkohle (oder Kohle, Holz etc.) gestreut, dann aber einen angenehmen aromatischen Geruch. Der Geruch ist bitter-aromatisch.
Weihrauch bildet - nach dem Austritt aus der Baumrinde - fast kugelige, erbsen- bis zu walnuß-große, tränenförmige Körner daher
auch der Name
Weihrauch-Tränen
oder
Olibanum in lacrimae
(vgl. vorne das Weihrauch-Rezept Nr.3 nach Rody) - in Arabien und dem alten Ägypten auch geheißen
„Tränen der Götter“
! - oder auch „stalaktiten-artige“ Massen, die gelblich, gelb-rötlich oder auch bräunlich eingefärbt sind und außen weiß bestäubt und dabei nur gering durchsichtig sind. Das verfestigte Harz ist leicht zerbrechlich und auffallend glänzend wie Wachs am muscheligen Bruch; in dünnen Harz-Splittern ist es meist durchsichtig und klar.
Beim Kauen des Weihrauch-Harzes (dies haben wir als Buben in der Sakristei oder während längerer Messfeiern und besonders von Prozessionen immer wieder als „Kaugummi-Ersatz gerne genommen) weicht das Harz rasch auf und zerfließt im Munde und hat dann die Konsistenz von Honig und dabei ist der Geschmack angenehm aromatisch.
B
evor ich nun zu den Inhaltsstoffen zu sprechen komme, müssen eigentlich einige Stoff- & Wirkungsgruppen besprochen sein.
Dies lesen Sie bitte bei Interesse in einem eigenen Kapitel am Ende des Buches nach („Das sollten Sie wissen …“). Das hat auch seine Gül-tigkeit für die nachgehend noch zu besprechenden beiden Boswellia-Spezies:
B. frereana
und
B. serrata
.
Noch ein Hinweis:
Für die arzneiliche Aufbereitung kann und darf nur und einzig das reine Harz -
Olibanum electum
- verwendet werden. Für die Verwendung zu Räucherzwecken oder zur Aroma-Therapie tut es natürlich auch das (billigere) „unreine Harz“, das
Olibanum in sortis.
N
un endlich zu den
Inhaltsstoffen in Boswellia carteri
:
An erster Stelle zu nennen das
ätherische Weihrauch-Öl,
Oleum Olibani carteri [electum in lacrimae]
. Es kommt mit einem Anteil von zwischen 5 bis 9% im Harz vor und hat eine - von Boswellia-Art zu Art leicht differierende - „arten-abhängige“ Zusammensetzung. Dabei lassen sich hier mindestens 42 (!) Komponenten analysieren. So findet sich mit einem 60%-Anteil
1-Octyl-acetat
und mit 12,7%
1-Octanol
. Die beiden machen also den „Löwenanteil“ der Inhaltsstoffe im ätherischen Öl aus. Weitere charakteristische Komponenten sind u.a.
Cembren
mit 1,4%,
Incensol
mit 2,7%,
Isocembren
mit 1,8%,
Iso-Incensol
mit 0,8% und mit 3,5%
alpha-Pinen
.
Weiter kommen noch vor:
Borneol, Cadinen, Camphen, Carvon-Hydrat, p-Cymol, Dipenten, Phellandren, beta-Pinen, Verbenol
und
Verbenon
.
Im
Reinharz
- es macht mit ca. 68% den Hauptanteil aus - finden sich die wichtigen
alpha-
und
beta-Boswellia-Säuren
, dann weitere Boswellia-Säuren wie die
11-Hydroxy-beta-Boswellia-Säure
, die
11-Keto-beta-Boswellia-Säure
und die Methylester der
3-Acetyl-11-Hydroxy-beta-Boswellia-Säure
und diese letzte ist der Hauptbestandteil aller Boswellia-Säuren im Harz. Bis heute konnten 14 verschiedene Boswellinsäuren(-Derivate) nachgewiesen und isoliert werden.
Bevor die beiden anderen Weihrauch-Spezies besprochen werden, ein wichtiger Hinweis:
Die Bedeutung und auch die wichtigsten Wirkungen dieser Inhaltsstoffe im ätherischen Öl und im Harz werden nachgehend für alle Boswellia-Arten gemeinsam abgehandelt.
N
un zu den
Inhaltsstoffen in Boswellia frereana
:
Gesichert ist hier die Zusammensetzung des
Gummiharzes
, welche weitgehend übereinstimmt mit jener für Boswellia carteri.
Was das
ätherische Öl
-
Oleum Olibani frereanae
- angeht, so finden sich - gesichert anhand zahlreicher Analysen -
Cembren, alpha-Cubeben, p-Cymen, Limonen, Mycren, alpha-Pinen, alpha-Terpinen, Terpinen-4-ol
.
Z
uletzt noch zu der - dies im Vorgriff auf spätere Angaben - heute wohl für medizinisch-therapeutische Anwendungen wichtigsten und bedeutendsten Boswellia-Art, zu
Boswellia serrata
und damit zum Lieferanten des
Indischen Weihrauchs
.
Was das
Gummiharz
angeht, so finden sich auch hier zu und mit den übrigen Boswellia-Arten Übereinstimmungen in höchsten Maßen. Dennoch sollen - insbesondere wegen deren Bedeutung in der Medizin - noch einmal die wichtigsten Inhaltsstoffe genannt werden:
Dies sind vor allem die beiden Triterpensäure-Gruppen. Einmal handelt es sich dabei um die
Pentacyclischen Triterpensäuren
-
Acetyl-beta-Boswellia-Säure, beta-Boswellia-Säure
und
11-Keto-Boswellia-Säure
- und die
Tetracyclischen Triterpensäuren
(Tirucallensäure) -
3-alpha-Acetoxy-tirucall-8,24-dien-21-säure
, sowie
3-alpha-Hydroxytirucall-8,24-dien-21-säure
, dann
3-beta-Hydroxytirucall-8,24-dien-21-säure
.
Ferner findet sich im Harz noch der
Diterpen-Alkohol „Seratol“
.
In der
Rinde des Indischen Weihrauchbaumes
,
Cortex Olibani serratae
, finden sich
Catechin-Gerbstoffe, Harzsäuren
(Resino-Säuren),
Phlobaphene
und das wichtige
ß-Sitosterol
[u.a. angewendet zur Behandlung einer gutartigen Prostata-Vergrößerung].
Im sehr fetthaltigen
Samen
,
Semen Olibani serratae
, lassen sich nachweisen: 8,7% gelbes
fettes Öl
, mit 6,2%
Linolen-
, 13,3%
Olein-
, 15,3%
Palmitin-
und 9,5%
Stearin-Säure
.
Aus den
Blättern des Weihrauchbaumes
,
Folia Olibani serratae
, konnte ein
ätherisches Weihrauch-Öl
(Oleum Folia Olibani serratae) isoliert werden mit den Wirksubstanzen
Bornyl-acetat
mit 20%,
beta-Terpineol
mit 13,6%,
alpha-Thujen
mit 32% und in geringeren Konzentrationen auch noch
p-Cymen, Limonen, Terpinolen, alpha-Phellandren
und
alpha-Pinen
.
Zugegeben:
Reichlich viel „Fachchinesisch“ und auch reichlich viel „Theorie“!
Die wichtigsten Wirkstoffe und deren Bedeutung in der Heilkunde und für die therapeutische Anwendung darf ich Ihnen nunmehr nachfolgend - dies im Sinne der Alltags-Praxis - in Kurzform mit auf den Weg und zur Hand geben.
Wobei ich noch einmal darauf hinweise, dass zu diesem wirklich komplexen Thema weitere Ausführungen nachzulesen sind am Ende des Buches in einem eigenen Kapitel („Das sollten Sie wissen …“).
E
rlauben Sie mir einen „kleinen Schwenk“:
Beim Räuchern schlägt Weihrauch eine Brücke von der materiellen zur spirituellen Welt.
Mit und durch den Rauch tritt man in Verbindung mit der göttlichen Kraft und - so auch heute noch in vielen Naturreligionen - setzt sich in „religiöse Verzückung“. Er öffnet die Seele, vermittelt Verstehen für die Lebensgesetze und fördert die Meditation. Er galt & gilt an okkulten Schulen als bestes Mittel für Weihe, Segnung, Reinigung und Schutz.
Weihrauch reinigt nicht nur von Keimen und unangenehmen Gerüchen, sondern er ist einer der stärksten atmosphärischen Reiniger.
Wenn in Räumen gestritten wurde, wenn dicke Luft sich ausbreitet, wenn in Krankenzimmern, Warte- und Prüfungsräumen viele Menschen ihre Sorgen hängen gelassen haben wie Mäntel an einer Garderobe, dann kann eine
Weihrauchräucherung für eine gereinigte, klare Atmosphäre sorgen
.
Sein Rauch soll auch
Wohlstand und Erfolg
herbeiführen können. Für uns heute eignet sich der Weihrauch be-sonders gut als begleitender Duft bei Gebet, Meditation und innerer Sammlung. Er reinigt unsere ‚inneren Räume‘, die feinen Energieka-näle, um uns empfänglich zu machen für heilende, geistige und kos-mische Schwingungsmuster.
Weihrauch ist ein sehr wirksames Anti-Stress-Mittel.
Er kann erhöhten Muskeltonus beruhigen und so ein Gefühl angenehmer Wärme und Schwere erzeugen.
Neben Myrrhe besitzt kaum ein anderes duftspendendes Harz eine so ehrwürdige Geschichte. Bereits von den Ägyptern wurde es für kultische Zwecke, als Räuchermittel, in Salben zum Einbalsamieren sowie als Parfüm-Zusatz benutzt. Obwohl Weihrauch im eigentlichen Sinne die Bezeichnung für einen geweihten Rauch ist, der bei der Verbrennung von Kräutern, Hölzern und Harzen entsteht, wird das Harz landläufig als Weihrauch verstanden.
Zur psychischen Ebene des Weihrauchs nur soviel:
Sein männlicher Charakter stärkt das Selbstbewusstsein, die Willensstärke und das physische wie seelische und geistige Leistungsvermögen!
Zur physischen Ebene:
Weihrauch (be-)reinigt und entspannt und stärkt!
Bevor nun über die Wirkungen der einzelnen Inhalts- bzw. Wirkstoffe und in toto und somit zu den An- & Verwendungen des Weihrauchs näher eingegangen werden soll, sollten Sie sich etwas „verschnaufen“ …
Götter, Götzen & Gelehrte …
W
eihrauch zählte schon in grauer Urzeit zu den
„Tempel-Schätzen“
, so nachzulesen im Buch
Nehemia
(Altes Testament; 13,5), wo es heißt:
… „
er war verwandt mit Tobija und hatte darum für dieses eine große Kammer einrichten lassen. Dort bewahrte man früher das Opfermahl und den
Weihrauch
auf sowie die Behälter und den Zehnten von Getreide, Wein und Öl, der den Leviten, Sängern und Torwächtern gesetzlich zukam; außerdem die Abgaben für die Priester“ …
Doch war Weihrauch schon viel früher nicht nur bekannt, sondern hoch geschätzt und die „Kulturgeschichte“ des Weihrauchs reicht weit zurück.
Schon im 4. oder sogar im 5. Jahrtausend vor Christus wurde Weihrauch - und damals auch schon in etlichen Mischungen - zu Ehren orientalischer Götter geopfert; Weihrauch war - mit Myrrhe -unverzichtbares Ingredienz für „kultische Räucherungen“.
So schreibt der große und berühmte griechische Historiker
Herodot
(484-424 v.Chr.) - er ist Verfasser der
„Historien“,
die als maßgebende Quellen für die Epoche der Perser-Kriege (d.s. die Kriege zwischen Griechen und Persern zwischen 500-479 v.Chr., die zur Gründung des Attischen See-Bundes führten und letztlich die Unabhängigkeit Griechenlands sicherten) -, dass die Babylonier zu Ehren des von ihnen verehrten Gottes
„Baal“
(der Name ist Hebräisch und bedeutet eigentlich „Gott“) jährlich für 1000 Talente (Talent = altgriech. Geld- und Gewichts-Einheit) Weihrauch verbrannt haben.
Schon im 4. Jahrtausend v.Chr. verbrannten die alten Ägypter Weihrauch in ihren Tempeln. Der schwere und zugleich warme und harmonisierende Duft des aufsteigenden Weihrauchs stand - nicht nur bei den Ägyptern - für „göttlichen Wohlgeruch“ und auch für „göttliche Nähe“.
Bei den alten Ägyptern war der Weihrauch neben der Bedeutung als Räuchergabe viel angewendet als Heilmittel und besonders auch zum Einbalsamieren der Toten. Ihnen war bereits damals die konservierende und antiseptische Wirkung des Weihrauchs bestens bekannt. Außerdem: der für die Götter angenehme Duft des Weihrauchharzes sollte den damit einbalsamierten Leichnam insbesondere auch auf seine Wiedergeburt vorbereiten.
Der griechische Schriftsteller
Plutarch
(46-120 n.Chr.), berühmt ob seiner populär-philosophischen Abhandlungen
„Moralia“
und vergleichender Biographien u.a. zu Caesar und Alexander dem Großen, berichtet, dass der Sonne morgens, mittags und abends ein Weihrauch-Opfer dargebracht wurde.
Verschiedene Weihraucharten bildeten einen wesentlichen Bestandteil des
„Kyphi“
(oder Kyphy): es war ein im alten Ägypten gebräuchliches Räuchermittel aus 16 verschiedenen Ingredienzien.
Plutarch
schrieb dazu, dass dieses Kyphy bei Sonnenuntergang verbrannt wurde. Die
Sphinxen von Heliopolis
hielten in ihren Vordertatzen Rauchgefäße, in denen das kostbare Kyphi verbrannt wurde. Im berühmten
Papyrus Ebers
thewatchers.adorraeli.comthewatchers.adorraeli.comthewatchers.adorraeli.com
und auch beim 1. Militärarzt in der Geschichte,
Pedianos Diskurides
(er lebte in der Zeit der Herrschaft des römischen Kaisers Nero, also in der Mitte des 1. Jahrhunderts n.Chr.), sind präzise Anweisungen zur Herstellung von Kyphi nachzulesen. Er vertrat allerdings die Ansicht, dass die arabischen Weihrauch-Harze die besseren wären (Nebenbei: diese Ansicht hat sich scheinbar bis in unsere Tage gehalten; obwohl Qualität; Inhaltsstoffe, Geruch der indischen Weihrauch-Harze den Handelsprodukten „Aden“ und „Somalia“ ebenbürtig ist, wie Dr.
Dieter Martinetz
, Leipzig, in seinem Buch
„Weihrauch & Myrrhe“
herausstellt).
Ein detailliert beschriebenes Rezept aus der
Ptolemäer-Zeit
(Anmerkung: die Ptolemäer oder Lagiden waren eine makedonische Dynastie, welche nach dem Tode
Alexander d. Großen
- also in der Zeit 323-30 v.Chr. - in Ägypten herrschte) ist aufgetragen auf die Wände des Tempels in Edfu.
Ein dem Kyphi ähnliches Räuchermittel wird im
Alten Testament
(im 2. Buch Mose „Exodus“ - 30,34-35 -) beschrieben, wo es heißt:
… „
Weiter spricht der Herr zu Mose: Nimm dir Duftstoffe, Stakte-Tropfen, Räucherklaue, Galbanum, Gewürzkräuter und
reinen Weihrauch
, von jedem gleich viel, und mach Räucherwerk daraus, ein Würzgemisch, wie es der Salbenmischer herstellt, gesalzen, rein und heilig!“ …
Die steigende Nachfrage nach Weihrauch - und auch anderen „aromatischen Harzen - führte die Ägypter bereits sehr früh in fremde Länder zu regelrechten „Einkauf-Expeditionen“: Echten Weihrauch bezogen die Ägypter sowohl auf dem Land- wie auch auf dem Seeweg aus dem sagen-umwobenen
„Punt“
.
Punt - wahrscheinlich handelte es sich dabei um das heutige
„Eritrea“
- findet sich auf vielen ägyptischen Inschriften als ein Land an der afrikanischen Somali-Küste. In dieses Land hatten die alten Ägypter schon im 3. Jahrtausend v.Chr. und besonders unter
Mentuhotep II
Handelsfahrten unternommen, um Weihrauch, Harze und Edelhölzer zu holen. So ließ Königin
Hatschepsut
(1504-1482 v.Chr.) ihre Expedition im Tempel von Deir-el-Bahari an der Wand der Pfeilerhalle, der
„Punt-Halle“
, aufzeichnen.
Von ebensolchen Weihrauch-Handelsfahrten unter König
Ramses III.
berichtet der
Große Papyrus Harris
. Auch König
Salomon
betrieb Handel mit Punt. Die oben schon genannte Königin
Hatschepsut
ließ sogar aus Punt bzw. der umliegenden Region
„31 ausgesuchte Weihrauch-Bäume“
für die oberste Terrasse ihres Grabtempels in
Deir-al-Bahari
kommen; es war dies die erste und belegte Handelsreise, bei der „grünende Weihrauchbäume“ und nicht nur wie bislang das Harz mitgebracht wurden. Im Grabtempel der Pharaonin
Hatschepsut
selbst sind Weihrauchbäume am Eingang zur Grabstätte an den Wänden eingemeißelt.
Wenn wir schon im alten Ägypten sind und waren, hier noch eine Ergänzung: Es waren die Harze des Weihrauchs, die im Altertum eine herausragende Rolle bei der Götter- & GötzenVerehrung gespielt haben und daneben aber immer - dies muss hier bereits deutlich betont sein - auch eine wichtige Bedeutung hatten in der Kosmetik und der Heilkunde und die den ägyptischen König
Sahure
(ca. 2455-2443 v.Chr. * 5. Dynastie) zu Schiffsexpeditionen in dieses sagenhafte Land „Punt“ veranlasst hatten.
Weihrauch bildete den Reichtum der in Süd-Arabien ansäs-sigen
Sabäer
und
Minäer
.
Die Tempelinschriften zu
Edfu
(oder Idfu; das war ein angesehenes Zentrum im alten Ägypten und zwar in Ober-Ägypten) nennen ausdrücklich 14 verschiedene Weihrauch-Arten.
Zusammen mit anderen wertvollen und teuren Gütern wurde Weihrauch von den
Phöniziern
(oder Phönikiern * Anmerkung: dies war ein Volk in der Antike, welches die Landschaft an der mittel-syrischen Küste vom Karmel bis Arodos besiedelte und eine bedeutende Handelsnation jener Zeit war; bedeutende Handelsstädte in diesem Land waren Byblos, Tyros, Sidon; außerdem gründeten sie Handelskolonien im Mittelmeer-Raum wie Gades und Karthago; sie verehrten besonders die Gottheiten Adonis, Eschmun und besonders Baal) über die berühmte
„Gewürz-Route“
durch Süd-Arabien und von einigen ost-afrikanischen Häfen aus nach Israel (dem Staate Juda) gebracht. Daneben bestand eine Karawanen-Straße für Importe von Weihrauch aus Indien.
D
ie Weihrauch-Harze waren mit das wichtigste Handelsgut überhaupt auf der antiken
„Weihrauch-Strasse“
von Süd-Arabien nach den Küsten des Mittelmeeres und sogar - auf arabisch-osmanischen Segelschiffen - bis hin nach Indien. Hier darf ich erinnern an die Abenteuer-Geschichten unserer Kindheit und frühen Jugendzeit; ich jedenfalls habe mit großer Lust die Romane wie
Sindbad der Seefahrer
geradezu verschlungen.
Übrigens: Den Weihrauch-Harzen galt auch der gescheiterte Feldzug der Römer (24 n.Chr.) unter
Aelius Gallius
in die süd-arabischen Sammelgebiete für Weihrauch.
Auch bei den Juden wurde morgens und abends - neben anderen Spezereien - Weihrauch verbrannt. So heißt es im
2. Buch Mose
(„Exodus“ – 30,7-9):
…“
Aaron soll auf ihm (gemeint der Altar mit der Bundesurkunde) Morgen für Morgen duftendes Räucherwerk verbrennen, wenn er die Lampen herrichtet. Wenn Aaron zur Zeit der Abenddämmerung die Lampen wieder aufsetzt, soll er das Räucherwerk ebenfalls verbrennen; es soll ein im-merwährendes Rauchopfer vor dem Herrn sein von Generation zu Gene-ration.“ …
Der hebräische Name für Weihrauch ist
levonah
und im arabischen heißt er
luban
. Beide Namen tauchen in frühen jüdisch-religiösen Schriften immer wieder auf. Erst in der
Babylonischen Gefangenschaft
lernten die Juden den Weihrauch als Attribut des Baal-Kultes verachten! Und dennoch brach die Tradition nicht ab.
So viele Kriege gerade um Glaubensgrundsätze geführt wur-den und werden, in den Opfergaben herrschte erstaunliche Einigkeit: man gab eben vom Besten, um die Götter gnädig zu stimmen.
V
on den Juden zum Christentum:
Im
Neuen Testament
finden sich mehrere Hinweise über die Bedeutung des Weihrauchs in jener Zeit zu Christi Geburt. So erzählt der Evangelist
Matthäus
(2,10-11) von den kostbaren Gaben der
Drei Weisen aus dem Morgenland
(oder auch die Heiligen Drei Könige):
…“
Als sie den Stern sahen, wurden sie von großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter; da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold,
Weihrauch
und Myrrhe als Gaben dar“ …
Der Evangelist
Lukas
(1,8-10) schreibt:
…“
Als seine Priesterklasse wieder einmal an der Reihe war und beim Gottesdienst mitwirken musste, wurde, wie nach der Priesterordnung üblich, das Los geworfen und Zacharias fiel die Aufgabe zu, im Tempel des Herrn das Rauchopfer darzubringen. Während er opferte, stand das ganze Volk draußen und betete.“ …
In der Synagoge selbst und auch in der frühen christlichen Kirche war hingegen die Verwendung des Weihrauchs unbekannt. Erst im 4. und 5. Jahrhundert n.Chr. bürgerte sich der Gebrauch von Weihrauch auch in der Kirche und im christlichen Gottesdienst ein und zwar über den ‚Umweg’ des antiken Kaiser-Zeremoniells und wurde dann später symbolisch auf das Gebet „Räucherung“ (um-) gedeutet.
Zurück noch einmal in die
Kultur des frühen bzw. alten Ägyptens
. An Ketten geschwungene Weihrauch-Räucherpfannen (in der katholischen Kirche auch heute noch erhalten in den „Weihrauch-Fässchen“) - wie diese im orientalischen Kultus verwendet wurden und üblich waren (und von diesem orientalischen Ritus dann übernommen wurden und Eingang gefunden haben im christlichen Ritus „Inzensation“) - sind in alt-ägyptischen Tempeln dargestellt und auch bei Ausgrabungen in
Pompeji
gefunden worden.
In der
griechischen
und auch der
römischen Kultur
wurde der Weihrauch im Götter-Kult gebraucht; aber auch zu Begräbnissen, Feiern, dann bei Gastmählern, Triumphzügen und außerdem war er ein wichtiges Ingredienz von Kosmetika und wurde zudem noch benötigt als Arzneimittel und ganz besonders zur Desinfektion.
Über die Weihrauch-Gewinnung, aber auch über Handel, Sorten, Preise, Verfälschungen und Verwendungen berichten antike Schrift-steller ausführlich und beredt, dabei zum Teil in märchenhafter und blumiger Ausschmückung.
Alexander der Große
(356-323 v.Chr.) - König von Makedonien; er war von den beiden großen Gelehrten
Aristoteles
und
Leonides
erzogen worden; er ist Gründer der sagenumwobenen Stadt
Alexandria
- schickte seinem Erzieher
Leonides
als Geschenk eine Schiffsladung Weihrauch; dies war für die damalige Zeit ein höchst kostbares wie auch kostspieliges Geschenk.
Der griechische Geschichtsschreiber
Flavius Arrian(us)
(95-175 n.Chr.) - er ist Verfasser des Feldzug-Berichtes
„Anabasis“
der Feldzüge
Alexander d. Gr.
- hielt fest, dass bei der Beerdigung der
Poppaea
Sabina
der römische Kaiser (Claudius Drusus Germanicus)
Nero
(37-68 n.Chr.) mehr Weihrauch verbrennen ließ, als Arabien in einem Jahr erzeugte.
In besonders hohem Ansehen stand der Weihrauch zu Riten und Ritualen in den Tempeln der altgriechischen Stadt
Delphi
und dabei vor allem auch zur Weissagung der Götter, dem
„Orakel von Delphi“
.
Aber auch auf dem
asiatischen Kontinent
war der Weihrauch zu Riten unverzichtbar. Zu Opfern und Leichenbegräbnissen wurde er im
alten China
verwendet. Nach China war der Weihrauch ab dem 10. Jahrhundert n.Chr. durch die Araber gekommen.
In
Indien
wird seit dem frühesten Altertum Weihrauch - und zwar der einheimische
„Indische Weihrauch“
von Boswellia serrata - bei Gottesdiensten als Brand- und Rauchopfer verwendet, so nachzulesen im
Ayurveda des Susruta
(um 500 n.Chr.).
Diesen
„Indischen Weihrauch“
haben mit hoher Wahrscheinlichkeit schon die Griechen auf den Feldzügen
Alexander d. Gr.
im heutigen
Pandschab
in Indien kennen gelernt.