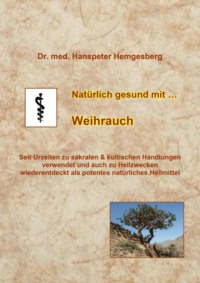Kitabı oku: «Natürlich gesund mit Weihrauch», sayfa 4
Natura sanat!
Medicus curat – Natura sanat!
So lautet der sehr alte Spruch in voller Länge; was übersetzt heißt, dass der Arzt (Behandler) sich bemüht, den Patienten von einer Krankheit wiederherzustellen, die Natur mit all ihren Möglichkeiten aber zu heilen vermag.
Seit Urzeiten war ist der Weihrauch - und dies wie gesehen neben der Verwendung zu kultischen und religiösen Handlungen und Zere-monien - auch immer
„Heilmittel“
gewesen.
Gemeinsam soll nun diese „Seite“ des Weihrauchs aus zwei Blickwinkeln betrachtet und beleuchtet werden; einmal - so wie es auch früher war -, die
„Heilkunde von Gestern“
und dann aber auch - so wie es gerade gegenwärtig brandaktuell ist - die
„Medizin von Heute“
.
U
m es gleich und vorweg herauszustellen:
Sie werden mindest überrascht sein, wenn Sie nach diesen beiden Epochen der Heilkunde/Medizin und der Anwendung des Weihrauchs in der Therapie feststellen werden (müssen), dass schon in sehr frühen Zeiten Weihrauch für Krankheiten eingesetzt wurde - und erfolgreich zudem -, für Indikationen also, die in diesen Tagen wieder in der aktuellen Fachdiskussion stehen und wo nunmehr Wirkungsnachweise den Einsatz auch „wissenschaftlich“ absichern.
Ich kann es mir einfach nicht verkneifen:
„
Erfahrungsmedizin“
(oder „Erfahrensheilkunde“ {?}) macht also doch Sinn und hat nichts zu tun mit Kurpfuscherei oder Scharlatanerie und ist also doch zumin-dest eine überdenkens- und einbeziehenswerte Medizinrichtung oder ein Teilbereich der
„ganzheitlichen naturheilkundlichen Medizin“
!
Nicht mehr, aber auch nicht weniger!
Wenden wir uns - nach dem Exkurs in die kultisch-religiös/sakralen-spiritistischen Sphären - nunmehr der Bedeutung des Weihrauchs - und hier werden ohne sonderliche Unterscheidung nach „Aden-„, „Somali-„ oder „Indischem Weihrauch“ alle diese Spezies einheitlich auf den Prüfstand gestellt - in der Heilkunde zu.
Wagen wir zuerst den Blick zurück zur Bedeutung des Weihrauchs in der heilkundlichen Anwendung früherer Epochen.
Schon im Altertum bewährt …
D
ies gilt unisono für die Heilkundigen in Arabien wie auch in China und Indien.
Schon die alten Ägypter verwendeten „arabischen Weihrauch“ gegen mancherlei Beschwerden und Krankheiten, so bei Entzündungen des gesamten Magen-Darm-Traktes.
Übrigens:
Auch heute werden diese arabischen Weihrauch-Harze noch immer angeboten als
„Aden-„ und „Somalia-Weihrauch“
. Beim Weihrauch aus Asien handelt es sich stets um den
„Indischen Weihrauch“
.
Sowohl innerlich wie äußerlich wurde der Weihrauch viel verwendet gegen mancherlei Hautunreinheiten und Hautleiden (heute nennen wir diese u.a. Schuppenflechte, chronische Ekzeme und auch allergische Ekzeme) und dies (und ohne Kenntnisvermittlung untereinander) sowohl in der arabischen Welt wie auch in der Ayurveda-Heilkunde Indiens.
Verweilen wir einen Augenblick bei der
„Ayurveda-Heilkunde“
, also der
„Lehre vom langen Leben“
{?}:
(Abb. Gott Dhanvantari taucht aus dem Milch-Ozean auf, den Krug mit dem Nektar des Lebens in der Hand * Quelle: de.wikipedia.org)
In der traditionellen
indischen Ayurveda-Medizin
- sie zählt wohl zu den ältesten Gesundheitslehren in der Welt! Sie wurde vor mehr als 2.500 Jahren in den ‚vedischen Schriften’ festgehalten; Ayurveda ist eine „ganzheitliche Therapie“, ein schon fast philosophisches Lebensprinzip - und auch in der
indischen Volksmedizin
war der Indische Weihrauch vielfach und für die unterschiedlichsten Leiden und Gebrechen - ganz besonders für chronische und auch schwerste Krankheiten - in der Therapie verwendet worden und dabei sowohl zur äußerlichen Anwendung als Salbenzubereitungen und zur Räucher-Therapie und wohl auch zur Inhalation und auch als Extrakte und Pulver. Daneben - nicht selten als kombinierte innerliche + äußerliche Therapie - auch innerliche Anwendung des Weihrauchs - in den verschiedensten Darreich-ungsformen -.
Knapp noch wichtige Grundprinzipien der Ayurveda-Medizin:
(nachgehende Textpassagen und auch die Graphiken sind wiederum in gekürzter und abgeänderter Form entnommen der Broschüre „Aktuelle Weihrauch-Forschung“ der Firma F. Zilly, Pharmazeutische Präparate)
Im Ayurveda ist das Universum eingeteilt nach
drei „Doshas“
, die sich in unterschiedlicher Intensität bei jedem Menschen finden:
Vatha-Typ
[charakterisiert durch Bewegung und Aktivität]
Pitta-Typ
[charakterisiert durch Energie]
Kapha-Typ
[charakterisiert durch Festigkeit]
Im Ayurveda spielen neben der Wirkung auf die Doshas auch Wirkungen auf die übrigen Komponenten der „ayurvedischen Regulationslehre“ Rasa, Guna, Vipaka, Virya und Prabhava eine wesentliche Rolle. Im Ayurveda wird der Mensch als untrennbare Einheit von „Körper, Seele und Geist“ gesehen, auf die Verhalten und Umwelt einwirken. Übrigens: Auch andere Gesundheitslehren stellen sich als ‚ganzheitliches System’ dar; so z.B. die Kneipp-Therapie, die TCM (Traditionelle Chinesische Medizin) … … und dies im Gegensatz zur ‚modernen westlichen Medizin’, sprich der „Schulmedizin“, die eine krankheits- und symptomen-bezogene Sichtweise verfolgt. Regulatorische Wirkungen + Eigenschaften des Indischen Weihrauchs im Ayurveda Dosha „Drei Grundeigenschaften“ verringert Pitta und Kapha Rasa „Geschmack der Pflanze” herb, bittersüß Guna „Eigenschaft bzw. Qualität der Pflanze” leicht, trocken Vipaka „Geschmack nach der Verdauung“ scharf Virya “Wirkung auf den Körper” erhitzend Prabhava „Außergewöhnliche Wirkungen“ keine Weiter: Organ-Funktionssysteme und Wirkungen von Indischem Weihrauch im Ayurveda Gesamter Organismus entzündungshemmend, antiseptisch, desinfizierend, fettreduzierend, blutstillend, gewebeverbindend, Verringerung von Kapha in Kopf & Nacken Herz-Kreislauf-System kardiotonisch (Herz-Kreislauf-stärkend) Atemwege auswurffördernd, entzündungshemmend Verdauungs-System Regulierung der Stuhlfarbe, karminativ, stomachisch, verdauungs-fördernd, antidiarrhoisch, anti-helmintisch, geschmacks-verbessernd Urogenital-System antiseptisch, diuretisch, aphrodisierend, menstruations-fördernd Nervensystem, Sinne analgetisch, Verstärkung der geistigen Kräfte, stimulierend, Augen-tonisch Haut schweißtreibend, wundreinigend Abwehr-System fiebersenkend Zuletzt noch: Therapeutische Wirkungen von Indischem Weihrauch auf/bei … Ayurveda: Indische Volksmedizin Blutkrankheiten Innerlich: Hautkrankheiten verschiedene Formen von Arthritis Diabetes mellitus (vor allem rheumatoide Arthritis) Fieber Erkrankungen der Atemwege Krämpfe Chronische Diarrhoe Wunde Stellen im Mundbereich Chronische Dyspepsie Vaginaler Ausfluss Gelbsucht (nicht-mechanische Ursachen) Hoden-Erkrankungen Mundgeruch schlechter Geschmack (in Mischung mit Arabischem Gummi) Entzündungen der Reduktion von Übergewicht ableitenden Harnwege Augen-Entzündungen
Äußerlich:
Erkrankungen im gesamten Atemwegsbeschwerden
„rheumatischen Formenkreis“ Soor
(entzündlich + chron.-degenerativ) Chronische Geschwüre und Knochener-
Schmerzen krankungen (Adstringens)
Würmer Förderung des Haarwuchses
Haemorrhoiden
Zuerst zur „Externa-Therapie“ (Anwendung zum äußerlichen Gebrauch): Die schon genannten Zubereitungen dienten der Behandlung von Wunden (auch von schlecht heilenden und von juckenden Wunden) und Geschwüren und von schuppenden, juckenden, brennenden und auch schmerzhaften Hautkrankheiten. Was die „Interna-Therapie“ angeht, so fand Weihrauch viel Anwendung beim Magen-Darm-Geschwüren, Magen-Darm-Entzündungen, bei Entzündungen generell, bei Wucherungen der Augen-Bindehaut, zur Behandlung von tuberkulösen Restherden und dann besonders bei vielen Krankheiten des rheumatischen Formenkreises (wie wir diese heute nennen) - also von Gicht über chronisch-degenerativen wie entzündlichen Rheumatismus und auch bei Gelenkveränderungen - und bei allen diesen Krankheiten aufgrund der „Dreier-Wirkung“ des Weihrauchs: einmal entzündungshemmend, dann schmerzstillend und drittens beruhigend (sedierend). Hochinteressant war dann aber auch die Anwendung als geschätztes Mittel gegen bösartige Tumoren (Malignome oder Krebsleiden) von Magen, Darm (und hier besonders von End- und gesamten Dickdarm), Leber und Milz und auch bei sonstigen Tumoren des gesamten Bauchraumes und nicht zuletzt auch bei Krebs im Bereich der Brustwarzen. Ein Wort noch zur oben genannten dritten Wirkung. Nämlich der beruhigenden. In der Antike war es anscheinend üblich, den Opfern bei der Hinrichtung (z.B. Kreuzigung) myrrhe- und weihrauchhaltigen Wein zu reichen, um deren Leiden zu dämpfen. Der Babylonische Talmud (Synhedrin VI.) überliefert jedenfalls die Forderung des Rabbi Hisdas, den zur Hinrichtung Hinausgeführten Wein und Weihrauch zu geben, damit ihr Bewusstsein verwirrt werde. Die Hippokratiker (d.s. die Schüler und Nachfahren des berühmten Arztes Hippokrates und seiner Ärzteschule von Kos) setzten den Weihrauch ein bei Asthma, Unterleibsleiden und äußerlich bei verschiedenen Hautleiden und zudem verwendeten sie Weihrauch auch zur Herstellung von kosmetischen Salben. Auch Paracelsus lobte die wichtigen Heilswirkungen des Weihrauchs (/-harzes). Der berühmte griechische Philosoph und Naturforscher Theophrast(us) von Erosos (371-287 v.Chr.; er war wohl der bekannteste Schüler des großen Aristoteles; er gilt als der Begründer der wissenschaftlichen Botanik) widmete dem Weihrauch in seinem Werk „Historia plantarum“ (Pflanzengeschichte) eine ausführliche medizinische Beschreibung. Bis weit in die Neuzeit - zumindest aber bis Ende des 18. Jahrhunderts - wurden zu Heilszwecken sowohl das bei der Verarbeitung anfallende Pulver als auch die Rinde des Weihrauch-Baumes und sogar selbst der „Weihrauch-Ruß“ zur Blutstillung, Wundheilung und bei Geschwüren benutzt. In den berühmten Destillier-Büchern des 16. Jahrhunderts wird der Weihrauch als Bestandteil bei der Destillation zusammengesetzter Balsame erwähnt; so mehrmals von B.C. Gessner und auch vom Straßburger Arzt Hieronymus Brunschwig. Aber auch zur Herstellung von Riechstoffen und Pflanzenextrakten und zur Herstellung von Balsamen mit Weihrauch als Bestandteil ist bereits in den Berichten des „arabischen Chemikers“ Abu Mansur (Ende des 10. Jahrhunderts) die Rede und auch in denen von Abu Clasis (ebenfalls um 1000 n.Chr.). Weihrauch-Öl findet erstmals Erwähnung in der Berliner Apotheker-Taxe von 1574 und zwar als „Oleum thuris“ und ferner mit gleicher Benennung im Dispensatorium Noricum von 1589. Abschließend noch einmal zurück zur traditionellen indischen Medizin - Ayurveda -: Von Anbeginn dieser indischen ganzheitlichen Heilkunde ist der Indische Weihrauch (Boswellia serrata) - und dies ist auch so geblieben bis zum heutigen Tage - ein wichtiges Heilmittel; dabei heute im Handel unter der Bezeichnung „Sallaki“ (Hersteller: Gufik Ltd., Bombay/Mumbay). Es handelt sich dabei um in Tabletten gepresstes Roh-Harz (im Handel in zwei Dosierungen: je Tbl. mit 200 und 400 mg Droge). Wenden wir uns nunmehr der Gegenwart und der Bedeutung von Weihrauch in der Medizin zu. Ich darf nochmals wiederholen, dass heute für viele Anwendungen wissenschaftlich bestätigt ist, was früher reine Erfahrung war. Das wird Sie sicherlich überraschen!
… und in der Gegenwart optimiert!
O
hne meinerseits auch nur eine Sekunde allzu enthusiastisch über Weihrauch und seine Anwendungsmöglichkeiten in der ganzheitlichen Medizin zu schreiben - das sollte ruhig der
Yellow Press
überlassen bleiben - darf ich dennoch - und dabei übernehme ich lediglich den Titel einer wissenschaftlichen Arbeit von Prof. Dr.
H.P.T. Ammon
(publiziert in der Fachzeitung „therapeutikon“ aus dem Mai 1993) - gleich zu Beginn feststellen und festhalten:
„
Neue Wirkungsprinzipien aus dem Weihrauch“.
Um es gleich eindeutig festzuschreiben:
Die (Heil-)Pflanze „Weihrauch“ - bzw. deren Inhalts- und Wirkstoffe - ist weder das
„unschlagbare Wundermittel“
für etliche Krankheiten und Gebrechen noch das krasse Gegenteil davon, also lediglich ein
„Placebo“
!
Wie schon immer in der gesamten, zumal der verantwortungs-bewussten und ethisch-moralisch fundierten, Heilkunde (Medizin), so gilt auch für den Weihrauch uneingeschränkt, zuallererst einmal die Grenzen der Anwendung zu kennen und dies auch uneingeschränkt zu beachten und einzuhalten!
Daher will, werde und kann ich mich hier auch nicht kritik- und kommentarlos Aufmachern und Headlines in den Medien anschließen, weil hier vielmals überzeichnet, verallgemeinert und auf wenige Aussagen reduziert wird und so (schon wieder einmal) zu schnell (um nicht zu sagen: vorschnell) und ungeprüft Hoffnungen geweckt werden!
Ich werde mich daher und zwar konsequent an Wissen und Erfahrungen und insbesondere auch an die neuesten mir bekannten Untersuchungen und Forschungen halten.
Gehen wir Schritt-für-Schritt vor. Und einzig bezogen auf die medizinische - sprich therapeutische - Anwendung des Weihrauchs in der gegenwärtigen Medizin soll hier reflektiert werden. Später dann - in einem eigenständigen Kapitel - dann aber auch noch zu und über weitere Möglichkeiten des Weihrauch-Gebrauchs, so in der Körperpflege und der Kosmetik.
Z
uerst aber einmal zum harten
„medizinischen Alltags-Geschäft“
:
Hier gilt es zuerst einmal und erneut einen Fundus, einen Grundstock, an Kenntnissen zu vermitteln. Das heißt, Ihnen die wichtigsten Wirkungen & Wirkungsweisen der im Weihrauch enthaltenen Substanzen (= Wirkstoffe) näher zu bringen. Die im Weihrauch enthaltenen Wirkstoffe bzw. Wirkstoff-Gruppen wurden bereits an früherer Stelle („Weihrauch: Weit mehr als Rauch“) global vorgestellt und am Ende des Büchleins („Das sollten Sie wissen“ …) finden Sie noch weitere Erläuterungen zu den Wirkstoffgruppen (z.B. dem ätherischen Öl); dies aber dann ganz allgemein und für die jeweiligen (Wirk-)Stoffe gültig und somit einheitlich für deren Vorkommen in den unterschiedlichsten Pflanzen usw. …
Jetzt aber geht es darum, Ihnen die „heilende“ (medizinische) Wirkung dieser Inhaltsstoffe im Weihrauch in der Medizin - dies ganz allgemein und generell und im Prinzip für alle „Medizinrichtungen“ - vorzustellen und dies dann auch für die Anwendung in der Heilkunde und für die einzelnen Beschwerden und Krankheiten bzw. Indikationen zu notieren.
D
okumentiert sind die Wirkungen der Inhaltsstoffe im Weihrauch mittlerweile weltweit durch zahlreiche Untersuchungen & Forschungsarbeiten und bestätigt durch unzählige Anwendungen in der Me-dizin. Seit Mitte der 1980er Jahre und ganz besonders intensiv seit Anfang der 1990er Jahre ist es zu einem regelrechten „Boom“ in der Weihrauch-Forschung gekommen. Das Gesamt-Resultat aller dieser Forschungen - und ein Ende dieser Untersuchungen ist derzeit nicht abzusehen - mit den unterschiedlichsten Ansatzpunkten ist, dass sich auch in der wissenschaftlichen Medizin („Schulmedizin“) - wenngleich dort nur zögerlich & zaghaft (wie stets bei möglichen Übernahmen aus der Naturmedizin) - ein absoluter Wertewandel, ja, ein Paradigmen-Wechsel eingestellt hat bzw. langsam einstellt.
Fakt ist, dass
Weihrauch nicht nur als Substanz zu sakralen Handlungen und höchstens noch als Duftstoff angewendet wird, sondern, dass er definitiv seine Berechtigung in der Medizin (wieder) gefunden hat, so wie er früher fester Bestandteil der Heilkunde war!
Absolutes Indiz für die Wertigkeit & Gewichtung des Weihrauchs in der
„Medizin von Heute“
ist, dass der hochangesehene
„Rudolf-Fritz-Weiss-Preis 1996“
für eine solche wissenschaftliche Arbeit zur Boswellia-Forschung verliehen wurde.
Die Wieder- und auch Neu-Entdeckung des Weihrauch (-harzes) zu medizinischen Zwecken hat - leider von der breiten allgemeinen Öffentlichkeit aber auch den allermeisten Fachleuten unbemerkt - seinen Widerhall in den Medien gefunden; nicht nur in der „Regenbogenpresse“, sondern auch zunehmend in namhaften und angesehenen Presseorganen und besonders auch in der Fachliteratur!
So befasste sich die TV-Sendung
„Akte 97“
(SAT 1) unter dem Titel
„Gegen Rheuma ist ein Kraut gewachsen - Neue Wege in der Rheumabehandlung“
eingehend mit Weihrauch.
Die Tageszeitung
„DIE WELT“
titelte
„Forschern gelingt Fortschritt in der Tumor-Behandlung“
.
Aus dem gleichen Hause - Springer-Verlag - erschien dann in der
„BILD“
ein Artikel unter
„Weihrauch-Extrakte heilen Gehirn-Tumore“
.
In der
ALLGEMEINEN PRESSE HANNOVER“
war zu lesen
„In das Harz des Weihrauchbaumes setzen Ärzte große Hoffnung“
.
Aber auch in Fachorganen wurden etliche Publikationen zum Thema Weihrauch veröffentlicht.
Das Fachorgan
„Geriatrie-Praxis“
veröffentlichte die mit dem o. gen. R.-F.-Weiss-Preis ausgezeichnete Arbeit.
Im Fachorgan
„Umwelt-Wissenschaft-Technik“
war zu lesen
„Säuren des indischen Weihrauchbaumes hemmen gefährliche Botenstoffe“
.
In der
„Deutschen Ärztezeitung“
fand sich eine Veröffentlichung unter
„Boswellia-Pflanzenextrakt wirkt bei Colitis“
.
Zuletzt noch soll die
„DAZ“
(Deutsche Apotheker Zeitung) zitiert sein, die einen Artikel veröffentlichte unter dem Titel
„Wirbel um Weihrauch - wirksam gegen entzündliche Erkrankungen“
.
Noch weitere Fachartikel sind in dieser
Fachzeitung
erschienen, so u.a. Publikationen von Prof. Dr.
H.P.T. Ammon
(s.u.).
Um die Weihrauchforschung hat sich besonders verdient gemacht Prof. Dr.
H.P.T. Ammon
(Uni Tübingen) in seinen Forschungen und Publikationen, so u.a.
„Boswelliasäuren - Hemmstoffe der Leukotrien-Biosynthese“
und auch in der wissenschaftlichen Gemeinschaftsarbeit von
Ammon
mit
T. Mack, G.B. Singh
und
H. Safayhi
„Inhibition of leucotriene B formation in rat peritoneal neutrophils by an ethanolic extract of the gum resin exsudate of Boswellia serrata“
; aber auch zu nennen
S. Ammon
mit
„Weihrauch - ein pflanzliches Antirheumatikum“
; ferner
Chr. von Keudell
mit
„Therapie mit Boswelliasäuren [Weihrauch] - eine Ergänzung oder sogar Alternative in der Therapie auto-aggressiver Erkrankungen“
; dann die Forschergruppe
H. Letzel, W. Koepcke, W. Kriegel, S. Wassenberg
und andere mit
„Klinische Wirksamkeit des Weihrauchpräparates H15 bei rheumatoider Arthritis: ein neues Therapieprinzip durch spezifische 5-Lipoxygenase-Inhibition?“
(Vortrag auf der 26. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie, Berlin, 1994) oder auch
H. Wagner
(LTU München),
E. Jordan
,
W. Knaus
in
„Pflanzeninhaltsstoffe mit Wirkung auf das Komplementsystem“
.
Außerdem sollen noch zitiert sein die wichtigen Arbeiten von Prof. Dr.
Th. Simmet
(Uni Bochum) wie u.a.
„Weihrauch gegen Hirntumoren?“
. Mit demselben Thema und gleicher Fragestellung beschäftigten sich auch die beiden Forscher
Böker
und
M. Winking
in
„Die Rolle der Boswelliasäuren in der Therapie maligner Gliome“
;
Winking
und
Simmet
haben gemeinsam mit
Heldt
eine weitere Arbeit publiziert
„Cysteinyl-leukotrienes as potential mediatores of the peritumoral brain oedema in Astrozytoma patients“
.
Nochmals soll zitiert sein Dr.
Dieter Martinetz
, Leipzig, mit
„Der Indische Weihrauch - neue Aspekte eines alten Harzes“
und den Abschluss soll bilden erneut Prof. Dr.
Ammon
mit
„Neue Wirkungsprinzipien aus dem Weihrauch“
.
Zu nennen sind auch noch etliche weitere Arbeiten von
Ammon
alleine und gemeinsam mit türkischen und indischen Forschern & Wissenschaftlern.
Zu nennen aber - da hier ein weiteres Anwendungsgebiet untersucht wurde - die Arbeit (des von seinen TV-Sendungen im ZDF sehr vielen Menschen gut bekannten Arztes Dr. med.
M. Gerhardt
) mit
„Therapie mit Boswellia-Säuren [Weihrauch H15] - eine Ergänzung oder Alternative in der Behandlung von CED
“ (CED = Chronisch-Entzündliche Darmerkrankungen)“.
Bemerkenswert die gemeinsame Arbeit von
I. Gupta, A. Parihar, P. Malhotra, G.B. Singh, H. Safayhi, H.P.T. Ammon
und
R. Lüdtke
- veröffentlicht im renommierten
European Journal of Medical Research
im Jahre 1997 -
„Effects of Boswellia serrata gum resin in patients with ulcerative colitis“
.
Einerseits hochinteressant und zudem amüsant zu lesen ist die Veröffentlichung von
D. Martinetz, K. Lohs
und
J. Janzen
aus dem Jahre 1989
„Weihrauch & Myrrhe: Kulturgeschichte und wissenschaftliche Bedeutung: Botanik, Chemie, Medizin“
.
So findet sich bereits im
Lehrbuch der biologischen Heilmittel
des bekannten Arztes Dr.
G. Madaus
- er ist übrigens Begründer des nach ihm benannten biologischen Heilmittelwerkes Madaus AG (zuerst Leipzig und seit Weltkrieg-II-Ende in Köln) und er war wohl einer der profundesten Kenner und Könner der naturheilkundlichen Medizin und der Heilpflanzen in seiner Zeitepoche - eine imposante Abhandlung über den Weihrauch.
Aber auch im Standardwerk der Pharmakologen -
Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis
(für Ärzte, Apotheker, Arzneimittelhersteller, Medizinalbeamte, Forscher …) findet sich eine ausführliche Beschreibung der Weihraucharten und der enthaltenen Wirkstoffe.
Noch früheren Datums sind die Veröffentlichungen von
C. Wehmer
-
„Die Pflanzenstoffe“
, 1931 - und von
H. Thoms & W. Brandt
-
„Handbuch der praktischen und wissenschaftlichen Pharmazie“
1931 -.
Die älteste Publikation, die sich bei meinen Studien und Recherchen hat finden lassen, datiert aus dem Jahre 1906 und ist veröffentlicht worden unter
„Vegetationsbilder“
von
G. Karsten
und
H. Schenk
.
Aber auch amtlicherseits wurde sich mit Weihrauch(harz) bzw. den verschiedenen Spezies befasst:
So veröffentlichte in seinem Bundesanzeiger [BAnz Nr. 242a vom 28.12. 1988] das BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte - früher Bundesgesundheitsamt BGA – Bonn, zuvor Berlin) eine Monographie - d.i. eine Pflanzenbeschreibung - der zuständigen Kommission D.
Halten wir fest:
Aus und von allen diesen genannten und weiteren ungenannten wissenschaftlichen Arbeiten wurden die dort festgehaltenen Ergebnisse und Wirkungen sowie Wirkungsweisen von mir in komprimierter Form in diesem Buch übernommen.
M
achen wir also den Anfang mit den
Einzelwirkungen der Inhalts- bzw. Wirkstoffe im Weihrauch.
Ganz vorne müssen dabei stehen die
Boswellia-Säuren
. Ohne an dieser Stelle noch einmal auf die im Weihrauchharz enthaltenen verschiedenen Boswellia-Säuren erneut einzugehen, denn dies ist spezifisch-spezielles Fachwissen (vgl. „Das sollten Sie wissen“ … und auch zu Beginn des Buches), soll festgehalten sein: Die Boswelliasäuren sind hochpotent in ihren Wirkungen und so wirksam auf unterschiedliche Weise bei den verschiedenen Krankheitsbildern!
B
evor ich definitiv zur Sache komme, muss ich schon wieder unterbrechen und erneut eine Erklärung einschieben:
Ohne diese würde das Verständnis für den interessierten Laien noch schwerer als es ohnehin schon ist.
Bei der Aufzählung der Fachpublikationen ist Ihnen bereits mehrmals der Fachterminus
„Leukotriene“
begegnet; außerdem der Begriff
„5-Lipoxygenase“
. Bei den Leukotrienen und der 5-Lipoxygenase liegen wichtige und für die Heilwirkung wesentliche Angriffspunkte der Boswelliasäuren (oder auch Boswellin-Säuren) vor.
Außerdem muss der Begriff
„Entzündung“
allgemein-verständlich beschreiben und erklärt werden.
B
eginnen wir mit
„Entzündung“
- hier übernehme ich wortgetreu, abgesehen von kleinen Ergänzungen und Anmerkungen, die Definition aus der Arbeit von Prof. Dr.
H.P.T. Ammon „Neue Wirkprinzipien aus dem Weihrauch“
[therapeutikon, 7 (5) 210-212, Mai 1993]:
… „
eine
Entzündung
ist eine physiologische (natürliche und normale) Reaktion des Körpers bzw. seiner Organe oder Gewebe auf eine Noxe (Schadensreiz), die letztlich zur Schädigung bzw. dem Tod von Zellen oder Geweben oder Organen führt. Solche schädigenden Ereignisse können sein Hitze, Kälte, Strom, Verätzung, sonstige chemische wie physikalischen Einwirkungen, Insektenstiche, Verletzungen & Operationen, Infektionskeime und … vieles andere mehr! Der Körper setzt sich gegen diese Noxen mit der Entwicklung einer Entzündung - im Sinne einer körper-, organ- bzw. gewebe-spezifischen Gegenreaktion (Abwehrreaktion) - zur Wehr.
Ein jeder Entzündungsvorgang hat dabei zwei Aufgaben:
Einmal die Beseitigung von Zelltrümmern aus toten Zellen - d.i. die
„katabole Phase“
- und zweitens die Bildung von Reparatur- oder Narbengewebe - d.i. die
„anabole Phase“
-. Letztere führt dann zur Abheilung der Entzündung, meist nur als reine Reparatur des Defektes.
Ein jeder Entzündungsvorgang ist gekennzeichnet durch Rötung (Rubor), Schwellung (Tumor * Anmerkung hierzu: diese Bezeichnung im Zusammenhang mit einer Entzündung nicht verwechseln mit der Bezeichnung „Tumor“ für eine Gewebeneubildung [z.B. gut- oder bösartiges Gewächs], obgleich dies im strengen Sinne ja auch eine Schwellung ist!), Wärme (Calor) und Schmerz (Dolor) und außerdem noch durch eine eingeschränkte Funktion des betroffenen Gewebes/Organs (Functio laesa).
Der Schmerz stellt das Warnsignal für das Individuum dar; Rötung und Schwellung und (Über-)Wärmung sind Zeichen einer verstärkten Durchblut-ung und des Austritts von Flüssigkeit aus dem Kapillargebiet (Kapillare = die feinsten Blut- & Lymphgefäße) in das umliegende Gewebe.
Führt eine Entzündung letztlich zur Heilung des Schadens, so hat die Entzündung (Anmerkung: in der lateinischen medizinischen Fachsprache zu erkennen an den Namensendigungen auf „-itis“; z.B. Gelenkentzündung = Arthr
“itis“
* die nicht-entzündlichen Veränderungen enden auf „ose“, so z.B. Arthr
“ose“
) ihre Aufgabe erfüllt.
Macht sich aber eine Entzündung selbständig und ohne erkennbaren Nutzen und führt dabei und dazu eher zu einer weiteren/stärkeren Schädigung - z.B. von Gelenken oder von Schleimhäuten (z.B. der Bronchialschleimhaut) -, so ist der Entzündungsprozess eigentlich unsinnig, ja sogar schädlich geworden; es bedarf dann therapeutischer Eingriffe - z.B. Medikamente, Operationen usw. -, um diesen Prozess zurückzudrängen und um weitere Schädigung zu verhindern.
Die an der Entzündung beteiligten Vorgänge - die oben mit den 5 Symptomen geschildert wurden - werden ausgelöst und auch unterhalten bzw. verstärkt durch die sog.
„Entzündungs-Mediatoren“
[Mediator(substanz) = chemischer Vermittler- oder Überträgerstoff, der die entsprechenden Gewebe-Antworten auslöst; sie bewirken Bildung von Antigen-Antikörper-Mediator-Komplexen, die zur Aktivierung der Komplementsystem-Kaskade befähigt sind]. Es handelt sich also um chemische Substanzen, welche in kleinsten Mengen meist am Ort der Entzündung entstehen und die dann den Schmerz, die Steigerung der Durchblutung, die erhöhte Permeabilität (= Durchlässigkeit eines Gewebes, einer Zelle usw. für Substanzen/ Substrate/Stoffe), die Anlockung von Leukozyten (= weiße Blutkörperchen) zum Zwecke der Phagozytose (d.i. die aktive Aufnahme von Partikeln in das Innere einer Zelle und hier dann die Eliminierung von Fremdelementen; v.a. ein
Mechanismus der unspezifischen Infektions-Abwehr
) usw. bewerkstelligen.
Solche Mediatoren einer Entzündung können sein:
Bradykinin, Histamin, Thromboxan, Hydroxy-Fettsäuren, Lysosomale Enzyme, Lymphokinine, Prostaglandine und die
Leukotriene
. Sie alle zählen zur sog.
„Arachidonsäure-Kaskade“
(Arachidonsäure = d.i. eine vierfach-ungesättigte essenzielle = lebenswichtige Fettsäure; sie wird enzymatisch umgesetzt u.a. zu den o. gen. Mediatoren).
Quasi als „Zwischenruf“ - insbesondere für das allgemeine Verständnis von
„Entzündungsprozessen“
im Allgemeinen und die nachgehend noch zu beschreibende (Ein-)Wirkung der Leukotriene im Besonderen - hier zunächst einige wenige aber wichtige Anmerkungen über und zum
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.