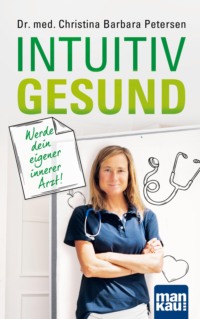Kitabı oku: «Intuitiv gesund. Werde dein eigener innerer Arzt!», sayfa 2
Reflexion und Erkenntnis
Aufgewacht aus diesem Albtraum bin ich, als ich mir das erste Mal in meinem Leben eine Auszeit genommen habe. Zunächst hat das natürlich keiner in meinem Umfeld verstanden, aber ich wusste, dass ich diese Zeit für mich brauchte. In dieser Zeit habe ich mich nur mit mir selbst beschäftigt, habe alles hinterfragt: mein Studium, meinen Job, meine Familie, das System. Ich zog mich von allem zurück und hörte in mich hinein. Und das war das Beste, was mir passieren konnte.
In dieser Zeit merkte ich, dass ich selbst es war, die sich das Leben schwer machte. Nicht meine Eltern, die Schule, das Studium oder die Facharztausbildung. Ich selbst hatte den Glaubenssatz, nicht genug zu sein, verinnerlicht.
Ich begann, mich zu befreien, mich aus der Opferhaltung zu lösen und wieder die Verantwortung für mich, mein Leben und meinen Veränderungsprozess zu übernehmen. Ich lernte wieder, auf die Signale meines Körpers zu hören, stoppte automatisch all die Dinge, die mir und meinem Körper schadeten, und kümmerte mich um mich und meine eigene Gesundheit. Ich kämpfte nicht mehr gegen mich selbst an.
In der Zeit merkte ich auch, dass ich mich selbst am besten verstehen und heilen konnte. Denn nur ich selbst wusste, was gut für mich war. Ich beschäftigte mich intensiv mit Persönlichkeitsentwicklung. Ich wollte erst mal herausfinden, worauf es mir im Leben wirklich ankommt bzw. was mir guttut, denn das hatte ich vor lauter Selbstaufgabe völlig vergessen. In dieser Zeit entdeckte ich die Traditionelle Chinesische Medizin, durch die ich wieder lernte, die Rhythmen der Natur wahrzunehmen, ganz genau auf meinen Körper zu hören und mich wertzuschätzen und gut zu behandeln. Ich blühte auf einmal auf, weil ich nach den Signalen meines Körpers lebte und verstand, dass er mit mir zusammenarbeitete, mit mir kommunizierte und ich nicht gegen ihn arbeiten musste. Ich fing an, eine Idee davon zu bekommen, dass das Leben einfach sein konnte, wenn ich anfing, meinen Körper zu verstehen. Ich musste einfach nur leise genug sein, um die Signale zu hören.
Seitdem brauchte ich nicht ständig Leute um Rat zu fragen, sondern ich befragte einfach mich selbst. Ich habe alles zur Traditionellen Chinesischen Medizin aufgesogen und mich selbst behandelt, wodurch meine Migräne verschwand. Auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis habe ich meine Kenntnisse eingesetzt und erstaunliche Erfolge erzielt. Gleichzeitig war mir von Anfang an klar, dass ich für Notfälle und akute Medizin immer auf die Schulmedizin zurückgreifen würde. Gestärkt durch die neuen Impulse setzte ich meine Facharztausbildung schließlich mit einer ganz anderen inneren Einstellung fort und beendete diese schließlich erfolgreich nach insgesamt sechs Jahren ärztlicher Tätigkeit.
Meine Vision ist es heute, ein größeres Bewusstsein für das Thema Arztgesundheit in der Bevölkerung zu schaffen. Folgende Punkte sind mir dabei besonders wichtig:
 Ich möchte, dass Ärzte anerkennen, dass sie auch mal krank sein dürfen und dass das keine Schwäche ist.
Ich möchte, dass Ärzte anerkennen, dass sie auch mal krank sein dürfen und dass das keine Schwäche ist.
 Ich wünsche mir, dass Ärzte lernen, auf ihren Körper zu hören, die Bedürfnisse wahrzunehmen, zu erfüllen und für sich zu sorgen.
Ich wünsche mir, dass Ärzte lernen, auf ihren Körper zu hören, die Bedürfnisse wahrzunehmen, zu erfüllen und für sich zu sorgen.
 Ich möchte, dass Ärzte lernen, Pausen zu machen, damit sie besser mit dem steigenden Druck in der Arbeit umgehen können.
Ich möchte, dass Ärzte lernen, Pausen zu machen, damit sie besser mit dem steigenden Druck in der Arbeit umgehen können.
 Ich wünsche mir, dass sich statt Konkurrenzkampf ein Zusammenhalt in der Ärzteschaft entwickelt, ein Miteinander und eine gegenseitige Fürsorge.
Ich wünsche mir, dass sich statt Konkurrenzkampf ein Zusammenhalt in der Ärzteschaft entwickelt, ein Miteinander und eine gegenseitige Fürsorge.
All das ist möglich! Es geht darum, in die Selbstermächtigung zu kommen und nicht länger das zu erfüllen, was uns von der Klinikleitung oder der Politik gesagt wird. Wir dürfen uns selbst für unsere Gesundheit und unsere Zukunft einsetzen. Durch Achtsamkeit, Fokussierung und zum Beispiel Präventionsprogramme können wir wieder zu gesünderen Ärzten werden, die acht auf sich selbst geben und wieder als Vorbild für unsere Patienten fungieren. Während meiner Zeit der Reflexion und der Persönlichkeitsentwicklung habe ich gemerkt, dass es keinen Sinn macht, passiv abzuwarten, was passiert. Es wird niemand mit einem Zauberstab kommen, um uns zu retten. Wir müssen aufstehen und uns gemeinsam starkmachen für mehr gesunde Ärzte – Healthy Docs. Gleichzeitig habe ich festgestellt, dass es nicht nur Ärzte betrifft. In allen sozialen Branchen arbeiten Menschen bis zum Ausgebranntsein. Im Folgenden möchte ich näher darauf eingehen, warum das so ist.
Sackgasse Helfermentalität
In keinem anderen Bereich verkaufen sich so viele Menschen unter Wert wie im sozialen. Lange Zeit habe ich mich gefragt, warum Mediziner (oder auch Mitarbeiter in anderen sozialen Berufen wie z. B. Pfleger, Sozialarbeiter usw.) das mit sich machen lassen.
Klar, Gesundheit ist das höchste Gut, und man kann die Arbeit am Menschen nicht mit Büroarbeit vergleichen, vor allem deshalb ist ein Verweigern oder Nicht-Antreten des Dienstes aus moralischer Sicht nur schwer zu rechtfertigen. Trotzdem ist mir aufgefallen, dass ein Großteil des medizinischen Personals seine eigenen Bedürfnisse weder erfüllt noch wahrnimmt. So bin ich auf das Thema Arztgesundheit gestoßen, und mir ist klar geworden, dass viele Mitarbeiter im medizinischen System eine besondere Persönlichkeit haben. Ich möchte hier nicht den Eindruck erwecken, dass ich von einer in Stein gemeißelten Tatsache spreche. Vielmehr geht es mir um meine eigenen Erfahrungen und Eindrücke, die ich im Laufe meiner mittlerweile 35 Jahre im Kontakt mit anderen Menschen gesammelt habe.
Der Begriff »Helfersyndrom« geht auf den Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer zurück, der bereits 1977 in seinem Buch »Hilflose Helfer« davon berichtete. Ein vom Helfersyndrom Betroffener ist mit seiner Aufmerksamkeit nicht bei sich selbst, sondern bei den Befindlichkeiten seiner Mitmenschen. Wenn er einem Kranken hilft, geht es ihm besser. Das Helfen bzw. Gebraucht-werden-Wollen wird zur Sucht. Laut dem Modell von Schmidbauer hat ein vom Helfersyndrom Betroffener ein geringes Selbstwertgefühl und ist auf seine Helferrolle fixiert. Die Hilfsbereitschaft geht bis zur Aufopferung und Vernachlässigung der eigenen Gesundheit, Hobbys, Familie und Freunde. Dadurch kann es zum Burn-out oder zur Depression kommen. Zu den Risikogruppen zählen die genannten Personen, die dann gehäuft zur entsprechenden Berufswahl greifen. Den Persönlichkeitsstrukturen liegen häufig biografische Erfahrungen zugrunde, die den Eigenwert des Betroffenen infrage stellen.
Menschen mit einer Helfermentalität wählen aus folgendem Grund häufig unterbewusst einen Helferberuf: Wenn sie immer nur bei den Bedürfnissen der anderen sind, müssen sie ihre eigenen »Themen« nicht sehen, es erlaubt ein »Ausblenden« der eigenen »Baustellen«.
Das Bedürfnis zu helfen ist grundsätzlich etwas Positives und ein natürlicher und gesunder menschlicher Wert. Das gilt auch dann, wenn zeitweilig eigene Interessen hintangestellt werden. Es gilt, eine gesunde Balance zwischen Geben und Nehmen zu entwickeln und beim Helfen auch die eigenen Wünsche, körperlichen Bedürfnisse und Grenzen sowie auch den Nutzen und die Bedürfnisse desjenigen, dem man Hilfe zukommen lässt, zu beachten. Verliert der Helfende das Bedürfnis des anderen wie auch seine eigenen Wünsche, Ziele und körperlichen Grenzen aus dem Blick und hilft vor allem deshalb, um die eigene Person aufzuwerten, wird sein Helfen pathologisch.
Während solidarische Hilfe sich am Nutzen des Hilfeempfängers orientiert, ist pathologische Hilfe auf unbewusste psychologische Bedürfnisse des Helfers ausgerichtet.2 Meist wird das Muster, sich von der Anerkennung durch andere abhängig zu machen, bereits in der Kindheit erlernt. Betroffene halten sich nur dann für liebenswert und wertvoll, wenn sie sich opfern und dafür Bestätigung durch andere bekommen und so eine Aufwertung ihres Selbst erfahren (Märtyrerrolle). Dabei verlernen sie, ihre eigenen Wünsche, Bedürfnisse und körperlichen Grenzen zu sehen wie auch selbst Hilfe anzunehmen.3 Ein wirksamer Helfer, im Sinne eines reifen und partnerschaftlichen Verhaltens, wird dem Opfer »nur« zur Selbsthilfe verhelfen. Falls notwendig, wird er das Opfer auch aus der Schusslinie nehmen, aber ihm immer nur so weit Hilfe geben, bis die Person sich wieder selbst helfen kann.
Das Thema Arztgesundheit rückte erst im Jahre 2017 durch eine Fortbildung der Ärztekammer zu diesem Thema, die von Herrn Professor Dr. med. Braun und Herrn PD Dr. Langs gehalten wurde, in meinen Fokus. Den Begriff der Arztgesundheit gibt es noch gar nicht so lange, und im Internet ist nicht viel dazu zu finden. Daraus leite ich ab, dass die Begrifflichkeit erst in das Bewusstsein der Menschen rücken muss. Das kann etwas Zeit in Anspruch nehmen. Meines Erachtens ist das Thema sehr wichtig. Denn die Ärzte befinden sich nach wie vor in einer Schlüsselposition und erfüllen eine Vorbildfunktion. Deshalb stellen sie bildlich gesehen die Wurzel dar. Wenn die Wurzel einer Pflanze nicht gesund ist, kann die ganze Pflanze nicht gesund sein. Deshalb ist es so unglaublich wichtig, an der Wurzel anzusetzen und den Ärzten wieder zu mehr Gesundheit zu verhelfen, damit wir alle davon profitieren.
Ich habe bei einigen Ärzten (und auch anderem medizinischem Fachpersonal) besondere Persönlichkeitsmerkmale festgestellt, die gehäuft auftreten:
 Hoher Selbstanspruch
Hoher Selbstanspruch
 Perfektionismus
Perfektionismus
 Hohe Leidensbereitschaft
Hohe Leidensbereitschaft
 Mangelnde Selbstwahrnehmung und Selbstfürsorge
Mangelnde Selbstwahrnehmung und Selbstfürsorge
 Ausgeprägte Empathie und fehlende Abgrenzung
Ausgeprägte Empathie und fehlende Abgrenzung
 Großes Verantwortungsgefühl
Großes Verantwortungsgefühl
 Neigung zu schlechtem Gewissen und Schuldgefühle
Neigung zu schlechtem Gewissen und Schuldgefühle
Die Kombination dieser Eigenschaften in Verbindung mit den immer höher werdenden Anforderungen der Arbeit führt dazu, dass Ärzte anfällig dafür sind, sich selbst nicht wahrzunehmen und sich für andere aufzuopfern. So sind sie wenig bei sich und ihren eigenen Bedürfnissen, dafür mehr im Außen und bei den Bedürfnissen der anderen. So verlieren sie das Gefühl zum eigenen Körper, d. h. sie akzeptieren die eigenen Bedürfnisse nicht, sondern kämpfen dagegen an. Sie haben nicht gelernt, die körpereigenen Signale wahrzunehmen, und sind viel zu sehr im Kopf. Das führt dementsprechend schneller zur Selbstaufgabe, einer Verausgabung der eigenen Kräfte und damit zum Burn-out.
Dieser Prozess wird durch die aktuelle Situation des Fachkräftemangels noch verstärkt.
Verstaubte Strukturen
Schwierigkeiten, vor denen wir Mediziner stehen, sind die alten Glaubenssätze, die als ungeschriebene Gesetze in den Kliniken von Generation zu Generation weitergegeben wurden: Der Mythos vom unverwundbaren Helfer ist so tief verankert, dass wir ungern Schwäche zeigen. Gerade die eigene Verwundbarkeit ist ein schambehaftetes Thema. Dazu kommt, dass in Zeiten des Fachkräftemangels nur ungern Kollegen »im Stich« gelassen werden. Daher gehen wir Ärzte lieber krank zur Arbeit, um die Versorgung aufrechtzuerhalten. Genau diese Verhaltensweise wurde uns bereits im Studium eingeimpft, denn wer Fehlzeiten durch Krankheiten hatte, musste das Semester wiederholen.
Wir wurden also so »erzogen«, in dem System wie »fleißige Ameisen« zu funktionieren. Es gab weder Kurse noch Vorgesetzte, die uns lehrten, auf uns selbst und unsere eigene Gesundheit zu achten. Im Gegenteil: Wir wurden konsequent geschult, die Bedürfnisse und Probleme der Patienten wahrzunehmen, um dann eine Hilfestellung anzubieten. Dieser einseitige Fokus führte dann weitergehend dazu, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse vernachlässigten. Meines Erachtens fehlt im Studium die Basis: die Selbstfürsorge. Nur derjenige, der seine eigenen Bedürfnisse kennt, sie beachtet und sich versorgen kann, kann dann im nächsten Schritt anderen helfen.
Eine Herausforderung, vor der wir Mediziner stehen, ist die moralische Verpflichtung. Einem Hilfsbedürftigen steht aus moralischer Sicht Hilfe zu – das geht sozusagen vor. Da melden sich sonst ganz schnell das schlechte Gewissen und die Schuldgefühle. Und auch die eigene Verwundbarkeit spielt wieder eine Rolle: Ich möchte ja schließlich auch, dass mir geholfen wird, wenn ich in Not bin. So fällt es Medizinern oft leichter, andere Menschen zu versorgen, als die eigenen Bedürfnisse zu achten.
Eine weitere Schwierigkeit sind die psychischen Herausforderungen, die mit Krankheit und Tod verbunden sind. Diese Erlebnisse konfrontieren uns immer wieder mit dem menschlichen Verfall und der eigenen Vergänglichkeit.
Wenn diese Erlebnisse seelisch verarbeitet werden, sehe ich darin viel Potenzial zu persönlichem Wachstum. Oftmals ist für eine Reflexion weder Zeit noch ein Ansprechpartner da. Kein Wunder, dass sich bei diesen gefährdeten Helferpersönlichkeiten seelische Wunden psychisch oder körperlich bemerkbar machen.
Da viele Ärzte die Signale des Körpers überhören und nicht auf ihre eigenen Bedürfnisse achten, bedienen sie sich schnell mal der ihnen ständig verfügbaren Medikamente, um die Symptome zu bekämpfen – damit sie wieder funktionieren können. Sie diagnostizieren und behandeln sich selbst und gehen ungern zu Kollegen, weil sie auch hier die eigene Schwäche nicht zugeben möchten und nicht als Simulant wahrgenommen werden wollen.
Es gibt also niemanden, der sie krankschreibt oder nach Hause schickt. Denn als Kollege bist du heutzutage bei bestehender Arbeitsbelastung zum Schutz der eigenen Gesundheit darauf angewiesen, dass jede Arbeitskraft anwesend ist. Es gibt keine Definition von »unfit to work«. Leider gibt es auch kein positives Vorbild, denn alle Vorgesetzten tragen dieselben Glaubenssätze in sich. Vor lauter Schuldgefühlen wird also lieber Rücksicht auf Kollegen und Patienten genommen und die eigene Gesundheit missachtet. So ist es kein Wunder, dass Ärzte ungesund leben und aufgrund der Selbstaufopferung Süchte entwickeln. Bedürfnisse, die den ganzen Tag unterdrückt werden, fordert der Körper dann in Ruhephasen im extremen Maße ein. Arbeit wird mit Verzicht und Selbstaufgabe verknüpft, was dazu führt, dass der Körper sich in der freien Zeit das nimmt, was gefehlt hat. Wenn z. B. Entspannung mit Alkohol und Rauchen verknüpft ist, kommt es zu vermehrtem Alkoholkonsum und Rauchen. Ebenso häufige Themen sind Erschöpfung wie Burn-out. Das hängt mit der Vernachlässigung der eigenen Bedürfnisse zusammen, hat aber auch noch andere Komponenten, die in der heutigen Zeit zugenommen haben:
 Die mangelnde Wertschätzung der psychisch und körperlich anstrengenden Arbeit führt zu Frust beim medizinischen Personal. In Deutschland haben wir zurzeit eine Arzt-und-Krankenhaus-Flat-Rate-Mentalität. Die Menschen haben keinerlei Überblick über die Kosten. Das führt dazu, dass in den Köpfen der Anspruch wächst, jederzeit direkt bedient zu werden. Wenn man sich in diese Perspektive versetzt, ist das nachvollziehbar, denn die Medien suggerieren diesen Zustand.
Die mangelnde Wertschätzung der psychisch und körperlich anstrengenden Arbeit führt zu Frust beim medizinischen Personal. In Deutschland haben wir zurzeit eine Arzt-und-Krankenhaus-Flat-Rate-Mentalität. Die Menschen haben keinerlei Überblick über die Kosten. Das führt dazu, dass in den Köpfen der Anspruch wächst, jederzeit direkt bedient zu werden. Wenn man sich in diese Perspektive versetzt, ist das nachvollziehbar, denn die Medien suggerieren diesen Zustand.
 Der demografische Wandel in Verbindung mit altersbedingten Erkrankungen und dem gleichzeitig bestehenden Ärztemangel führt zu einer zunehmenden Patientenzahl, wodurch der Druck im System steigt.
Der demografische Wandel in Verbindung mit altersbedingten Erkrankungen und dem gleichzeitig bestehenden Ärztemangel führt zu einer zunehmenden Patientenzahl, wodurch der Druck im System steigt.
 Die Privatisierung der Kliniken führt zu Einsparungsmaßnahmen mit gleichzeitiger Arbeitsverdichtung, was wiederum den Druck im System erhöht.
Die Privatisierung der Kliniken führt zu Einsparungsmaßnahmen mit gleichzeitiger Arbeitsverdichtung, was wiederum den Druck im System erhöht.
 Durch unsere Medien werden »Angstgedanken« verbreitet, was dazu führt, dass immer mehr Menschen direkt in die Notaufnahme kommen. Was fehlt, ist Aufklärung.
Durch unsere Medien werden »Angstgedanken« verbreitet, was dazu führt, dass immer mehr Menschen direkt in die Notaufnahme kommen. Was fehlt, ist Aufklärung.
 Durch die zunehmende Bürokratie vermindert sich der Arzt-Patienten-Kontakt, was beim medizinischen Personal zu einer Sinnkrise führt.
Durch die zunehmende Bürokratie vermindert sich der Arzt-Patienten-Kontakt, was beim medizinischen Personal zu einer Sinnkrise führt.
Lösungsansätze
Wir als Mediziner haben die Chance, diese Situation zu nutzen und unser Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Wir können über das Thema sprechen. Damit meine ich keinen Jammerklub, sondern konstruktive Diskussionen zu den Themen mit lösungsorientierten Vorschlägen zur Verbesserung. Wir können die Aufklärung selbst angehen, also mit offenen Karten spielen, offen kommunizieren und unseren Patienten mehr Eigenverantwortung zurückgeben. Wir können Hilfe zur Selbsthilfe lehren, anstatt die Patienten in einer Abhängigkeit zu halten.
Wir können reflektieren – also statt mitzumachen, was seit Jahren »eben so gemacht wird«, können wir hinterfragen und neue Ideen einbringen. Wir können nach vorn blicken und aus unseren Fehlern lernen. Wir können eine Kultur der Wertschätzung und gegenseitigen Fürsorge einführen: Wir dürfen uns wieder wertschätzen und anerkennen, dass wir selbst die wichtigsten Menschen in unserem Leben sind. Wir können uns vom Mythos abkehren und dürfen Schwäche zeigen. Wir können lernen, wieder auf unseren Körper zu hören und die Signale wahrzunehmen, statt sie zu bekämpfen. Wir können herausfinden, was wir selbst eigentlich wollen und was unsere Grundbedürfnisse sind. Wir können lernen, uns abzugrenzen und Nein zu sagen, wenn eine Grenze erreicht ist. Wir können regelmäßige ungestörte Pausen einfordern. Wir können uns einen Mentor für psychisch herausfordernde Fälle und einen Hausarzt suchen. Durch Achtsamkeit, Meditation und Yoga können wir die Stressantwort des Körpers regulieren. Atemübungen, Bewegung an der frischen Luft und die gezielte Steuerung der Gedanken schaffen eine emotionale Distanz in krisenhaften Situationen. Mittlerweile bieten auch gewisse Krankenkassen Stressbewältigungskurse an – auch online (höre dazu auch gerne mal in meinen Podcast rein).
Wir können klare Vorgaben des Arbeitgebers bei Krankheit einfordern und Ideen für Maßnahmen zur Gesundheit am Arbeitsplatz einbringen (wie z. B. Gruppentraining zur Verbesserung der Stressbewältigung, Angebote für Prävention). Wir können Entscheidungen treffen, anstatt abzuwarten: Kaum etwas setzt den Körper stärker unter Stress als Kontrollverlust und das Gefühl, machtlos zu sein. Doch genau in dieser Position verharren viele und wünschen sich einen Zauber, der sie aus der Situation befreit.
Dabei hast du in jedem Augenblick die Wahl: Du kannst aus der Opferhaltung aussteigen, wieder Verantwortung übernehmen und aktiv werden. Anzufangen und einen Plan zu erstellen lässt positivere Gefühle frei als das Ausharren in der Opferhaltung.
Der Burn-out-Prozess im Klinikalltag
In letzter Zeit gibt es viele Berichte darüber, wie es heutzutage in einigen Krankenhäusern läuft. Ich habe es selbst miterlebt, und da ich nicht den Eindruck habe, dass sich die Zustände in den Klinken verbessern, möchte ich gern mal genauer auf die Situation eingehen. Ich habe vor einiger Zeit einen Spiegel-Artikel gelesen, der mich bis heute sehr bewegt. Es geht darin um eine junge Ärztin, die gerade in der Inneren Medizin auf der Notaufnahme angefangen hatte und von ihrem Klinikalltag berichtete. Insgesamt kommt rüber, dass sie überhaupt nicht zufrieden ist, schon der Titel sagt alles: »Was für eine Ärztin bin ich bloß geworden?«4
Aus meiner Sicht liest sich der Artikel auszugsweise wie einzelne Phasen eines Burn-out-Prozesses. Dieser ist in verschiedene Phasen gegliedert:
Phase 1: Freundlichkeit/(Über-)Idealismus
Phase 2: Überforderung (die meist nicht wahrgenommen wird)
Phase 3: Geringer werdende Freundlichkeit
Phase 4: Schuldgefühle
Phase 5: Vermehrte Anstrengung
Phase 6: Erfolglosigkeit
Phase 7: Hilflosigkeit
Phase 8: Hoffnungslosigkeit
Phase 9: Erschöpfung, Abneigung gegen Patienten, Mitarbeiter
Phase 10: Burn-out-Syndrom mit Selbstbeschuldigung, psychosomatischen Reaktionen und Fehlzeiten
Ich möchte diesen Prozess anhand des Artikels exemplarisch nachzeichnen. Der Name der Ärztin wird in dem Artikel übrigens nicht genannt, was dafür sprechen könnte, dass es ihr peinlich ist und/oder dass sie berufliche Nachteile fürchtet. Ich glaube, vielen Ärzten ist es unangenehm, Schwäche zuzugeben. Das kann ich vollkommen verstehen. Mir ging es ja auch jahrelang so. Ich freue mich einfach nur, dass sie sich überhaupt getraut hat, diesen Artikel zu veröffentlichen.
Als Erstes haben wir die Freundlichkeit (Phase 1): Es ist die Rede von einer jungen, optimistischen, enthusiastischen Ärztin, die frisch vom Studium kommt und eine gute Internistin werden will. Weiterhin schildert sie, dass sie nach einem Jahr Klinikalltag schon völlig desillusioniert ist.
Nach dem ersten Jahr geht es schon über in Phase 2, die Überforderung, die dann meist nicht wahrgenommen wird. Die junge Frau spricht von ihrem 24-Stunden-Dienst, der eigentlich ein Bereitschaftsdienst ist, in dem sie voll zu tun hat. Es ist nämlich so, dass sie nach dem regulären Arbeitstag als Stationsärztin noch bis zum nächsten Tag bleibt. Sie hat in dieser Zeit in der Notaufnahme sieben Patienten aufzunehmen, und gleichzeitig ist sie zuständig für mehrere Normalstationen mit über Hundert Patienten – und das wohlgemerkt als Berufsanfängerin. Da kann, glaube ich, jeder verstehen, dass sie damit überfordert ist. Diese Überforderung wird meistens auch zu spät wahrgenommen, denn erstens gibt es aufgrund des Personalmangels ja niemanden, der ihr helfen könnte, und zweitens könnte ich mir vorstellen, dass da ein Gefühl mitspielt von: Es muss doch gehen! Die Kollegen schaffen es doch auch! Stell dich nicht so an! Weiter spricht sie dann von einem ganz normalen Arbeitstag, an dem sie eine Notiz erhält, dass der Kollege krank sei. Sie hat also für 24 Patienten eine Stunde Zeit für die Visite.
Die junge Ärztin benutzt Worte wie »kämpft sich allein durch« und »hechelt sich durch die Visite«, was auch auf absolute Überforderung hinweist. Gleichzeitig entsteht Frust, denn für ein nettes Wort oder den Kontakt zu den Patienten bleibt kaum Zeit. Und bei einem Notfall auf Station (EKG-Veränderungen im Sinne eines Herzinfarktes) bekommt sie keinen Oberarzt zu fassen, weil gerade keiner Zeit hat. Hier hört man die Hilflosigkeit heraus: »Irgendwer muss mir doch helfen können?«
Nicht einmal die Schwestern kann die Frau fragen, denn die sind auch knapp besetzt und noch beim Waschen der Patienten.
Die Betroffene ergreift die Initiative und bringt den Patienten allein auf die Überwachungsstation. Sie benutzt Begriffe wie »abschieben«, das zeigt, dass sie Schuldgefühle entwickelt hat, also dass sie gern geholfen hätte, aber es in dem Moment als Anfängerin nicht allein konnte.
Nun kommen wir auch schon in Phase 3 der geringer werdenden Freundlichkeit. Die Ärztin schreibt, dass auf der Station Angehörige auf sie warten, weinen und mit ihr über Patienten sprechen wollen – an und für sich sehr wichtige Gespräche, wofür sie aber überhaupt keine Zeit hat, denn Visite und Notfälle haben Priorität.
Und nun zu Phase 4, den Schuldgefühlen: Die junge Frau schließt sich im Arztzimmer ein und weint. »Was für eine Ärztin bin ich geworden?« Keine Zeit mehr für Arzt-Patienten-Kontakt. Keine Zeit für Angehörige. Keine Zeit mehr für zwischenmenschliche Beziehungen. All das, was wesentlich zur Gesundung beiträgt, bleibt auf der Strecke. Weiter schreibt sie, dass sie die fleißig mithelfende Studentin, die noch im Lernprozess ist, bei Fragen immer wieder auf morgen vertröstet. Somit wird auch die Weiterbildung vernachlässigt. Und auch hier merkt man wieder die Schuldgefühle.
Jetzt kommen wir zu Phase 5 und 6, also vermehrter Anstrengung und Erfolglosigkeit. Bei der Visite fragt der Chef, warum ein 94-jähriger Patient noch nicht entlassen sei (dieser Patient hatte Schmerzen und konnte noch nicht allein nach Hause zurück).
Die Ärztin schreibt: Es geht nicht darum, gute Medizin zu machen, sondern viele Patienten durchzuschleusen und gute Zahlen zu bringen. Hier entsteht das Gefühl der Sinnlosigkeit und die Einschätzung, dass ihre Anstrengungen und Bemühungen umsonst sind.
Und es kommt zur 7. und 8. Phase der Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Sie schreibt: »Irgendwer muss mir doch helfen?«
Ein Kollege gibt ihr den Tipp, ihren Idealismus aufzugeben und sich ein dickes Fell zuzulegen. Das entspricht aber nicht ihrer Persönlichkeit, denn sie schreibt, dass sie es schrecklich findet, wenn sie bei den Aufnahmeuntersuchungen einfach die Fußpulse nicht tastet, weil für An- und Ausziehen keine Zeit da ist. In dieser Phase der Hilf- und Hoffnungslosigkeit befindet sich unsere junge Kollegin und überlegt, was sie tun soll. »Ist es das wert?« Sie suche einen Kompromiss, bei dem sie ihre Ideale nicht aufgeben muss. Sie liebe ihren Beruf, will aber weder Gesundheit noch Privatleben opfern.
Dieser Artikel spiegelt auch aus meiner Erfahrung und den Schilderungen anderer Kollegen und Kolleginnen sehr gut die Situation wider, wie es heutzutage in einigen Kliniken abläuft.